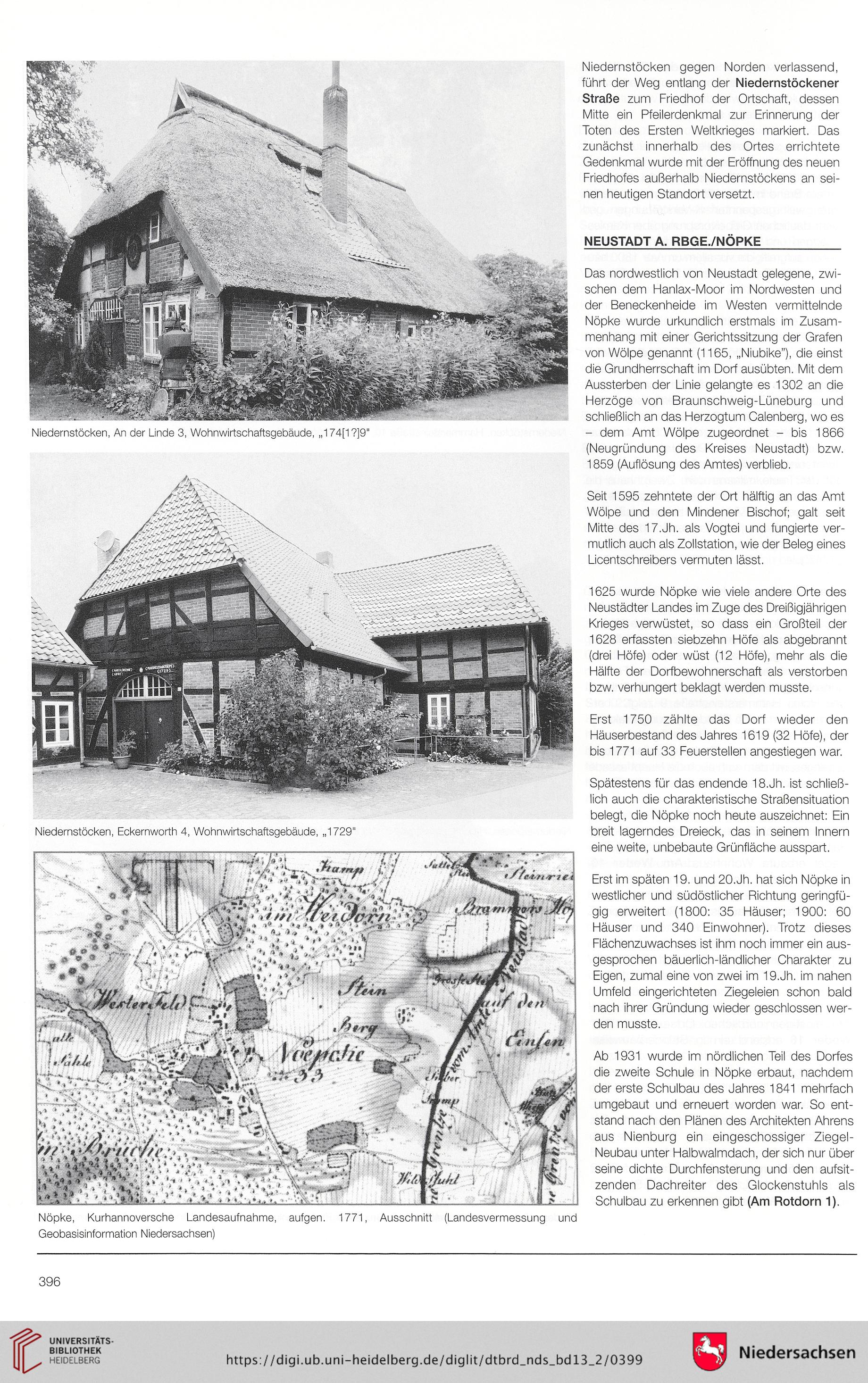Niedernstöcken, An der Linde 3, Wohnwirtschaftsgebäude, „174[1?]9"
Niedernstöcken, Eckernworth 4, Wohnwirtschaftsgebäude, „1729"
Niedernstöcken gegen Norden verlassend,
führt der Weg entlang der Niedernstöckener
Straße zum Friedhof der Ortschaft, dessen
Mitte ein Pfeilerdenkmal zur Erinnerung der
Toten des Ersten Weltkrieges markiert. Das
zunächst innerhalb des Ortes errichtete
Gedenkmai wurde mit der Eröffnung des neuen
Friedhofes außerhalb Niedernstöckens an sei-
nen heutigen Standort versetzt.
NEUSTADT A. RBGE./NÖPKE
Das nordwestlich von Neustadt gelegene, zwi-
schen dem Hanlax-Moor im Nordwesten und
der Beneckenheide im Westen vermittelnde
Nöpke wurde urkundlich erstmals im Zusam-
menhang mit einer Gerichtssitzung der Grafen
von Wölpe genannt (1165, „Niubike”), die einst
die Grundherrschaft im Dorf ausübten. Mit dem
Aussterben der Linie gelangte es 1302 an die
Herzöge von Braunschweig-Lüneburg und
schließlich an das Herzogtum Calenberg, wo es
- dem Amt Wölpe zugeordnet - bis 1866
(Neugründung des Kreises Neustadt) bzw.
1859 (Auflösung des Amtes) verblieb.
Seit 1595 zehntete der Ort hälftig an das Amt
Wölpe und den Mindener Bischof; galt seit
Mitte des 17.Jh. als Vogtei und fungierte ver-
mutlich auch als Zollstation, wie der Beleg eines
Licentschreibers vermuten lässt.
1625 wurde Nöpke wie viele andere Orte des
Neustädter Landes im Zuge des Dreißigjährigen
Krieges verwüstet, so dass ein Großteil der
1628 erfassten siebzehn Höfe als abgebrannt
(drei Höfe) oder wüst (12 Höfe), mehr als die
Hälfte der Dorfbewohnerschaft als verstorben
bzw. verhungert beklagt werden musste.
Erst 1750 zählte das Dorf wieder den
Häuserbestand des Jahres 1619 (32 Höfe), der
bis 1771 auf 33 Feuerstellen angestiegen war.
Spätestens für das endende 18.Jh. ist schließ-
lich auch die charakteristische Straßensituation
belegt, die Nöpke noch heute auszeichnet: Ein
breit lagerndes Dreieck, das in seinem Innern
eine weite, unbebaute Grünfläche ausspart.
Erst im späten 19. und 20.Jh. hat sich Nöpke in
westlicher und südöstlicher Richtung geringfü-
gig erweitert (1800: 35 Häuser; 1900: 60
Häuser und 340 Einwohner). Trotz dieses
Flächenzuwachses ist ihm noch immer ein aus-
gesprochen bäuerlich-ländlicher Charakter zu
Eigen, zumal eine von zwei im 19.Jh. im nahen
Umfeld eingerichteten Ziegeleien schon bald
nach ihrer Gründung wieder geschlossen wer-
den musste.
Ab 1931 wurde im nördlichen Teil des Dorfes
die zweite Schule in Nöpke erbaut, nachdem
der erste Schulbau des Jahres 1841 mehrfach
umgebaut und erneuert worden war. So ent-
stand nach den Plänen des Architekten Ahrens
aus Nienburg ein eingeschossiger Ziegel-
Neubau unter Halbwalmdach, der sich nur über
seine dichte Durchfensterung und den aufsit-
zenden Dachreiter des Glockenstuhls als
Schulbau zu erkennen gibt (Am Rotdorn 1).
Nöpke, Kurhannoversche Landesaufnahme, aufgen. 1771, Ausschnitt (Landesvermessung und
Geobasisinformation Niedersachsen)
396
Niedernstöcken, Eckernworth 4, Wohnwirtschaftsgebäude, „1729"
Niedernstöcken gegen Norden verlassend,
führt der Weg entlang der Niedernstöckener
Straße zum Friedhof der Ortschaft, dessen
Mitte ein Pfeilerdenkmal zur Erinnerung der
Toten des Ersten Weltkrieges markiert. Das
zunächst innerhalb des Ortes errichtete
Gedenkmai wurde mit der Eröffnung des neuen
Friedhofes außerhalb Niedernstöckens an sei-
nen heutigen Standort versetzt.
NEUSTADT A. RBGE./NÖPKE
Das nordwestlich von Neustadt gelegene, zwi-
schen dem Hanlax-Moor im Nordwesten und
der Beneckenheide im Westen vermittelnde
Nöpke wurde urkundlich erstmals im Zusam-
menhang mit einer Gerichtssitzung der Grafen
von Wölpe genannt (1165, „Niubike”), die einst
die Grundherrschaft im Dorf ausübten. Mit dem
Aussterben der Linie gelangte es 1302 an die
Herzöge von Braunschweig-Lüneburg und
schließlich an das Herzogtum Calenberg, wo es
- dem Amt Wölpe zugeordnet - bis 1866
(Neugründung des Kreises Neustadt) bzw.
1859 (Auflösung des Amtes) verblieb.
Seit 1595 zehntete der Ort hälftig an das Amt
Wölpe und den Mindener Bischof; galt seit
Mitte des 17.Jh. als Vogtei und fungierte ver-
mutlich auch als Zollstation, wie der Beleg eines
Licentschreibers vermuten lässt.
1625 wurde Nöpke wie viele andere Orte des
Neustädter Landes im Zuge des Dreißigjährigen
Krieges verwüstet, so dass ein Großteil der
1628 erfassten siebzehn Höfe als abgebrannt
(drei Höfe) oder wüst (12 Höfe), mehr als die
Hälfte der Dorfbewohnerschaft als verstorben
bzw. verhungert beklagt werden musste.
Erst 1750 zählte das Dorf wieder den
Häuserbestand des Jahres 1619 (32 Höfe), der
bis 1771 auf 33 Feuerstellen angestiegen war.
Spätestens für das endende 18.Jh. ist schließ-
lich auch die charakteristische Straßensituation
belegt, die Nöpke noch heute auszeichnet: Ein
breit lagerndes Dreieck, das in seinem Innern
eine weite, unbebaute Grünfläche ausspart.
Erst im späten 19. und 20.Jh. hat sich Nöpke in
westlicher und südöstlicher Richtung geringfü-
gig erweitert (1800: 35 Häuser; 1900: 60
Häuser und 340 Einwohner). Trotz dieses
Flächenzuwachses ist ihm noch immer ein aus-
gesprochen bäuerlich-ländlicher Charakter zu
Eigen, zumal eine von zwei im 19.Jh. im nahen
Umfeld eingerichteten Ziegeleien schon bald
nach ihrer Gründung wieder geschlossen wer-
den musste.
Ab 1931 wurde im nördlichen Teil des Dorfes
die zweite Schule in Nöpke erbaut, nachdem
der erste Schulbau des Jahres 1841 mehrfach
umgebaut und erneuert worden war. So ent-
stand nach den Plänen des Architekten Ahrens
aus Nienburg ein eingeschossiger Ziegel-
Neubau unter Halbwalmdach, der sich nur über
seine dichte Durchfensterung und den aufsit-
zenden Dachreiter des Glockenstuhls als
Schulbau zu erkennen gibt (Am Rotdorn 1).
Nöpke, Kurhannoversche Landesaufnahme, aufgen. 1771, Ausschnitt (Landesvermessung und
Geobasisinformation Niedersachsen)
396