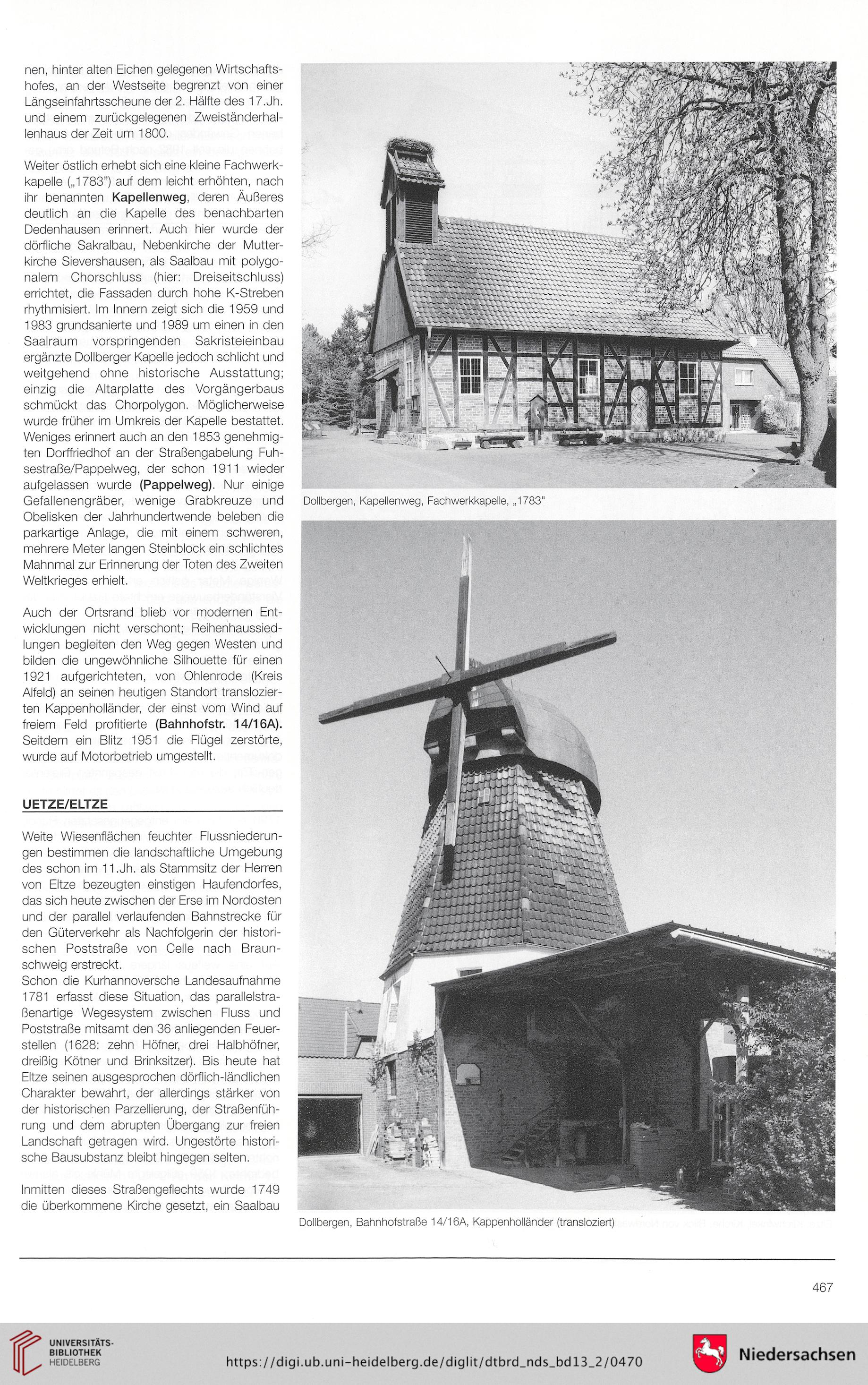nen, hinter alten Eichen gelegenen Wirtschafts-
hofes, an der Westseite begrenzt von einer
Längseinfahrtsscheune der 2. Hälfte des 17.Jh.
und einem zurückgelegenen Zweiständerhal-
lenhaus der Zeit um 1800.
Weiter östlich erhebt sich eine kleine Fachwerk-
kapelle („1783”) auf dem leicht erhöhten, nach
ihr benannten Kapellenweg, deren Äußeres
deutlich an die Kapelle des benachbarten
Dedenhausen erinnert. Auch hier wurde der
dörfliche Sakralbau, Nebenkirche der Mutter-
kirche Sievershausen, als Saalbau mit polygo-
nalem Chorschluss (hier: Dreiseitschluss)
errichtet, die Fassaden durch hohe K-Streben
rhythmisiert. Im Innern zeigt sich die 1959 und
1983 grundsanierte und 1989 um einen in den
Saalraum vorspringenden Sakristeieinbau
ergänzte Dollberger Kapelle jedoch schlicht und
weitgehend ohne historische Ausstattung;
einzig die Altarplatte des Vorgängerbaus
schmückt das Chorpolygon. Möglicherweise
wurde früher im Umkreis der Kapelle bestattet.
Weniges erinnert auch an den 1853 genehmig-
ten Dorffriedhof an der Straßengabelung Fuh-
sestraße/Pappelweg, der schon 1911 wieder
aufgelassen wurde (Pappelweg). Nur einige
Gefallenengräber, wenige Grabkreuze und
Obelisken der Jahrhundertwende beleben die
parkartige Anlage, die mit einem schweren,
mehrere Meter langen Steinblock ein schlichtes
Mahnmal zur Erinnerung der Toten des Zweiten
Weltkrieges erhielt.
Auch der Ortsrand blieb vor modernen Ent-
wicklungen nicht verschont; Reihenhaussied-
lungen begleiten den Weg gegen Westen und
bilden die ungewöhnliche Silhouette für einen
1921 aufgerichteten, von Ohlenrode (Kreis
Alfeld) an seinen heutigen Standort translozier-
ten Kappenholländer, der einst vom Wind auf
freiem Feld profitierte (Bahnhofstr. 14/16A).
Seitdem ein Blitz 1951 die Flügel zerstörte,
wurde auf Motorbetrieb umgestellt.
UETZE/ELTZE
Weite Wiesenflächen feuchter Flussniederun-
gen bestimmen die landschaftliche Umgebung
des schon im 11 .Jh. als Stammsitz der Herren
von Eltze bezeugten einstigen Haufendorfes,
das sich heute zwischen der Erse im Nordosten
und der parallel verlaufenden Bahnstrecke für
den Güterverkehr als Nachfolgerin der histori-
schen Poststraße von Celle nach Braun-
schweig erstreckt.
Schon die Kurhannoversche Landesaufnahme
1781 erfasst diese Situation, das parallelstra-
ßenartige Wegesystem zwischen Fluss und
Poststraße mitsamt den 36 anliegenden Feuer-
stellen (1628: zehn Höfner, drei Halbhöfner,
dreißig Kötner und Brinksitzer). Bis heute hat
Eltze seinen ausgesprochen dörflich-ländlichen
Charakter bewahrt, der allerdings stärker von
der historischen Parzellierung, der Straßenfüh-
rung und dem abrupten Übergang zur freien
Landschaft getragen wird. Ungestörte histori-
sche Bausubstanz bleibt hingegen selten.
Inmitten dieses Straßengeflechts wurde 1749
die überkommene Kirche gesetzt, ein Saalbau
Dollbergen, Kapellenweg, Fachwerkkapelle, „1783"
Dollbergen, Bahnhofstraße 14/16A, Kappenholländer (transloziert)
467
hofes, an der Westseite begrenzt von einer
Längseinfahrtsscheune der 2. Hälfte des 17.Jh.
und einem zurückgelegenen Zweiständerhal-
lenhaus der Zeit um 1800.
Weiter östlich erhebt sich eine kleine Fachwerk-
kapelle („1783”) auf dem leicht erhöhten, nach
ihr benannten Kapellenweg, deren Äußeres
deutlich an die Kapelle des benachbarten
Dedenhausen erinnert. Auch hier wurde der
dörfliche Sakralbau, Nebenkirche der Mutter-
kirche Sievershausen, als Saalbau mit polygo-
nalem Chorschluss (hier: Dreiseitschluss)
errichtet, die Fassaden durch hohe K-Streben
rhythmisiert. Im Innern zeigt sich die 1959 und
1983 grundsanierte und 1989 um einen in den
Saalraum vorspringenden Sakristeieinbau
ergänzte Dollberger Kapelle jedoch schlicht und
weitgehend ohne historische Ausstattung;
einzig die Altarplatte des Vorgängerbaus
schmückt das Chorpolygon. Möglicherweise
wurde früher im Umkreis der Kapelle bestattet.
Weniges erinnert auch an den 1853 genehmig-
ten Dorffriedhof an der Straßengabelung Fuh-
sestraße/Pappelweg, der schon 1911 wieder
aufgelassen wurde (Pappelweg). Nur einige
Gefallenengräber, wenige Grabkreuze und
Obelisken der Jahrhundertwende beleben die
parkartige Anlage, die mit einem schweren,
mehrere Meter langen Steinblock ein schlichtes
Mahnmal zur Erinnerung der Toten des Zweiten
Weltkrieges erhielt.
Auch der Ortsrand blieb vor modernen Ent-
wicklungen nicht verschont; Reihenhaussied-
lungen begleiten den Weg gegen Westen und
bilden die ungewöhnliche Silhouette für einen
1921 aufgerichteten, von Ohlenrode (Kreis
Alfeld) an seinen heutigen Standort translozier-
ten Kappenholländer, der einst vom Wind auf
freiem Feld profitierte (Bahnhofstr. 14/16A).
Seitdem ein Blitz 1951 die Flügel zerstörte,
wurde auf Motorbetrieb umgestellt.
UETZE/ELTZE
Weite Wiesenflächen feuchter Flussniederun-
gen bestimmen die landschaftliche Umgebung
des schon im 11 .Jh. als Stammsitz der Herren
von Eltze bezeugten einstigen Haufendorfes,
das sich heute zwischen der Erse im Nordosten
und der parallel verlaufenden Bahnstrecke für
den Güterverkehr als Nachfolgerin der histori-
schen Poststraße von Celle nach Braun-
schweig erstreckt.
Schon die Kurhannoversche Landesaufnahme
1781 erfasst diese Situation, das parallelstra-
ßenartige Wegesystem zwischen Fluss und
Poststraße mitsamt den 36 anliegenden Feuer-
stellen (1628: zehn Höfner, drei Halbhöfner,
dreißig Kötner und Brinksitzer). Bis heute hat
Eltze seinen ausgesprochen dörflich-ländlichen
Charakter bewahrt, der allerdings stärker von
der historischen Parzellierung, der Straßenfüh-
rung und dem abrupten Übergang zur freien
Landschaft getragen wird. Ungestörte histori-
sche Bausubstanz bleibt hingegen selten.
Inmitten dieses Straßengeflechts wurde 1749
die überkommene Kirche gesetzt, ein Saalbau
Dollbergen, Kapellenweg, Fachwerkkapelle, „1783"
Dollbergen, Bahnhofstraße 14/16A, Kappenholländer (transloziert)
467