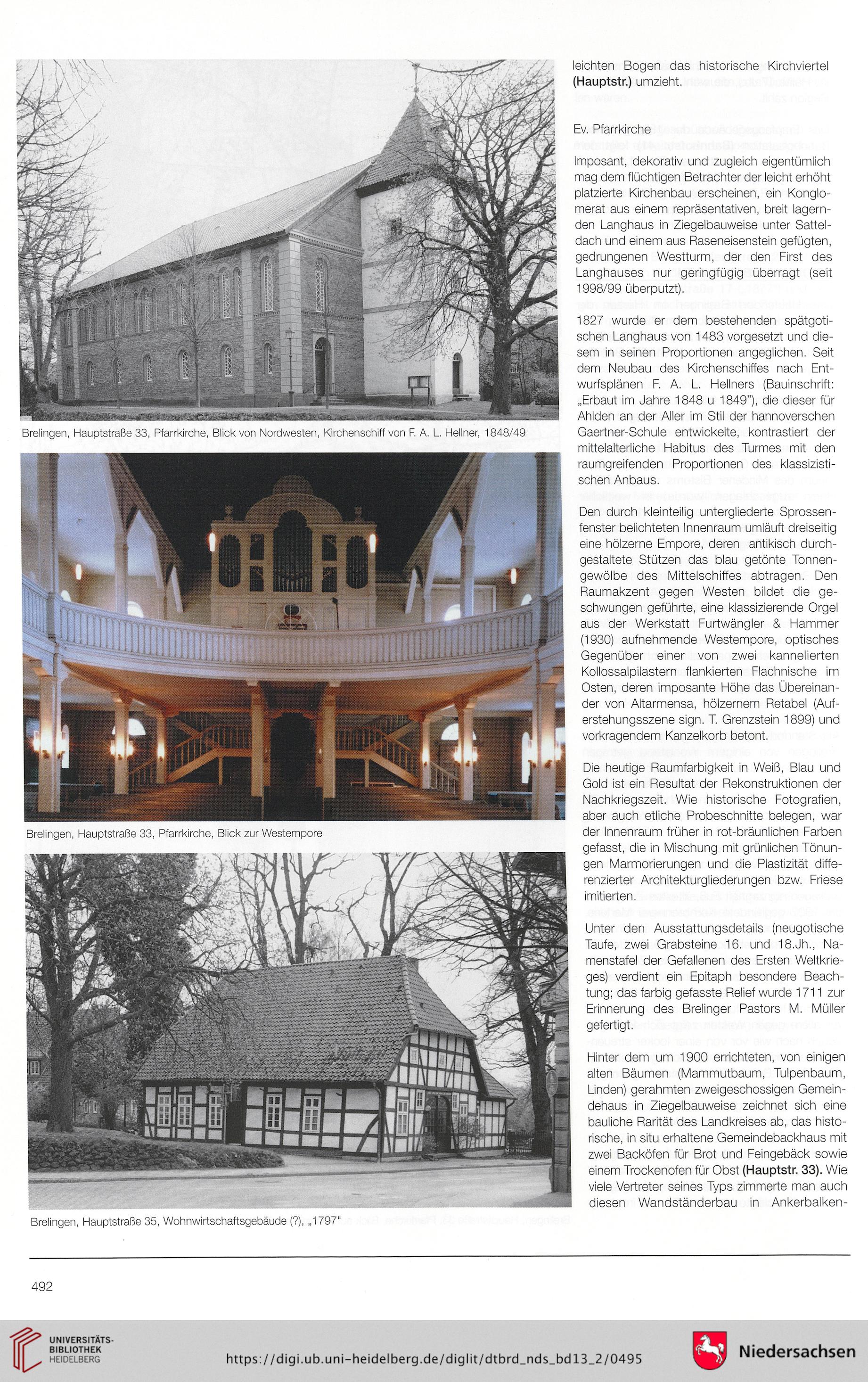leichten Bogen das historische Kirchviertel
(Hauptstr.) umzieht.
Brelingen, Hauptstraße 33, Pfarrkirche, Blick zur Westempore
Ev. Pfarrkirche
Imposant, dekorativ und zugleich eigentümlich
mag dem flüchtigen Betrachter der leicht erhöht
platzierte Kirchenbau erscheinen, ein Konglo-
merat aus einem repräsentativen, breit lagern-
den Langhaus in Ziegelbauweise unter Sattel-
dach und einem aus Raseneisenstein gefügten,
gedrungenen Westturm, der den First des
Langhauses nur geringfügig überragt (seit
1998/99 überputzt).
1827 wurde er dem bestehenden spätgoti-
schen Langhaus von 1483 vorgesetzt und die-
sem in seinen Proportionen angeglichen. Seit
dem Neubau des Kirchenschiffes nach Ent-
wurfsplänen F. A. L. Hellners (Bauinschrift:
„Erbaut im Jahre 1848 u 1849”), die dieser für
Ahlden an der Aller im Stil der hannoverschen
Gaertner-Schule entwickelte, kontrastiert der
mittelalterliche Habitus des Turmes mit den
raumgreifenden Proportionen des klassizisti-
schen Anbaus.
Den durch kleinteilig untergliederte Sprossen-
fenster belichteten Innenraum umläuft dreiseitig
eine hölzerne Empore, deren antikisch durch-
gestaltete Stützen das blau getönte Tonnen-
gewölbe des Mittelschiffes abtragen. Den
Raumakzent gegen Westen bildet die ge-
schwungen geführte, eine klassizierende Orgel
aus der Werkstatt Furtwängler & Hammer
(1930) aufnehmende Westempore, optisches
Gegenüber einer von zwei kannelierten
Kollossalpilastern flankierten Flachnische im
Osten, deren imposante Höhe das Übereinan-
der von Altarmensa, hölzernem Retabel (Auf-
erstehungsszene sign. T. Grenzstein 1899) und
vorkragendem Kanzelkorb betont.
Die heutige Raumfarbigkeit in Weiß, Blau und
Gold ist ein Resultat der Rekonstruktionen der
Nachkriegszeit. Wie historische Fotografien,
aber auch etliche Probeschnitte belegen, war
der Innenraum früher in rot-bräunlichen Farben
gefasst, die in Mischung mit grünlichen Tönun-
gen Marmorierungen und die Plastizität diffe-
renzierter Architekturgliederungen bzw. Friese
imitierten.
Unter den Ausstattungsdetails (neugotische
Taufe, zwei Grabsteine 16. und 18.Jh., Na-
menstafel der Gefallenen des Ersten Weltkrie-
ges) verdient ein Epitaph besondere Beach-
tung; das farbig gefasste Relief wurde 1711 zur
Erinnerung des Brelinger Pastors M. Müller
gefertigt.
Hinter dem um 1900 errichteten, von einigen
alten Bäumen (Mammutbaum, Tulpenbaum,
Linden) gerahmten zweigeschossigen Gemein-
dehaus in Ziegelbauweise zeichnet sich eine
bauliche Rarität des Landkreises ab, das histo-
rische, in situ erhaltene Gemeindebackhaus mit
zwei Backöfen für Brot und Feingebäck sowie
einem Trockenofen für Obst (Hauptstr. 33). Wie
viele Vertreter seines Typs zimmerte man auch
diesen Wandständerbau in Ankerbalken-
Brelingen, Hauptstraße 35, Wohnwirtschaftsgebäude (?), „1797"
492
(Hauptstr.) umzieht.
Brelingen, Hauptstraße 33, Pfarrkirche, Blick zur Westempore
Ev. Pfarrkirche
Imposant, dekorativ und zugleich eigentümlich
mag dem flüchtigen Betrachter der leicht erhöht
platzierte Kirchenbau erscheinen, ein Konglo-
merat aus einem repräsentativen, breit lagern-
den Langhaus in Ziegelbauweise unter Sattel-
dach und einem aus Raseneisenstein gefügten,
gedrungenen Westturm, der den First des
Langhauses nur geringfügig überragt (seit
1998/99 überputzt).
1827 wurde er dem bestehenden spätgoti-
schen Langhaus von 1483 vorgesetzt und die-
sem in seinen Proportionen angeglichen. Seit
dem Neubau des Kirchenschiffes nach Ent-
wurfsplänen F. A. L. Hellners (Bauinschrift:
„Erbaut im Jahre 1848 u 1849”), die dieser für
Ahlden an der Aller im Stil der hannoverschen
Gaertner-Schule entwickelte, kontrastiert der
mittelalterliche Habitus des Turmes mit den
raumgreifenden Proportionen des klassizisti-
schen Anbaus.
Den durch kleinteilig untergliederte Sprossen-
fenster belichteten Innenraum umläuft dreiseitig
eine hölzerne Empore, deren antikisch durch-
gestaltete Stützen das blau getönte Tonnen-
gewölbe des Mittelschiffes abtragen. Den
Raumakzent gegen Westen bildet die ge-
schwungen geführte, eine klassizierende Orgel
aus der Werkstatt Furtwängler & Hammer
(1930) aufnehmende Westempore, optisches
Gegenüber einer von zwei kannelierten
Kollossalpilastern flankierten Flachnische im
Osten, deren imposante Höhe das Übereinan-
der von Altarmensa, hölzernem Retabel (Auf-
erstehungsszene sign. T. Grenzstein 1899) und
vorkragendem Kanzelkorb betont.
Die heutige Raumfarbigkeit in Weiß, Blau und
Gold ist ein Resultat der Rekonstruktionen der
Nachkriegszeit. Wie historische Fotografien,
aber auch etliche Probeschnitte belegen, war
der Innenraum früher in rot-bräunlichen Farben
gefasst, die in Mischung mit grünlichen Tönun-
gen Marmorierungen und die Plastizität diffe-
renzierter Architekturgliederungen bzw. Friese
imitierten.
Unter den Ausstattungsdetails (neugotische
Taufe, zwei Grabsteine 16. und 18.Jh., Na-
menstafel der Gefallenen des Ersten Weltkrie-
ges) verdient ein Epitaph besondere Beach-
tung; das farbig gefasste Relief wurde 1711 zur
Erinnerung des Brelinger Pastors M. Müller
gefertigt.
Hinter dem um 1900 errichteten, von einigen
alten Bäumen (Mammutbaum, Tulpenbaum,
Linden) gerahmten zweigeschossigen Gemein-
dehaus in Ziegelbauweise zeichnet sich eine
bauliche Rarität des Landkreises ab, das histo-
rische, in situ erhaltene Gemeindebackhaus mit
zwei Backöfen für Brot und Feingebäck sowie
einem Trockenofen für Obst (Hauptstr. 33). Wie
viele Vertreter seines Typs zimmerte man auch
diesen Wandständerbau in Ankerbalken-
Brelingen, Hauptstraße 35, Wohnwirtschaftsgebäude (?), „1797"
492