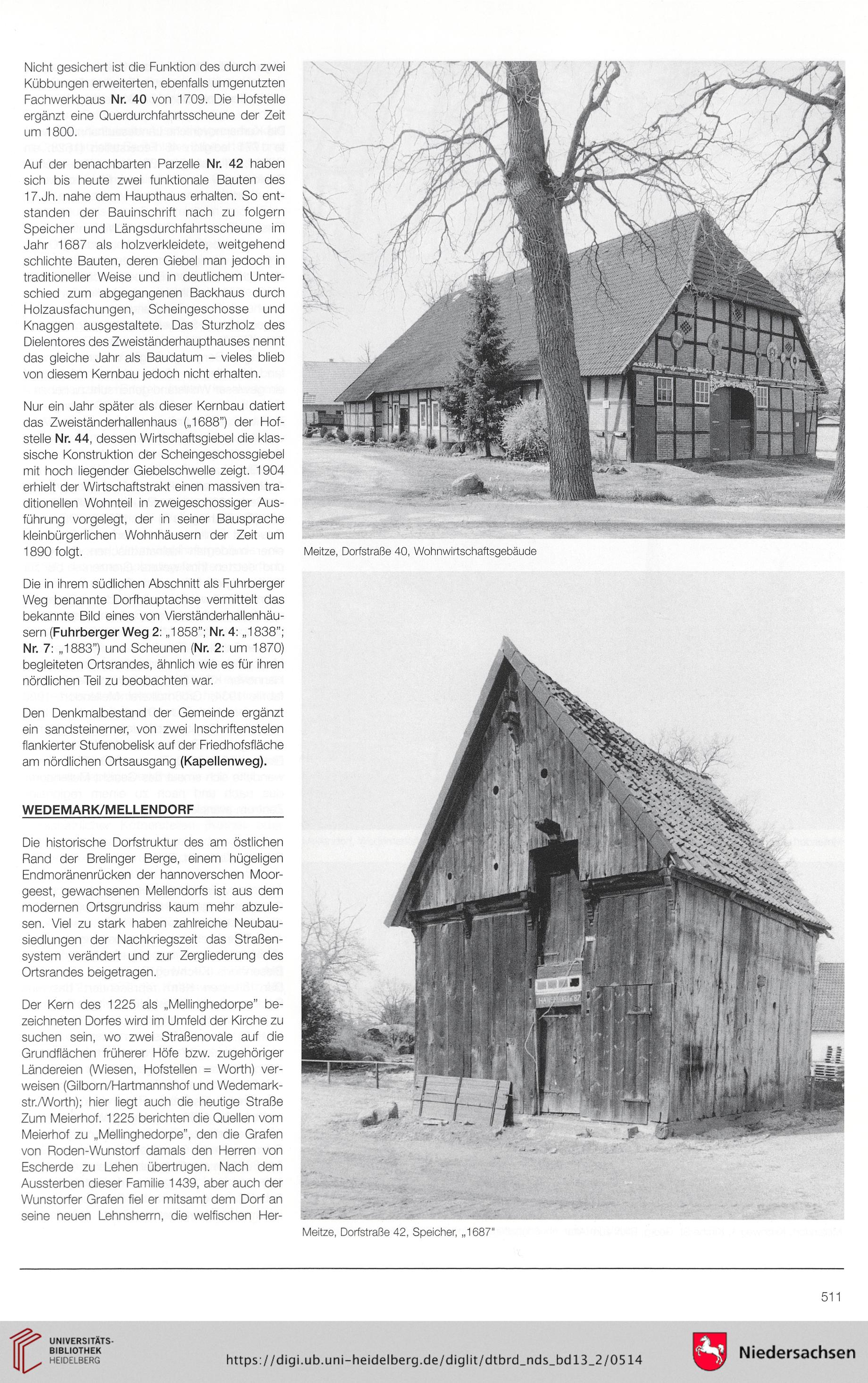Nicht gesichert ist die Funktion des durch zwei
Kübbungen erweiterten, ebenfalls umgenutzten
Fachwerkbaus Nr. 40 von 1709. Die Hofstelle
ergänzt eine Querdurchfahrtsscheune der Zeit
um 1800.
Auf der benachbarten Parzelle Nr. 42 haben
sich bis heute zwei funktionale Bauten des
17.Jh. nahe dem Haupthaus erhalten. So ent-
standen der Bauinschrift nach zu folgern
Speicher und Längsdurchfahrtsscheune im
Jahr 1687 als holzverkleidete, weitgehend
schlichte Bauten, deren Giebel man jedoch in
traditioneller Weise und in deutlichem Unter-
schied zum abgegangenen Backhaus durch
Holzausfachungen, Scheingeschosse und
Knaggen ausgestaltete. Das Sturzholz des
Dielentores des Zweiständerhaupthauses nennt
das gleiche Jahr als Baudatum - vieles blieb
von diesem Kernbau jedoch nicht erhalten.
Nur ein Jahr später als dieser Kernbau datiert
das Zweiständerhallenhaus („1688”) der Hof-
stelle Nr. 44, dessen Wirtschaftsgiebel die klas-
sische Konstruktion der Scheingeschossgiebel
mit hoch liegender Giebelschwelle zeigt. 1904
erhielt der Wirtschaftstrakt einen massiven tra-
ditionellen Wohnteil in zweigeschossiger Aus-
führung vorgelegt, der in seiner Bausprache
kleinbürgerlichen Wohnhäusern der Zeit um
1890 folgt.
Meitze, Dorfstraße 40, Wohnwirtschaftsgebäude
Die in ihrem südlichen Abschnitt als Fuhrberger
Weg benannte Dorfhauptachse vermittelt das
bekannte Bild eines von Vierständerhallenhäu-
sern (Fuhrberger Weg 2: „1858”; Nr. 4: „1838”;
Nr. 7: „1883”) und Scheunen (Nr. 2: um 1870)
begleiteten Ortsrandes, ähnlich wie es für ihren
nördlichen Teil zu beobachten war.
Den Denkmalbestand der Gemeinde ergänzt
ein sandsteinerner, von zwei Inschriftenstelen
flankierter Stufenobelisk auf der Friedhofsfläche
am nördlichen Ortsausgang (Kapellenweg).
WEDEMARK/MELLENDORF
Die historische Dorfstruktur des am östlichen
Rand der Brelinger Berge, einem hügeligen
Endmoränenrücken der hannoverschen Moor-
geest, gewachsenen Mellendorfs ist aus dem
modernen Ortsgrundriss kaum mehr abzule-
sen. Viel zu stark haben zahlreiche Neubau-
siedlungen der Nachkriegszeit das Straßen-
system verändert und zur Zergliederung des
Ortsrandes beigetragen.
Der Kern des 1225 als „Mellinghedorpe” be-
zeichneten Dorfes wird im Umfeld der Kirche zu
suchen sein, wo zwei Straßenovale auf die
Grundflächen früherer Höfe bzw. zugehöriger
Ländereien (Wiesen, Hofstellen = Worth) ver-
weisen (Gilborn/Hartmannshof und Wedemark-
str./Worth); hier liegt auch die heutige Straße
Zum Meierhof. 1225 berichten die Quellen vom
Meierhof zu „Mellinghedorpe”, den die Grafen
von Roden-Wunstorf damals den Herren von
Escherde zu Lehen übertrugen. Nach dem
Aussterben dieser Familie 1439, aber auch der
Wunstorfer Grafen fiel er mitsamt dem Dorf an
seine neuen Lehnsherrn, die welfischen Her-
Meitze, Dorfstraße 42, Speicher, „1687"
511
Kübbungen erweiterten, ebenfalls umgenutzten
Fachwerkbaus Nr. 40 von 1709. Die Hofstelle
ergänzt eine Querdurchfahrtsscheune der Zeit
um 1800.
Auf der benachbarten Parzelle Nr. 42 haben
sich bis heute zwei funktionale Bauten des
17.Jh. nahe dem Haupthaus erhalten. So ent-
standen der Bauinschrift nach zu folgern
Speicher und Längsdurchfahrtsscheune im
Jahr 1687 als holzverkleidete, weitgehend
schlichte Bauten, deren Giebel man jedoch in
traditioneller Weise und in deutlichem Unter-
schied zum abgegangenen Backhaus durch
Holzausfachungen, Scheingeschosse und
Knaggen ausgestaltete. Das Sturzholz des
Dielentores des Zweiständerhaupthauses nennt
das gleiche Jahr als Baudatum - vieles blieb
von diesem Kernbau jedoch nicht erhalten.
Nur ein Jahr später als dieser Kernbau datiert
das Zweiständerhallenhaus („1688”) der Hof-
stelle Nr. 44, dessen Wirtschaftsgiebel die klas-
sische Konstruktion der Scheingeschossgiebel
mit hoch liegender Giebelschwelle zeigt. 1904
erhielt der Wirtschaftstrakt einen massiven tra-
ditionellen Wohnteil in zweigeschossiger Aus-
führung vorgelegt, der in seiner Bausprache
kleinbürgerlichen Wohnhäusern der Zeit um
1890 folgt.
Meitze, Dorfstraße 40, Wohnwirtschaftsgebäude
Die in ihrem südlichen Abschnitt als Fuhrberger
Weg benannte Dorfhauptachse vermittelt das
bekannte Bild eines von Vierständerhallenhäu-
sern (Fuhrberger Weg 2: „1858”; Nr. 4: „1838”;
Nr. 7: „1883”) und Scheunen (Nr. 2: um 1870)
begleiteten Ortsrandes, ähnlich wie es für ihren
nördlichen Teil zu beobachten war.
Den Denkmalbestand der Gemeinde ergänzt
ein sandsteinerner, von zwei Inschriftenstelen
flankierter Stufenobelisk auf der Friedhofsfläche
am nördlichen Ortsausgang (Kapellenweg).
WEDEMARK/MELLENDORF
Die historische Dorfstruktur des am östlichen
Rand der Brelinger Berge, einem hügeligen
Endmoränenrücken der hannoverschen Moor-
geest, gewachsenen Mellendorfs ist aus dem
modernen Ortsgrundriss kaum mehr abzule-
sen. Viel zu stark haben zahlreiche Neubau-
siedlungen der Nachkriegszeit das Straßen-
system verändert und zur Zergliederung des
Ortsrandes beigetragen.
Der Kern des 1225 als „Mellinghedorpe” be-
zeichneten Dorfes wird im Umfeld der Kirche zu
suchen sein, wo zwei Straßenovale auf die
Grundflächen früherer Höfe bzw. zugehöriger
Ländereien (Wiesen, Hofstellen = Worth) ver-
weisen (Gilborn/Hartmannshof und Wedemark-
str./Worth); hier liegt auch die heutige Straße
Zum Meierhof. 1225 berichten die Quellen vom
Meierhof zu „Mellinghedorpe”, den die Grafen
von Roden-Wunstorf damals den Herren von
Escherde zu Lehen übertrugen. Nach dem
Aussterben dieser Familie 1439, aber auch der
Wunstorfer Grafen fiel er mitsamt dem Dorf an
seine neuen Lehnsherrn, die welfischen Her-
Meitze, Dorfstraße 42, Speicher, „1687"
511