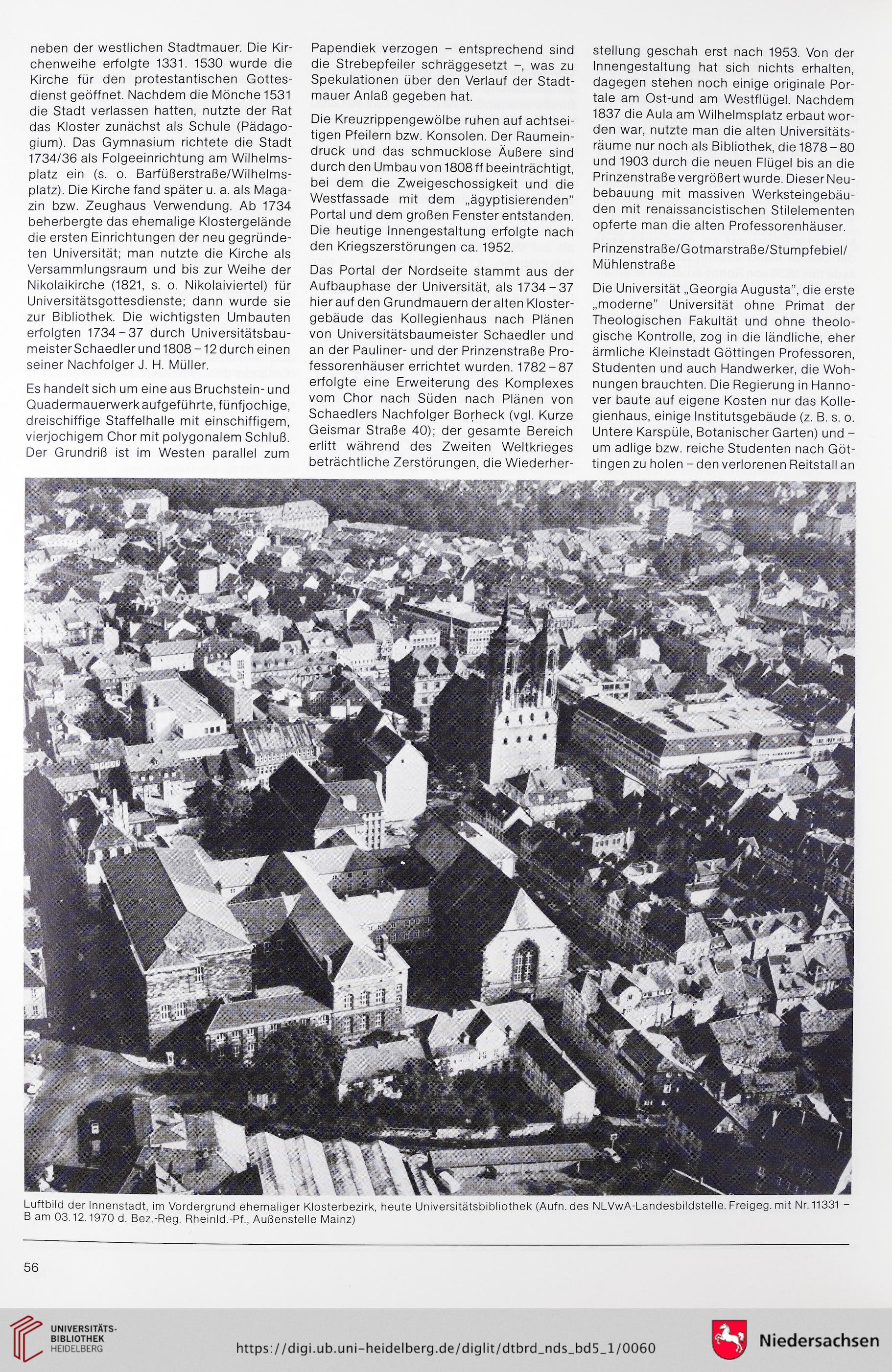neben der westlichen Stadtmauer. Die Kir-
chenweihe erfolgte 1331. 1530 wurde die
Kirche für den protestantischen Gottes-
dienst geöffnet. Nachdem die Mönche 1531
die Stadt verlassen hatten, nutzte der Rat
das Kloster zunächst als Schule (Pädago-
gium). Das Gymnasium richtete die Stadt
1734/36 als Folgeeinrichtung am Wilhelms-
platz ein (s. o. Barfüßerstraße/Wilhelms-
platz). Die Kirche fand später u. a. als Maga-
zin bzw. Zeughaus Verwendung. Ab 1734
beherbergte das ehemalige Klostergelände
die ersten Einrichtungen der neu gegründe-
ten Universität; man nutzte die Kirche als
Versammlungsraum und bis zur Weihe der
Nikolaikirche (1821, s. o. Nikolaiviertel) für
Universitätsgottesdienste; dann wurde sie
zur Bibliothek. Die wichtigsten Umbauten
erfolgten 1734-37 durch Universitätsbau-
meister Schaedler und 1808-12 durch einen
seiner Nachfolger J. H. Müller.
Es handelt sich um eine aus Bruchstein- und
Quadermauerwerk aufgeführte, fünfjochige,
dreischiffige Staffelhalle mit einschiffigem,
vierjochigem Chor mit polygonalem Schluß.
Der Grundriß ist im Westen parallel zum
Papendiek verzogen - entsprechend sind
die Strebepfeiler schräggesetzt -, was zu
Spekulationen über den Verlauf der Stadt-
mauer Anlaß gegeben hat.
Die Kreuzrippengewölbe ruhen auf achtsei-
tigen Pfeilern bzw. Konsolen. Der Raumein-
druck und das schmucklose Äußere sind
durch den Umbau von 1808 ff beeinträchtigt,
bei dem die Zweigeschossigkeit und die
Westfassade mit dem „ägyptisierenden”
Portal und dem großen Fenster entstanden.
Die heutige Innengestaltung erfolgte nach
den Kriegszerstörungen ca. 1952.
Das Portal der Nordseite stammt aus der
Aufbauphase der Universität, als 1734-37
hierauf den Grundmauern deralten Kloster-
gebäude das Kollegienhaus nach Plänen
von Universitätsbaumeister Schaedler und
an der Pauliner- und der Prinzenstraße Pro-
fessorenhäuser errichtet wurden. 1782-87
erfolgte eine Erweiterung des Komplexes
vom Chor nach Süden nach Plänen von
Schaedlers Nachfolger Borheck (vgl. Kurze
Geismar Straße 40); der gesamte Bereich
erlitt während des Zweiten Weltkrieges
beträchtliche Zerstörungen, die Wiederher-
stellung geschah erst nach 1953. Von der
Innengestaltung hat sich nichts erhalten,
dagegen stehen noch einige originale Por-
tale am Ost-und am Westflügel. Nachdem
1837 die Aula am Wilhelmsplatz erbaut wor-
den war, nutzte man die alten Universitäts-
räume nur noch als Bibliothek, die 1878-80
und 1903 durch die neuen Flügel bis an die
Prinzenstraße vergrößert wurde. Dieser Neu-
bebauung mit massiven Werksteingebäu-
den mit renaissancistischen Stilelementen
opferte man die alten Professorenhäuser.
Prinzenstraße/Gotmarstraße/Stumpfebiel/
Mühlenstraße
Die Universität „Georgia Augusta”, die erste
„moderne” Universität ohne Primat der
Theologischen Fakultät und ohne theolo-
gische Kontrolle, zog in die ländliche, eher
ärmliche Kleinstadt Göttingen Professoren,
Studenten und auch Handwerker, die Woh-
nungen brauchten. Die Regierung in Hanno-
ver baute auf eigene Kosten nur das Kolle-
gienhaus, einige Institutsgebäude (z. B. s. o.
Untere Karspüle, Botanischer Garten) und -
um adlige bzw. reiche Studenten nach Göt-
tingen zu holen - den verlorenen Reitstall an
Luftbild der Innenstadt, im Vordergrund ehemaliger Klosterbezirk, heute Universitätsbibliothek (Aufn. des NLVwA-Landesbildstelle. Freigeg. mit Nr. 11331
B am 03.12.1970 d. Bez.-Reg. Rheinld.-Pf., Außenstelle Mainz)
56
chenweihe erfolgte 1331. 1530 wurde die
Kirche für den protestantischen Gottes-
dienst geöffnet. Nachdem die Mönche 1531
die Stadt verlassen hatten, nutzte der Rat
das Kloster zunächst als Schule (Pädago-
gium). Das Gymnasium richtete die Stadt
1734/36 als Folgeeinrichtung am Wilhelms-
platz ein (s. o. Barfüßerstraße/Wilhelms-
platz). Die Kirche fand später u. a. als Maga-
zin bzw. Zeughaus Verwendung. Ab 1734
beherbergte das ehemalige Klostergelände
die ersten Einrichtungen der neu gegründe-
ten Universität; man nutzte die Kirche als
Versammlungsraum und bis zur Weihe der
Nikolaikirche (1821, s. o. Nikolaiviertel) für
Universitätsgottesdienste; dann wurde sie
zur Bibliothek. Die wichtigsten Umbauten
erfolgten 1734-37 durch Universitätsbau-
meister Schaedler und 1808-12 durch einen
seiner Nachfolger J. H. Müller.
Es handelt sich um eine aus Bruchstein- und
Quadermauerwerk aufgeführte, fünfjochige,
dreischiffige Staffelhalle mit einschiffigem,
vierjochigem Chor mit polygonalem Schluß.
Der Grundriß ist im Westen parallel zum
Papendiek verzogen - entsprechend sind
die Strebepfeiler schräggesetzt -, was zu
Spekulationen über den Verlauf der Stadt-
mauer Anlaß gegeben hat.
Die Kreuzrippengewölbe ruhen auf achtsei-
tigen Pfeilern bzw. Konsolen. Der Raumein-
druck und das schmucklose Äußere sind
durch den Umbau von 1808 ff beeinträchtigt,
bei dem die Zweigeschossigkeit und die
Westfassade mit dem „ägyptisierenden”
Portal und dem großen Fenster entstanden.
Die heutige Innengestaltung erfolgte nach
den Kriegszerstörungen ca. 1952.
Das Portal der Nordseite stammt aus der
Aufbauphase der Universität, als 1734-37
hierauf den Grundmauern deralten Kloster-
gebäude das Kollegienhaus nach Plänen
von Universitätsbaumeister Schaedler und
an der Pauliner- und der Prinzenstraße Pro-
fessorenhäuser errichtet wurden. 1782-87
erfolgte eine Erweiterung des Komplexes
vom Chor nach Süden nach Plänen von
Schaedlers Nachfolger Borheck (vgl. Kurze
Geismar Straße 40); der gesamte Bereich
erlitt während des Zweiten Weltkrieges
beträchtliche Zerstörungen, die Wiederher-
stellung geschah erst nach 1953. Von der
Innengestaltung hat sich nichts erhalten,
dagegen stehen noch einige originale Por-
tale am Ost-und am Westflügel. Nachdem
1837 die Aula am Wilhelmsplatz erbaut wor-
den war, nutzte man die alten Universitäts-
räume nur noch als Bibliothek, die 1878-80
und 1903 durch die neuen Flügel bis an die
Prinzenstraße vergrößert wurde. Dieser Neu-
bebauung mit massiven Werksteingebäu-
den mit renaissancistischen Stilelementen
opferte man die alten Professorenhäuser.
Prinzenstraße/Gotmarstraße/Stumpfebiel/
Mühlenstraße
Die Universität „Georgia Augusta”, die erste
„moderne” Universität ohne Primat der
Theologischen Fakultät und ohne theolo-
gische Kontrolle, zog in die ländliche, eher
ärmliche Kleinstadt Göttingen Professoren,
Studenten und auch Handwerker, die Woh-
nungen brauchten. Die Regierung in Hanno-
ver baute auf eigene Kosten nur das Kolle-
gienhaus, einige Institutsgebäude (z. B. s. o.
Untere Karspüle, Botanischer Garten) und -
um adlige bzw. reiche Studenten nach Göt-
tingen zu holen - den verlorenen Reitstall an
Luftbild der Innenstadt, im Vordergrund ehemaliger Klosterbezirk, heute Universitätsbibliothek (Aufn. des NLVwA-Landesbildstelle. Freigeg. mit Nr. 11331
B am 03.12.1970 d. Bez.-Reg. Rheinld.-Pf., Außenstelle Mainz)
56