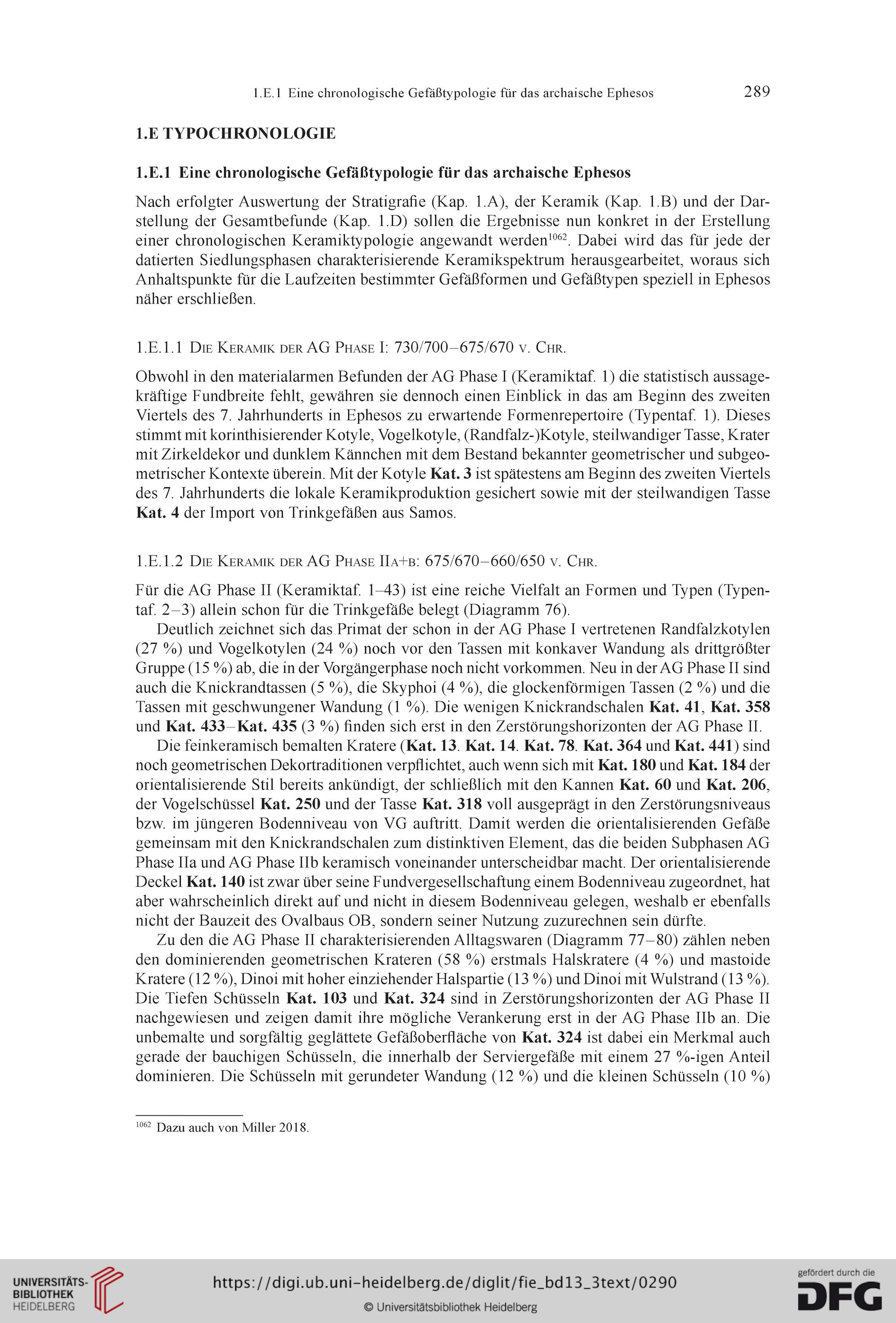l.E. 1 Eine chronologische Gefäßtypologie für das archaische Ephesos
289
l.E TYPOCHRONOLOGIE
1.E.1 Eine chronologische Gefäßtypologie für das archaische Ephesos
Nach erfolgter Auswertung der Stratigrafie (Kap. l.A), der Keramik (Kap. l.B) und der Dar-
stellung der Gesamtbefunde (Kap. l.D) sollen die Ergebnisse nun konkret in der Erstellung
einer chronologischen Keramiktypologie angewandt werden1062. Dabei wird das für jede der
datierten Siedlungsphasen charakterisierende Keramikspektrum herausgearbeitet, woraus sich
Anhaltspunkte für die Laufzeiten bestimmter Gefäßformen und Gefäßtypen speziell in Ephesos
näher erschließen.
LE. 1.1 Die Keramik der AG Phase I: 730/700-675/670 v. Chr.
Obwohl in den materialarmen Befunden der AG Phase I (Keramiktaf. 1) die statistisch aussage-
kräftige Fundbreite fehlt, gewähren sie dennoch einen Einblick in das am Beginn des zweiten
Viertels des 7. Jahrhunderts in Ephesos zu erwartende Formenrepertoire (Typentaf. 1). Dieses
stimmt mit korinthisierender Kotyle, Vogelkotyle, (Randfalz-)Kotyle, steilwandiger Tasse, Krater
mit Zirkeldekor und dunklem Kännchen mit dem Bestand bekannter geometrischer und subgeo-
metrischer Kontexte überein. Mit der Kotyle Kat. 3 ist spätestens am Beginn des zweiten Viertels
des 7. Jahrhunderts die lokale Keramikproduktion gesichert sowie mit der steilwandigen Tasse
Kat. 4 der Import von Trinkgefäßen aus Samos.
l.E. 1.2 Die Keramik der AG Phase IIa+b: 675/670-660/650 v. Chr.
Für die AG Phase II (Keramiktaf. 1-43) ist eine reiche Vielfalt an Formen und Typen (Typen-
taf. 2-3) allein schon für die Trinkgefäße belegt (Diagramm 76).
Deutlich zeichnet sich das Primat der schon in der AG Phase I vertretenen Randfalzkotylen
(27 %) und Vogelkotylen (24 %) noch vor den Tassen mit konkaver Wandung als drittgrößter
Gruppe (15 %) ab, die in der Vorgängerphase noch nicht vorkommen. Neu in der AG Phase II sind
auch die Knickrandtassen (5 %), die Skyphoi (4 %), die glockenförmigen Tassen (2 %) und die
Tassen mit geschwungener Wandung (1 %). Die wenigen Knickrandschalen Kat. 41, Kat. 358
und Kat. 433-Kat. 435 (3 %) finden sich erst in den Zerstörungshorizonten der AG Phase II.
Die feinkeramisch bemalten Kratere (Kat. 13. Kat. 14. Kat. 78. Kat. 364 und Kat. 441) sind
noch geometrischen Dekortraditionen verpflichtet, auch wenn sich mit Kat. 180 und Kat. 184 der
orientalisierende Stil bereits ankündigt, der schließlich mit den Kannen Kat. 60 und Kat. 206,
der Vögelschüssel Kat. 250 und der Tasse Kat. 318 voll ausgeprägt in den Zerstörungsniveaus
bzw. im jüngeren Bodenniveau von VG auftritt. Damit werden die orientalisierenden Gefäße
gemeinsam mit den Knickrandschalen zum distinktiven Element, das die beiden Subphasen AG
Phase Ila und AG Phase Ilb keramisch voneinander unterscheidbar macht. Der orientalisierende
Deckel Kat. 140 ist zwar über seine Fundvergesellschaftung einem Bodenniveau zugeordnet, hat
aber wahrscheinlich direkt auf und nicht in diesem Bodenniveau gelegen, weshalb er ebenfalls
nicht der Bauzeit des Ovalbaus OB, sondern seiner Nutzung zuzurechnen sein dürfte.
Zu den die AG Phase II charakterisierenden Alltagswaren (Diagramm 77-80) zählen neben
den dominierenden geometrischen Krateren (58 %) erstmals Halskratere (4 %) und mastoide
Kratere (12 %), Dinoi mit hoher einziehender Halspartie (13 %) und Dinoi mit Wulstrand (13 %).
Die Tiefen Schüsseln Kat. 103 und Kat. 324 sind in Zerstörungshorizonten der AG Phase II
nachgewiesen und zeigen damit ihre mögliche Verankerung erst in der AG Phase Ilb an. Die
unbemalte und sorgfältig geglättete Gefäßoberfläche von Kat. 324 ist dabei ein Merkmal auch
gerade der bauchigen Schüsseln, die innerhalb der Serviergefäße mit einem 27 %-igen Anteil
dominieren. Die Schüsseln mit gerundeter Wandung (12 %) und die kleinen Schüsseln (10 %)
1062 Dazu auch von Miller 2018.
289
l.E TYPOCHRONOLOGIE
1.E.1 Eine chronologische Gefäßtypologie für das archaische Ephesos
Nach erfolgter Auswertung der Stratigrafie (Kap. l.A), der Keramik (Kap. l.B) und der Dar-
stellung der Gesamtbefunde (Kap. l.D) sollen die Ergebnisse nun konkret in der Erstellung
einer chronologischen Keramiktypologie angewandt werden1062. Dabei wird das für jede der
datierten Siedlungsphasen charakterisierende Keramikspektrum herausgearbeitet, woraus sich
Anhaltspunkte für die Laufzeiten bestimmter Gefäßformen und Gefäßtypen speziell in Ephesos
näher erschließen.
LE. 1.1 Die Keramik der AG Phase I: 730/700-675/670 v. Chr.
Obwohl in den materialarmen Befunden der AG Phase I (Keramiktaf. 1) die statistisch aussage-
kräftige Fundbreite fehlt, gewähren sie dennoch einen Einblick in das am Beginn des zweiten
Viertels des 7. Jahrhunderts in Ephesos zu erwartende Formenrepertoire (Typentaf. 1). Dieses
stimmt mit korinthisierender Kotyle, Vogelkotyle, (Randfalz-)Kotyle, steilwandiger Tasse, Krater
mit Zirkeldekor und dunklem Kännchen mit dem Bestand bekannter geometrischer und subgeo-
metrischer Kontexte überein. Mit der Kotyle Kat. 3 ist spätestens am Beginn des zweiten Viertels
des 7. Jahrhunderts die lokale Keramikproduktion gesichert sowie mit der steilwandigen Tasse
Kat. 4 der Import von Trinkgefäßen aus Samos.
l.E. 1.2 Die Keramik der AG Phase IIa+b: 675/670-660/650 v. Chr.
Für die AG Phase II (Keramiktaf. 1-43) ist eine reiche Vielfalt an Formen und Typen (Typen-
taf. 2-3) allein schon für die Trinkgefäße belegt (Diagramm 76).
Deutlich zeichnet sich das Primat der schon in der AG Phase I vertretenen Randfalzkotylen
(27 %) und Vogelkotylen (24 %) noch vor den Tassen mit konkaver Wandung als drittgrößter
Gruppe (15 %) ab, die in der Vorgängerphase noch nicht vorkommen. Neu in der AG Phase II sind
auch die Knickrandtassen (5 %), die Skyphoi (4 %), die glockenförmigen Tassen (2 %) und die
Tassen mit geschwungener Wandung (1 %). Die wenigen Knickrandschalen Kat. 41, Kat. 358
und Kat. 433-Kat. 435 (3 %) finden sich erst in den Zerstörungshorizonten der AG Phase II.
Die feinkeramisch bemalten Kratere (Kat. 13. Kat. 14. Kat. 78. Kat. 364 und Kat. 441) sind
noch geometrischen Dekortraditionen verpflichtet, auch wenn sich mit Kat. 180 und Kat. 184 der
orientalisierende Stil bereits ankündigt, der schließlich mit den Kannen Kat. 60 und Kat. 206,
der Vögelschüssel Kat. 250 und der Tasse Kat. 318 voll ausgeprägt in den Zerstörungsniveaus
bzw. im jüngeren Bodenniveau von VG auftritt. Damit werden die orientalisierenden Gefäße
gemeinsam mit den Knickrandschalen zum distinktiven Element, das die beiden Subphasen AG
Phase Ila und AG Phase Ilb keramisch voneinander unterscheidbar macht. Der orientalisierende
Deckel Kat. 140 ist zwar über seine Fundvergesellschaftung einem Bodenniveau zugeordnet, hat
aber wahrscheinlich direkt auf und nicht in diesem Bodenniveau gelegen, weshalb er ebenfalls
nicht der Bauzeit des Ovalbaus OB, sondern seiner Nutzung zuzurechnen sein dürfte.
Zu den die AG Phase II charakterisierenden Alltagswaren (Diagramm 77-80) zählen neben
den dominierenden geometrischen Krateren (58 %) erstmals Halskratere (4 %) und mastoide
Kratere (12 %), Dinoi mit hoher einziehender Halspartie (13 %) und Dinoi mit Wulstrand (13 %).
Die Tiefen Schüsseln Kat. 103 und Kat. 324 sind in Zerstörungshorizonten der AG Phase II
nachgewiesen und zeigen damit ihre mögliche Verankerung erst in der AG Phase Ilb an. Die
unbemalte und sorgfältig geglättete Gefäßoberfläche von Kat. 324 ist dabei ein Merkmal auch
gerade der bauchigen Schüsseln, die innerhalb der Serviergefäße mit einem 27 %-igen Anteil
dominieren. Die Schüsseln mit gerundeter Wandung (12 %) und die kleinen Schüsseln (10 %)
1062 Dazu auch von Miller 2018.