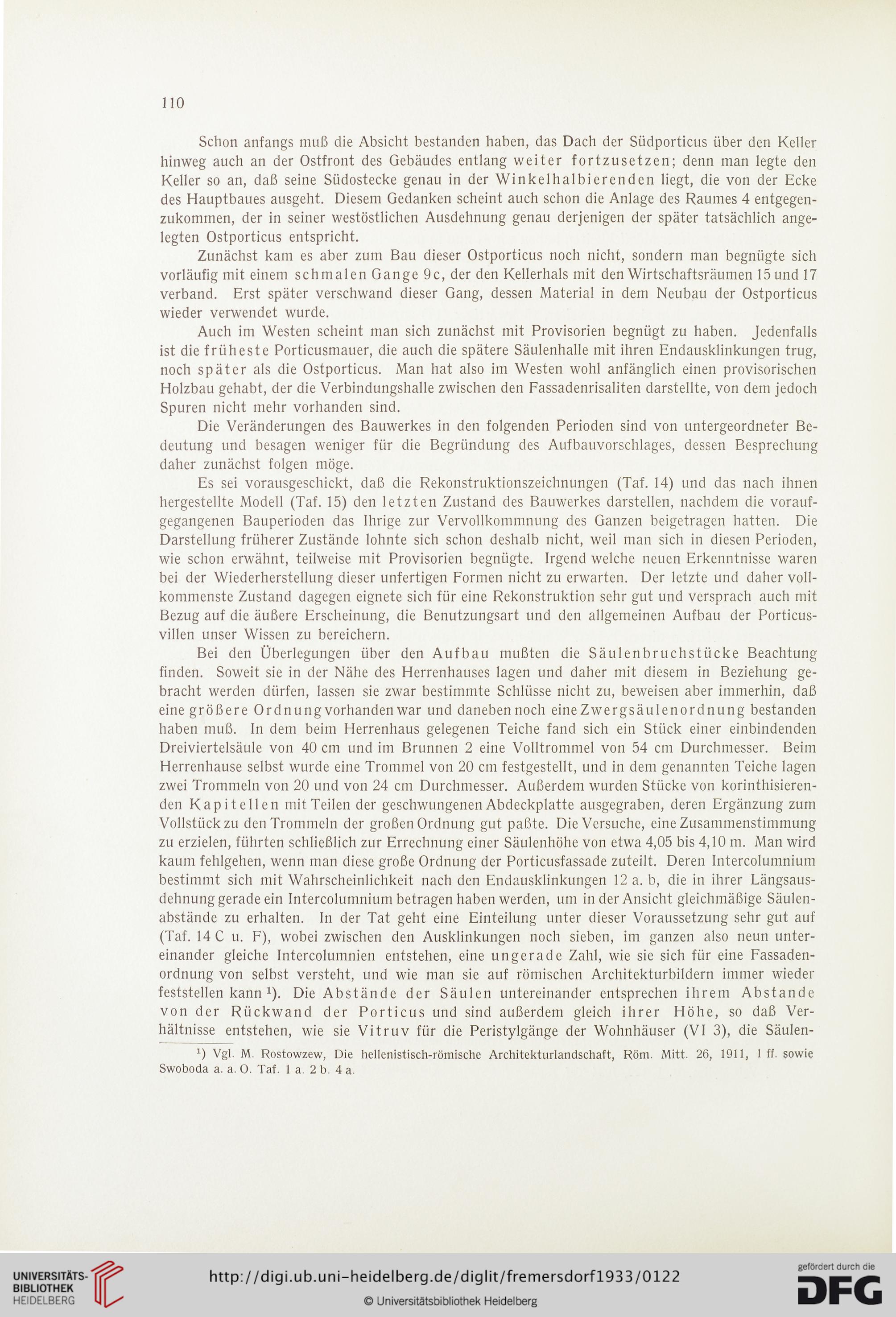110
Schon anfangs muß die Absicht bestanden haben, das Dach der Südporticus über den Keller
hinweg auch an der Ostfront des Gebäudes entlang weiter fortzusetzen; denn man legte den
Keller so an, daß seine Südostecke genau in der Winkelhalbierenden liegt, die von der Ecke
des Hauptbaues ausgeht. Diesem Gedanken scheint auch schon die Anlage des Raumes 4 entgegen-
zukommen, der in seiner westöstlichen Ausdehnung genau derjenigen der später tatsächlich ange-
legten Ostporticus entspricht.
Zunächst kam es aber zum Bau dieser Ostporticus noch nicht, sondern man begnügte sich
vorläufig mit einem schmalen Gange 9c, der den Kellerhals mit den Wirtschaftsräumen 15 und 17
verband. Erst später verschwand dieser Gang, dessen Material in dem Neubau der Ostporticus
wieder verwendet wurde.
Auch im Westen scheint man sich zunächst mit Provisorien begnügt zu haben. Jedenfalls
ist die früheste Porticusmauer, die auch die spätere Säulenhalle mit ihren Endausklinkungen trug,
noch später als die Ostporticus. Man hat also im Westen wohl anfänglich einen provisorischen
Holzbau gehabt, der die Verbindungshalle zwischen den Fassadenrisaliten darstellte, von dem jedoch
Spuren nicht mehr vorhanden sind.
Die Veränderungen des Bauwerkes in den folgenden Perioden sind von untergeordneter Be-
deutung und besagen weniger für die Begründung des Aufbauvorschlages, dessen Besprechung
daher zunächst folgen möge.
Es sei vorausgeschickt, daß die Rekonstruktionszeichnungen (Taf. 14) und das nach ihnen
hergestellte Modell (Taf. 15) den letzten Zustand des Bauwerkes darstellen, nachdem die vorauf-
gegangenen Bauperioden das Ihrige zur Vervollkommnung des Ganzen beigetragen hatten. Die
Darstellung früherer Zustände lohnte sich schon deshalb nicht, weil man sich in diesen Perioden,
wie schon erwähnt, teilweise mit Provisorien begnügte. Irgend welche neuen Erkenntnisse waren
bei der Wiederherstellung dieser unfertigen Formen nicht zu erwarten. Der letzte und daher voll-
kommenste Zustand dagegen eignete sich für eine Rekonstruktion sehr gut und versprach auch mit
Bezug auf die äußere Erscheinung, die Benutzungsart und den allgemeinen Aufbau der Porticus-
villen unser Wissen zu bereichern.
Bei den Überlegungen über den Aufbau mußten die Säulenbruchstücke Beachtung
finden. Soweit sie in der Nähe des Herrenhauses lagen und daher mit diesem in Beziehung ge-
bracht werden dürfen, lassen sie zwar bestimmte Schlüsse nicht zu, beweisen aber immerhin, daß
eine größere Ordnung vorhanden war und danebennoch eine Zwergsäulenordnung bestanden
haben muß. In dem beim Herrenhaus gelegenen Teiche fand sich ein Stück einer einbindenden
Dreiviertelsäule von 40 cm und im Brunnen 2 eine Volltrommel von 54 cm Durchmesser. Beim
Herrenhause selbst wurde eine Trommel von 20 cm festgestellt, und in dem genannten Teiche lagen
zwei Trommeln von 20 und von 24 cm Durchmesser. Außerdem wurden Stücke von korinthisieren-
den Kapitellen mit Teilen der geschwungenen Abdeckplatte ausgegraben, deren Ergänzung zum
Vollstückzu den Trommeln der großen Ordnung gut paßte. Die Versuche, eine Zusammenstimmung
zu erzielen, führten schließlich zur Errechnung einer Säulenhöhe von etwa 4,05 bis 4,10 m. Man wird
kaum fehlgehen, wenn man diese große Ordnung der Porticusfassade zuteilt. Deren Intercolumnium
bestimmt sich mit Wahrscheinlichkeit nach den Endausklinkungen 12 a. b, die in ihrer Längsaus-
dehnunggeradeein Intercolumnium betragen haben werden, um in der Ansicht gleichmäßige Säulen-
abstände zu erhalten. In der Tat geht eine Einteilung unter dieser Voraussetzung sehr gut auf
(Taf. 14 C u. F), wobei zwischen den Ausklinkungen noch sieben, im ganzen also neun unter-
einander gleiche Intercolumnien entstehen, eine ungerade Zahl, wie sie sich für eine Fassaden-
ordnung von selbst versteht, und wie man sie auf römischen Architekturbildern immer wieder
feststellen kann x). Die Abstände der Säulen untereinander entsprechen ihrem Abstande
von der Rückwand der Porticus und sind außerdem gleich ihrer Höhe, so daß Ver-
hältnisse entstehen, wie sie Vitruv für die Peristylgänge der Wohnhäuser (VI 3), die Säulen-
x) Vgl. M. Rostowzew, Die hellenistisch-römische Architekturlandschaft, Röm. Mitt. 26, 1911, 1 ff. sowie
Swoboda a. a. 0. Taf. 1 a. 2 b. 4 a.
Schon anfangs muß die Absicht bestanden haben, das Dach der Südporticus über den Keller
hinweg auch an der Ostfront des Gebäudes entlang weiter fortzusetzen; denn man legte den
Keller so an, daß seine Südostecke genau in der Winkelhalbierenden liegt, die von der Ecke
des Hauptbaues ausgeht. Diesem Gedanken scheint auch schon die Anlage des Raumes 4 entgegen-
zukommen, der in seiner westöstlichen Ausdehnung genau derjenigen der später tatsächlich ange-
legten Ostporticus entspricht.
Zunächst kam es aber zum Bau dieser Ostporticus noch nicht, sondern man begnügte sich
vorläufig mit einem schmalen Gange 9c, der den Kellerhals mit den Wirtschaftsräumen 15 und 17
verband. Erst später verschwand dieser Gang, dessen Material in dem Neubau der Ostporticus
wieder verwendet wurde.
Auch im Westen scheint man sich zunächst mit Provisorien begnügt zu haben. Jedenfalls
ist die früheste Porticusmauer, die auch die spätere Säulenhalle mit ihren Endausklinkungen trug,
noch später als die Ostporticus. Man hat also im Westen wohl anfänglich einen provisorischen
Holzbau gehabt, der die Verbindungshalle zwischen den Fassadenrisaliten darstellte, von dem jedoch
Spuren nicht mehr vorhanden sind.
Die Veränderungen des Bauwerkes in den folgenden Perioden sind von untergeordneter Be-
deutung und besagen weniger für die Begründung des Aufbauvorschlages, dessen Besprechung
daher zunächst folgen möge.
Es sei vorausgeschickt, daß die Rekonstruktionszeichnungen (Taf. 14) und das nach ihnen
hergestellte Modell (Taf. 15) den letzten Zustand des Bauwerkes darstellen, nachdem die vorauf-
gegangenen Bauperioden das Ihrige zur Vervollkommnung des Ganzen beigetragen hatten. Die
Darstellung früherer Zustände lohnte sich schon deshalb nicht, weil man sich in diesen Perioden,
wie schon erwähnt, teilweise mit Provisorien begnügte. Irgend welche neuen Erkenntnisse waren
bei der Wiederherstellung dieser unfertigen Formen nicht zu erwarten. Der letzte und daher voll-
kommenste Zustand dagegen eignete sich für eine Rekonstruktion sehr gut und versprach auch mit
Bezug auf die äußere Erscheinung, die Benutzungsart und den allgemeinen Aufbau der Porticus-
villen unser Wissen zu bereichern.
Bei den Überlegungen über den Aufbau mußten die Säulenbruchstücke Beachtung
finden. Soweit sie in der Nähe des Herrenhauses lagen und daher mit diesem in Beziehung ge-
bracht werden dürfen, lassen sie zwar bestimmte Schlüsse nicht zu, beweisen aber immerhin, daß
eine größere Ordnung vorhanden war und danebennoch eine Zwergsäulenordnung bestanden
haben muß. In dem beim Herrenhaus gelegenen Teiche fand sich ein Stück einer einbindenden
Dreiviertelsäule von 40 cm und im Brunnen 2 eine Volltrommel von 54 cm Durchmesser. Beim
Herrenhause selbst wurde eine Trommel von 20 cm festgestellt, und in dem genannten Teiche lagen
zwei Trommeln von 20 und von 24 cm Durchmesser. Außerdem wurden Stücke von korinthisieren-
den Kapitellen mit Teilen der geschwungenen Abdeckplatte ausgegraben, deren Ergänzung zum
Vollstückzu den Trommeln der großen Ordnung gut paßte. Die Versuche, eine Zusammenstimmung
zu erzielen, führten schließlich zur Errechnung einer Säulenhöhe von etwa 4,05 bis 4,10 m. Man wird
kaum fehlgehen, wenn man diese große Ordnung der Porticusfassade zuteilt. Deren Intercolumnium
bestimmt sich mit Wahrscheinlichkeit nach den Endausklinkungen 12 a. b, die in ihrer Längsaus-
dehnunggeradeein Intercolumnium betragen haben werden, um in der Ansicht gleichmäßige Säulen-
abstände zu erhalten. In der Tat geht eine Einteilung unter dieser Voraussetzung sehr gut auf
(Taf. 14 C u. F), wobei zwischen den Ausklinkungen noch sieben, im ganzen also neun unter-
einander gleiche Intercolumnien entstehen, eine ungerade Zahl, wie sie sich für eine Fassaden-
ordnung von selbst versteht, und wie man sie auf römischen Architekturbildern immer wieder
feststellen kann x). Die Abstände der Säulen untereinander entsprechen ihrem Abstande
von der Rückwand der Porticus und sind außerdem gleich ihrer Höhe, so daß Ver-
hältnisse entstehen, wie sie Vitruv für die Peristylgänge der Wohnhäuser (VI 3), die Säulen-
x) Vgl. M. Rostowzew, Die hellenistisch-römische Architekturlandschaft, Röm. Mitt. 26, 1911, 1 ff. sowie
Swoboda a. a. 0. Taf. 1 a. 2 b. 4 a.