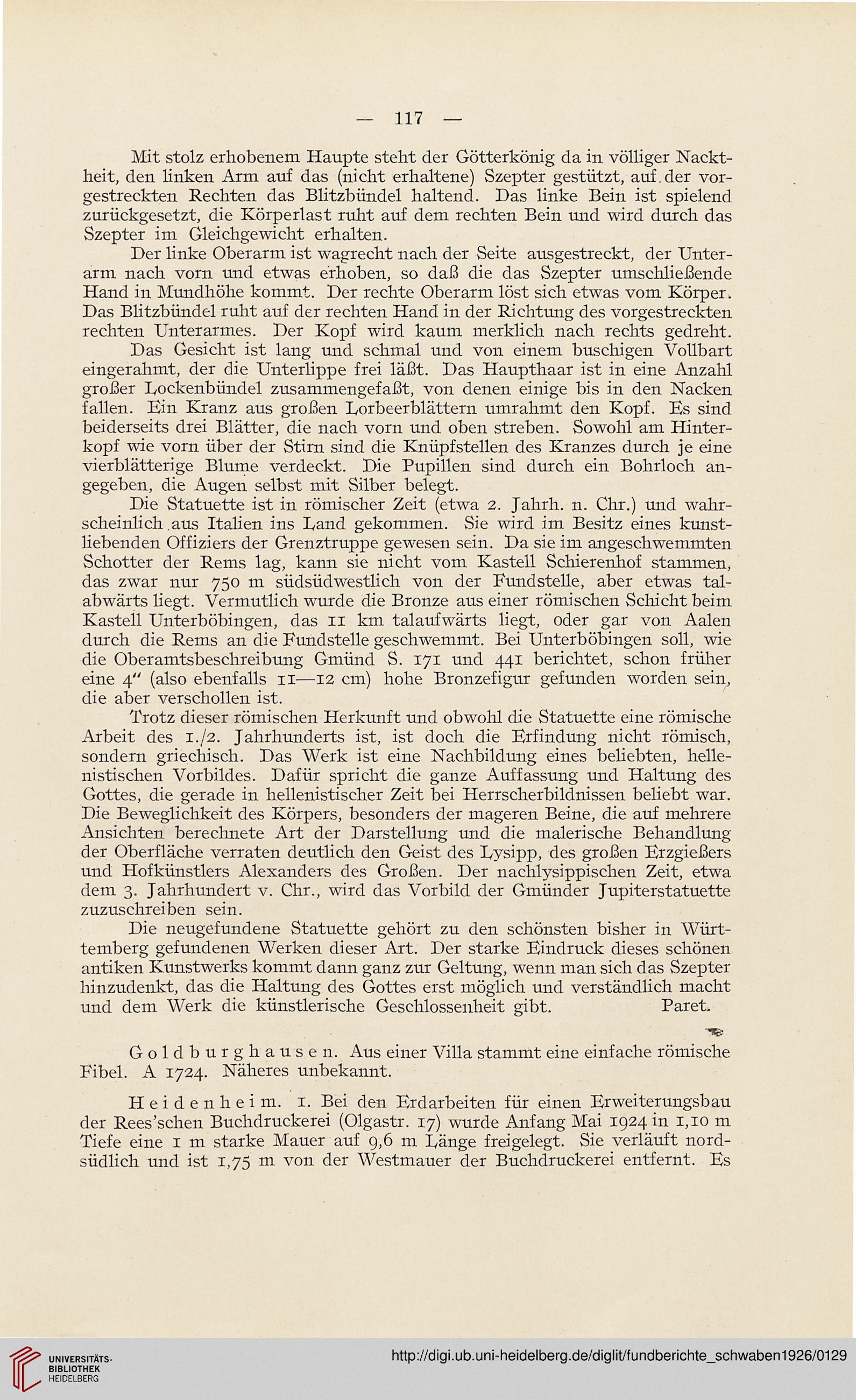117
Mit stolz erhobenem Haupte steht der Götterkönig da in völliger Nackt-
heit, den linken Arm auf das (nicht erhaltene) Szepter gestützt, auf.der vor-
gestreckten Rechten das Blitzbündel haltend. Das linke Bein ist spielend
zurückgesetzt, die Körperlast ruht auf dem rechten Bein und wird durch das
Szepter im Gleichgewicht erhalten.
Der linke Oberarm ist wagrecht nach der Seite ausgestreckt, der Unter-
arm nach vorn und etwas erhoben, so daß die das Szepter umschließende
Hand in Mundhöhe kommt. Der rechte Oberarm löst sich etwas vom Körper.
Das Blitzbündel ruht auf der rechten Hand in der Richtung des vorgestreckten
rechten Unterarmes. Der Kopf wird kaum merklich nach rechts gedreht.
Das Gesicht ist lang und schmal und von einem buschigen Vollbart
eingerahmt, der die Unterlippe frei läßt. Das Haupthaar ist in eine Anzahl
großer Lockenbündel zusammengefaßt, von denen einige bis in den Nacken
fallen. Ein Kranz aus großen Lorbeerblättern umrahmt den Kopf. Es sind
beiderseits drei Blätter, die nach vorn und oben streben. Sowohl am Hinter-
kopf wie vorn über der Stirn sind die Knüpfstellen des Kranzes durch je eine
vierblätterige Blume verdeckt. Die Pupillen sind durch ein Bohrloch an-
gegeben, die Augen selbst mit Silber belegt.
Die Statuette ist in römischer Zeit (etwa 2. Jahrh. n. Chr.) und wahr-
scheinlich .aus Italien ins Land gekommen. Sie wird im Besitz eines kunst-
liebenden Offiziers der Grenztruppe gewesen sein. Da sie im angeschwemmten
Schotter der Rems lag, kann sie nicht vom Kastell Schierenhof stammen,
das zwar nur 750 m südsüdwestlich von der Fundstelle, aber etwas tal-
abwärts liegt. Vermutlich wurde die Bronze aus einer römischen Schicht beim
Kastell Unterböbingen, das 11 km talaufwärts liegt, oder gar von Aalen
durch die Rems an die Fundstelle geschwemmt. Bei Unterböbingen soll, wie
die Oberamtsbeschreibung Gmünd S. 171 und 441 berichtet, schon früher
eine 4“ (also ebenfalls II-—12 cm) hohe Bronzefigur gefunden worden sein,
die aber verschollen ist.
Trotz dieser römischen Herkunft und obwohl die Statuette eine römische
Arbeit des 1./2. Jahrhunderts ist, ist doch die Erfindung nicht römisch,
sondern griechisch. Das Werk ist eine Nachbildung eines beliebten, helle-
nistischen Vorbildes. Dafür spricht die ganze Auffassung und Haltung des
Gottes, die gerade in hellenistischer Zeit bei Herrscherbildnissen beliebt war.
Die Beweglichkeit des Körpers, besonders der mageren Beine, die auf mehrere
Ansichten berechnete Art der Darstellung und die malerische Behandlung
der Oberfläche verraten deutlich den Geist des Lysipp, des großen Erzgießers
und Hofkünstlers Alexanders des Großen. Der nachlysippischen Zeit, etwa
dem 3. Jahrhundert v. Chr., wird das Vorbild der Gmünder Jupiterstatuette
zuzuschreiben sein.
Die neugefundene Statuette gehört zu den schönsten bisher in Würt-
temberg gefundenen Werken dieser Art. Der starke Eindruck dieses schönen
antiken Kunstwerks kommt dann ganz zur Geltung, wenn man sich das Szepter
hinzudenkt, das die Haltung des Gottes erst möglich und verständlich macht
und dem Werk die künstlerische Geschlossenheit gibt. Paret.
Goldburghausen. Aus einer Villa stammt eine einfache römische
Fibel. A 1724. Näheres unbekannt.
Heidenheim. 1. Bei den Erdarbeiten für einen Erweiterungsbau
der Rees’schen Buchdruckerei (Olgastr. 17) wurde Anfang Mai 1924 in 1,10 m
Tiefe eine 1 m starke Mauer auf 9,6 m Länge freigelegt. Sie verläuft nord-
südlich und ist 1,75 m von der Westmauer der Buchdruckerei entfernt. Es
Mit stolz erhobenem Haupte steht der Götterkönig da in völliger Nackt-
heit, den linken Arm auf das (nicht erhaltene) Szepter gestützt, auf.der vor-
gestreckten Rechten das Blitzbündel haltend. Das linke Bein ist spielend
zurückgesetzt, die Körperlast ruht auf dem rechten Bein und wird durch das
Szepter im Gleichgewicht erhalten.
Der linke Oberarm ist wagrecht nach der Seite ausgestreckt, der Unter-
arm nach vorn und etwas erhoben, so daß die das Szepter umschließende
Hand in Mundhöhe kommt. Der rechte Oberarm löst sich etwas vom Körper.
Das Blitzbündel ruht auf der rechten Hand in der Richtung des vorgestreckten
rechten Unterarmes. Der Kopf wird kaum merklich nach rechts gedreht.
Das Gesicht ist lang und schmal und von einem buschigen Vollbart
eingerahmt, der die Unterlippe frei läßt. Das Haupthaar ist in eine Anzahl
großer Lockenbündel zusammengefaßt, von denen einige bis in den Nacken
fallen. Ein Kranz aus großen Lorbeerblättern umrahmt den Kopf. Es sind
beiderseits drei Blätter, die nach vorn und oben streben. Sowohl am Hinter-
kopf wie vorn über der Stirn sind die Knüpfstellen des Kranzes durch je eine
vierblätterige Blume verdeckt. Die Pupillen sind durch ein Bohrloch an-
gegeben, die Augen selbst mit Silber belegt.
Die Statuette ist in römischer Zeit (etwa 2. Jahrh. n. Chr.) und wahr-
scheinlich .aus Italien ins Land gekommen. Sie wird im Besitz eines kunst-
liebenden Offiziers der Grenztruppe gewesen sein. Da sie im angeschwemmten
Schotter der Rems lag, kann sie nicht vom Kastell Schierenhof stammen,
das zwar nur 750 m südsüdwestlich von der Fundstelle, aber etwas tal-
abwärts liegt. Vermutlich wurde die Bronze aus einer römischen Schicht beim
Kastell Unterböbingen, das 11 km talaufwärts liegt, oder gar von Aalen
durch die Rems an die Fundstelle geschwemmt. Bei Unterböbingen soll, wie
die Oberamtsbeschreibung Gmünd S. 171 und 441 berichtet, schon früher
eine 4“ (also ebenfalls II-—12 cm) hohe Bronzefigur gefunden worden sein,
die aber verschollen ist.
Trotz dieser römischen Herkunft und obwohl die Statuette eine römische
Arbeit des 1./2. Jahrhunderts ist, ist doch die Erfindung nicht römisch,
sondern griechisch. Das Werk ist eine Nachbildung eines beliebten, helle-
nistischen Vorbildes. Dafür spricht die ganze Auffassung und Haltung des
Gottes, die gerade in hellenistischer Zeit bei Herrscherbildnissen beliebt war.
Die Beweglichkeit des Körpers, besonders der mageren Beine, die auf mehrere
Ansichten berechnete Art der Darstellung und die malerische Behandlung
der Oberfläche verraten deutlich den Geist des Lysipp, des großen Erzgießers
und Hofkünstlers Alexanders des Großen. Der nachlysippischen Zeit, etwa
dem 3. Jahrhundert v. Chr., wird das Vorbild der Gmünder Jupiterstatuette
zuzuschreiben sein.
Die neugefundene Statuette gehört zu den schönsten bisher in Würt-
temberg gefundenen Werken dieser Art. Der starke Eindruck dieses schönen
antiken Kunstwerks kommt dann ganz zur Geltung, wenn man sich das Szepter
hinzudenkt, das die Haltung des Gottes erst möglich und verständlich macht
und dem Werk die künstlerische Geschlossenheit gibt. Paret.
Goldburghausen. Aus einer Villa stammt eine einfache römische
Fibel. A 1724. Näheres unbekannt.
Heidenheim. 1. Bei den Erdarbeiten für einen Erweiterungsbau
der Rees’schen Buchdruckerei (Olgastr. 17) wurde Anfang Mai 1924 in 1,10 m
Tiefe eine 1 m starke Mauer auf 9,6 m Länge freigelegt. Sie verläuft nord-
südlich und ist 1,75 m von der Westmauer der Buchdruckerei entfernt. Es