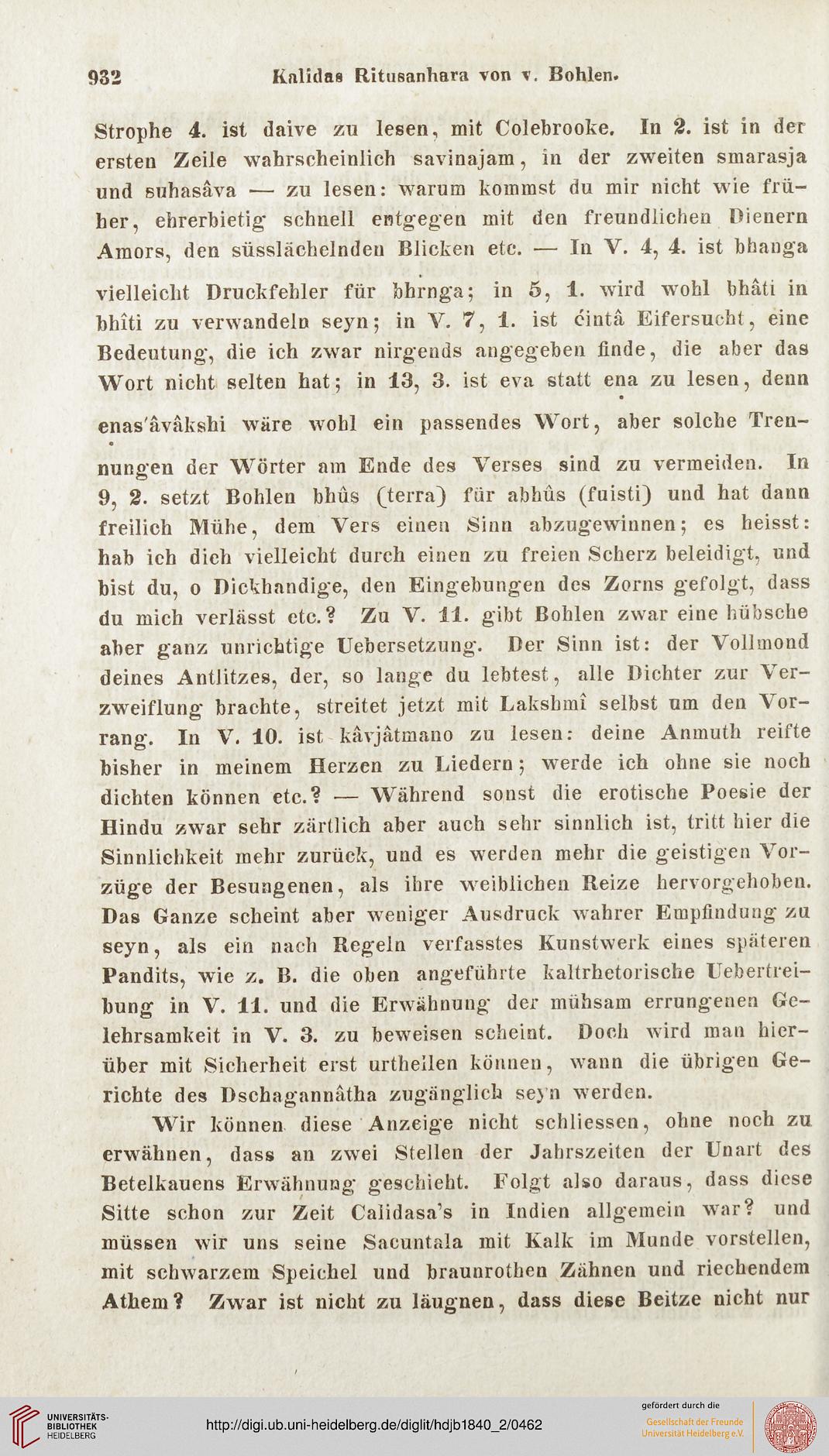932
Kfilhlas Ritusanhara von v. Bohlen.
Strophe 4. ist daive zu lesen, mit Colebrooke. In 2. ist in der
ersten Zeile wahrscheinlich savinajam, in der zweiten smarasja
und Buhasava •— zu lesen: warum kommst du mir nicht wie frü-
her, ehrerbietig- schnell entgegen mit den freundlichen Dienern
Amors, den süsslächelnden Blicken etc. — In V. 4, 4. ist bhanga
vielleicht Druckfehler für bhrnga; in 5, 1. wird wohl bhäti in
bhiti zu verwandeln seyn; in V. 7, 1. ist cintä Eifersucht, eine
Bedeutung, die ich zwar nirgends angegeben finde, die aber das
Wort nicht selten hat; in 13, 3. ist eva statt ena zu lesen, denn
enas'äväkshi wäre wohl ein passendes Wort, aber solche Tren-
nungen der Wörter am Ende des Verses sind zu vermeiden. In
9, 2. setzt Bohlen bhüs (terra) für abhüs (fuisti) und hat dann
freilich Mühe, dem Vers einen Sinn abzugewinnen; es heisst:
hab ich dich vielleicht durch einen zu freien Scherz beleidigt, und
bist du, o Dickhandige, den Eingebungen des Zorns gefolgt, dass
du mich verlässt etc.? Zu V. 11. gibt Bohlen zwar eine hübsche
aber ganz unrichtige Uebersetzung. Der Sinn ist: der Vollmond
deines Antlitzes, der, so lange du lebtest, alle Dichter zur Ver-
zweiflung brachte, streitet jetzt mit Lakshmi selbst um den Vor-
rang. In V. 10. ist kävjätmano zu lesen: deine Anmuth reifte
bisher in meinem Herzen zu Liedern; werde ich ohne sie noch
dichten können etc.? — Während sonst die erotische Poesie der
Hindu zwar sehr zärtlich aber auch sehr sinnlich ist, tritt hier die
Sinnlichkeit mehr zurück, und es werden mehr die geistigen Vor-
züge der Besungenen, als ihre weiblichen Reize hervorgehoben.
Das Ganze scheint aber weniger Ausdruck wahrer Empfindung zu
seyn, als ein nach Regeln verfasstes Kunstwerk eines späteren
Pandits, wie z. B. die oben angeführte kaltrhetorische Ilebertrei-
bung in V. 11. und die Erwähnung der mühsam errungenen Ge-
lehrsamkeit in V. 3. zu beweisen scheint. Doch wird man hier-
über mit Sicherheit erst urtheilen können, wann die übrigen Ge-
richte des Dschagannätha zugänglich seyn werden.
W ir können diese Anzeige nicht schliessen, ohne noch zu
erwähnen, dass an zwei Stellen der Jahrszeiten der Unart des
Betelkauens Erwähnung geschieht. Folgt also daraus, dass diese
Sitte schon zur Zeit Calidasa’s in Indien allgemein war? und
müssen wir uns seine Sacuntala mit Kalk im Munde vorstellen,
mit schwarzem Speichel und braunrothen Zähnen und riechendem
Athern ? Zwar ist nicht zu läugnen, dass diese Beitze nicht nur
Kfilhlas Ritusanhara von v. Bohlen.
Strophe 4. ist daive zu lesen, mit Colebrooke. In 2. ist in der
ersten Zeile wahrscheinlich savinajam, in der zweiten smarasja
und Buhasava •— zu lesen: warum kommst du mir nicht wie frü-
her, ehrerbietig- schnell entgegen mit den freundlichen Dienern
Amors, den süsslächelnden Blicken etc. — In V. 4, 4. ist bhanga
vielleicht Druckfehler für bhrnga; in 5, 1. wird wohl bhäti in
bhiti zu verwandeln seyn; in V. 7, 1. ist cintä Eifersucht, eine
Bedeutung, die ich zwar nirgends angegeben finde, die aber das
Wort nicht selten hat; in 13, 3. ist eva statt ena zu lesen, denn
enas'äväkshi wäre wohl ein passendes Wort, aber solche Tren-
nungen der Wörter am Ende des Verses sind zu vermeiden. In
9, 2. setzt Bohlen bhüs (terra) für abhüs (fuisti) und hat dann
freilich Mühe, dem Vers einen Sinn abzugewinnen; es heisst:
hab ich dich vielleicht durch einen zu freien Scherz beleidigt, und
bist du, o Dickhandige, den Eingebungen des Zorns gefolgt, dass
du mich verlässt etc.? Zu V. 11. gibt Bohlen zwar eine hübsche
aber ganz unrichtige Uebersetzung. Der Sinn ist: der Vollmond
deines Antlitzes, der, so lange du lebtest, alle Dichter zur Ver-
zweiflung brachte, streitet jetzt mit Lakshmi selbst um den Vor-
rang. In V. 10. ist kävjätmano zu lesen: deine Anmuth reifte
bisher in meinem Herzen zu Liedern; werde ich ohne sie noch
dichten können etc.? — Während sonst die erotische Poesie der
Hindu zwar sehr zärtlich aber auch sehr sinnlich ist, tritt hier die
Sinnlichkeit mehr zurück, und es werden mehr die geistigen Vor-
züge der Besungenen, als ihre weiblichen Reize hervorgehoben.
Das Ganze scheint aber weniger Ausdruck wahrer Empfindung zu
seyn, als ein nach Regeln verfasstes Kunstwerk eines späteren
Pandits, wie z. B. die oben angeführte kaltrhetorische Ilebertrei-
bung in V. 11. und die Erwähnung der mühsam errungenen Ge-
lehrsamkeit in V. 3. zu beweisen scheint. Doch wird man hier-
über mit Sicherheit erst urtheilen können, wann die übrigen Ge-
richte des Dschagannätha zugänglich seyn werden.
W ir können diese Anzeige nicht schliessen, ohne noch zu
erwähnen, dass an zwei Stellen der Jahrszeiten der Unart des
Betelkauens Erwähnung geschieht. Folgt also daraus, dass diese
Sitte schon zur Zeit Calidasa’s in Indien allgemein war? und
müssen wir uns seine Sacuntala mit Kalk im Munde vorstellen,
mit schwarzem Speichel und braunrothen Zähnen und riechendem
Athern ? Zwar ist nicht zu läugnen, dass diese Beitze nicht nur