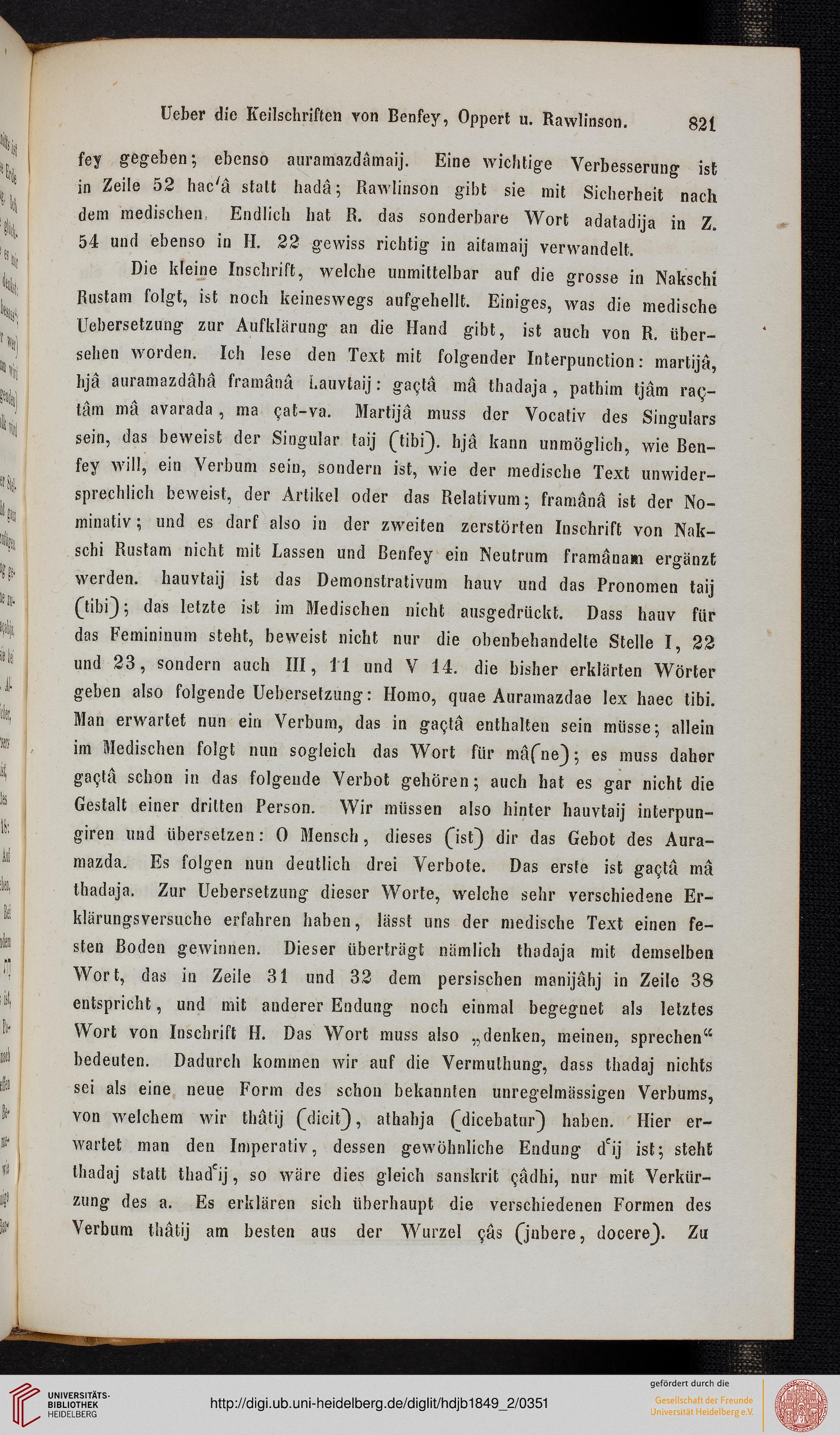Ueber die Keilschriften von Benfey, Oppert u. Rawlinson. 821
fey gegeben; ebenso auramazdämaij. Eine wichtige Verbesserung ist
in Zeile 52 hac'ä statt hadä; Rawlinson gibt sie mit Sicherheit nach
dem medischeiL Endlich hat R. das sonderbare Wort adatadija in Z.
54 und ebenso in II. 22 gewiss richtig in aitamaij verwandelt.
Die kleine Inschrift, welche unmittelbar auf die grosse in Nakschi
Rustam folgt, ist noch keineswegs aufgehellt. Einiges, was die medische
Uebersetzung zur Aufklärung an die Hand gibt, ist auch von R. über-
sehen worden. Ich lese den Text mit folgender Interpunction: martijä,
hjä auramazdähä framänä hauvtaij: ga<?tä mä thadaja , pathim tjäm raQ-
täm mä avarada, ma £at-va. Martijä muss der Vocativ des Singulars
sein, das beweist der Singular taij (tibi). hjä kann unmöglich, wie Ben-
fey will, ein Verbum sein, sondern ist, wie der medische Text unwider-
sprechlich beweist, der Artikel oder das Relativum; framänä ist der No-
minativ ; und es darf also in der zweiten zerstörten Inschrift von Nak-
schi Rustam nicht mit Lassen und Benfey ein Neutrum framänam ergänzt
werden, hauvtaij ist das Demonstrativum hauv und das Pronomen taij
(tibi); das letzte ist im Medischen nicht ausgedrückt. Dass hauv für
das Femininum steht, beweist nicht nur die obenbehandelte Stelle I, 22
und 23, sondern auch III, 11 und V 14. die bisher erklärten Wörter
geben also folgende Uebersetzung: Homo, quae Auramazdae lex haec tibi.
Man erwartet nun ein Verbum, das in ga<?tä enthalten sein müsse; allein
im Medischen folgt nun sogleich das Wort für mäfne); es muss daher
ga<jtä schon in das folgende Verbot gehören; auch hat es gar nicht die
Gestalt einer dritten Person. Wir müssen also hinter hauvtaij interpun-
giren und übersetzen: 0 Mensch, dieses (ist) dir das Gebot des Aura-
mazda. Es folgen nun deutlich drei Verbote. Das erste ist gagtä mä
thadaja. Zur Uebersetzung dieser Worte, welche sehr verschiedene Er-
klärungsversuche erfahren haben, lässt uns der medische Text einen fe-
sten Boden gewinnen. Dieser überträgt nämlich thadaja mit demselben
Wort, das in Zeile 31 und 32 dem persischen manijähj in Zeile 38
entspricht, und mit anderer Endung noch einmal begegnet als letztes
Wort von Inschrift H. Das Wort muss also „denken, meinen, sprechen“
bedeuten. Dadurch kommen wir auf die Vermuthung, dass thadaj nichts
sei als eine neue Form des schon bekannten unregelmässigen Verbums,
von welchem wir thätij (dicit), athabja (dicebatur) haben. Hier er-
wartet man den Imperativ, dessen gewöhnliche Endung dcij ist; steht
thadaj statt IhacTij, so wäre dies gleich sanskrit (jädhi, nur mit Verkür-
zung des a. Es erklären sich überhaupt die verschiedenen Formen des
Verbum thätij am besten aus der Wurzel <jäs (jnbere, docere). Zu
fey gegeben; ebenso auramazdämaij. Eine wichtige Verbesserung ist
in Zeile 52 hac'ä statt hadä; Rawlinson gibt sie mit Sicherheit nach
dem medischeiL Endlich hat R. das sonderbare Wort adatadija in Z.
54 und ebenso in II. 22 gewiss richtig in aitamaij verwandelt.
Die kleine Inschrift, welche unmittelbar auf die grosse in Nakschi
Rustam folgt, ist noch keineswegs aufgehellt. Einiges, was die medische
Uebersetzung zur Aufklärung an die Hand gibt, ist auch von R. über-
sehen worden. Ich lese den Text mit folgender Interpunction: martijä,
hjä auramazdähä framänä hauvtaij: ga<?tä mä thadaja , pathim tjäm raQ-
täm mä avarada, ma £at-va. Martijä muss der Vocativ des Singulars
sein, das beweist der Singular taij (tibi). hjä kann unmöglich, wie Ben-
fey will, ein Verbum sein, sondern ist, wie der medische Text unwider-
sprechlich beweist, der Artikel oder das Relativum; framänä ist der No-
minativ ; und es darf also in der zweiten zerstörten Inschrift von Nak-
schi Rustam nicht mit Lassen und Benfey ein Neutrum framänam ergänzt
werden, hauvtaij ist das Demonstrativum hauv und das Pronomen taij
(tibi); das letzte ist im Medischen nicht ausgedrückt. Dass hauv für
das Femininum steht, beweist nicht nur die obenbehandelte Stelle I, 22
und 23, sondern auch III, 11 und V 14. die bisher erklärten Wörter
geben also folgende Uebersetzung: Homo, quae Auramazdae lex haec tibi.
Man erwartet nun ein Verbum, das in ga<?tä enthalten sein müsse; allein
im Medischen folgt nun sogleich das Wort für mäfne); es muss daher
ga<jtä schon in das folgende Verbot gehören; auch hat es gar nicht die
Gestalt einer dritten Person. Wir müssen also hinter hauvtaij interpun-
giren und übersetzen: 0 Mensch, dieses (ist) dir das Gebot des Aura-
mazda. Es folgen nun deutlich drei Verbote. Das erste ist gagtä mä
thadaja. Zur Uebersetzung dieser Worte, welche sehr verschiedene Er-
klärungsversuche erfahren haben, lässt uns der medische Text einen fe-
sten Boden gewinnen. Dieser überträgt nämlich thadaja mit demselben
Wort, das in Zeile 31 und 32 dem persischen manijähj in Zeile 38
entspricht, und mit anderer Endung noch einmal begegnet als letztes
Wort von Inschrift H. Das Wort muss also „denken, meinen, sprechen“
bedeuten. Dadurch kommen wir auf die Vermuthung, dass thadaj nichts
sei als eine neue Form des schon bekannten unregelmässigen Verbums,
von welchem wir thätij (dicit), athabja (dicebatur) haben. Hier er-
wartet man den Imperativ, dessen gewöhnliche Endung dcij ist; steht
thadaj statt IhacTij, so wäre dies gleich sanskrit (jädhi, nur mit Verkür-
zung des a. Es erklären sich überhaupt die verschiedenen Formen des
Verbum thätij am besten aus der Wurzel <jäs (jnbere, docere). Zu