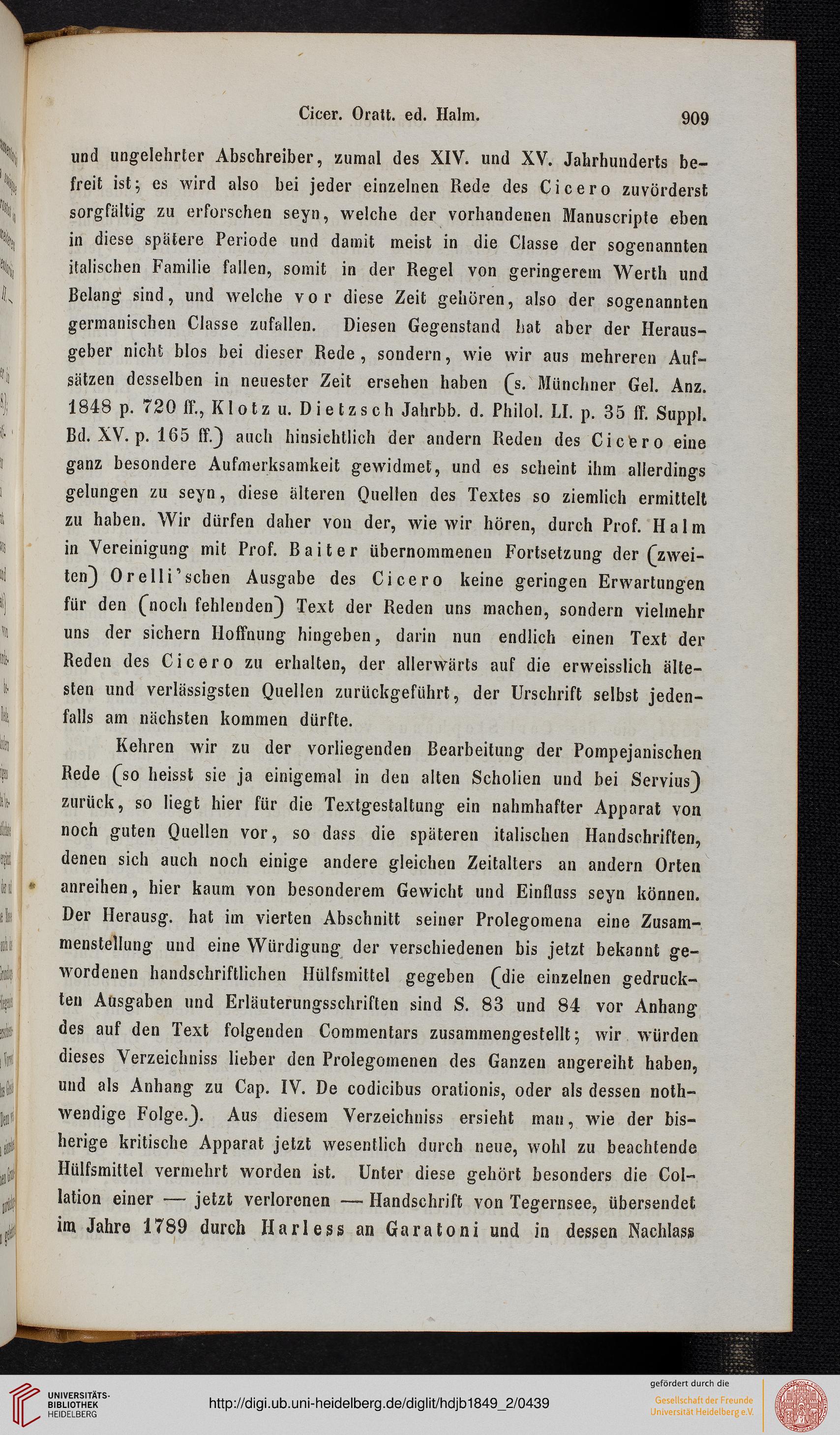Cicer. Oratt. ed. Halm.
909
und ungelehrter Abschreiber, zumal des XIV. und XV. Jahrhunderts be-
freit ist; es wird also bei jeder einzelnen Rede des Cicero zuvörderst
sorgfältig zu erforschen seyn, welche der vorhandenen Manuscripte eben
in diese spätere Periode und damit meist in die Classe der sogenannten
italischen Familie fallen, somit in der Regel von geringerem Werth und
Belang sind, und welche vor diese Zeit gehören, also der sogenannten
germanischen Classe zufallen. Diesen Gegenstand hat aber der Heraus-
geber nicht blos bei dieser Rede , sondern, wie wir aus mehreren Auf-
sätzen desselben in neuester Zeit ersehen haben Q. Münchner Gel. Anz.
1848 p. 720 ff., Klotz u. Dietz sch Jahrbb. d. Philol. LI. p. 35 ff. Suppl.
Bd. XV. p. 165 ff.) auch hinsichtlich der andern Reden des Cicero eine
ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet, und es scheint ihm allerdings
gelungen zu seyn, diese älteren Quellen des Textes so ziemlich ermittelt
zu haben. Wir dürfen daher von der, wie wir hören, durch Prof. Halm
in Vereinigung mit Prof. Bai ter übernommenen Fortsetzung der (^zwei-
ten) 0reili’sehen Ausgabe des Cicero keine geringen Erwartungen
für den (noch fehlenden) Text der Reden uns machen, sondern vielmehr
uns der sichern Hoffnung hingeben, darin nun endlich einen Text der
Reden des Cicero zu erhalten, der allerwärts auf die erweisslich älte-
sten und verlässigsten Quellen zurückgeführt, der Urschrift selbst jeden-
falls am nächsten kommen dürfte.
Kehren wir zu der vorliegenden Bearbeitung der Pompejanischen
Rede (so heisst sie ja einigemal in den alten Scholien und bei Servius)
zurück, so liegt hier für die Textgestaltung ein nahmhafter Apparat von
noch guten Quellen vor, so dass die späteren italischen Handschriften,
denen sich auch noch einige andere gleichen Zeitalters an andern Orten
anreihen, hier kaum von besonderem Gewicht und Einfluss seyn können.
Der Herausg. hat im vierten Abschnitt seiner Prolegomena eine Zusam-
menstellung und eine Würdigung der verschiedenen bis jetzt bekannt ge-
wordenen handschriftlichen Hülfsmittel gegeben £die einzelnen gedruck-
ten Ausgaben und Erläuterungsschriften sind S. 83 und 84 vor Anhang
des auf den Text folgenden Commentars zusammengestellt; wir würden
dieses Verzeichniss lieber den Prolegomenen des Ganzen angereiht haben,
und als Anhang zu Cap. IV. De codicibus oralionis, oder als dessen noth-
wendige Folge.). Aus diesem Verzeichniss ersieht man, wie der bis-
herige kritische Apparat jetzt wesentlich durch neue, wohl zu beachtende
Hülfsmittel vermehrt worden ist. Unter diese gehört besonders die Col-
lation einer — jetzt verlorenen —- Handschrift von Tegernsee, übersendet
im Jahre 1789 durch Hari ess an Garatoni und in dessen Nachlass
909
und ungelehrter Abschreiber, zumal des XIV. und XV. Jahrhunderts be-
freit ist; es wird also bei jeder einzelnen Rede des Cicero zuvörderst
sorgfältig zu erforschen seyn, welche der vorhandenen Manuscripte eben
in diese spätere Periode und damit meist in die Classe der sogenannten
italischen Familie fallen, somit in der Regel von geringerem Werth und
Belang sind, und welche vor diese Zeit gehören, also der sogenannten
germanischen Classe zufallen. Diesen Gegenstand hat aber der Heraus-
geber nicht blos bei dieser Rede , sondern, wie wir aus mehreren Auf-
sätzen desselben in neuester Zeit ersehen haben Q. Münchner Gel. Anz.
1848 p. 720 ff., Klotz u. Dietz sch Jahrbb. d. Philol. LI. p. 35 ff. Suppl.
Bd. XV. p. 165 ff.) auch hinsichtlich der andern Reden des Cicero eine
ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet, und es scheint ihm allerdings
gelungen zu seyn, diese älteren Quellen des Textes so ziemlich ermittelt
zu haben. Wir dürfen daher von der, wie wir hören, durch Prof. Halm
in Vereinigung mit Prof. Bai ter übernommenen Fortsetzung der (^zwei-
ten) 0reili’sehen Ausgabe des Cicero keine geringen Erwartungen
für den (noch fehlenden) Text der Reden uns machen, sondern vielmehr
uns der sichern Hoffnung hingeben, darin nun endlich einen Text der
Reden des Cicero zu erhalten, der allerwärts auf die erweisslich älte-
sten und verlässigsten Quellen zurückgeführt, der Urschrift selbst jeden-
falls am nächsten kommen dürfte.
Kehren wir zu der vorliegenden Bearbeitung der Pompejanischen
Rede (so heisst sie ja einigemal in den alten Scholien und bei Servius)
zurück, so liegt hier für die Textgestaltung ein nahmhafter Apparat von
noch guten Quellen vor, so dass die späteren italischen Handschriften,
denen sich auch noch einige andere gleichen Zeitalters an andern Orten
anreihen, hier kaum von besonderem Gewicht und Einfluss seyn können.
Der Herausg. hat im vierten Abschnitt seiner Prolegomena eine Zusam-
menstellung und eine Würdigung der verschiedenen bis jetzt bekannt ge-
wordenen handschriftlichen Hülfsmittel gegeben £die einzelnen gedruck-
ten Ausgaben und Erläuterungsschriften sind S. 83 und 84 vor Anhang
des auf den Text folgenden Commentars zusammengestellt; wir würden
dieses Verzeichniss lieber den Prolegomenen des Ganzen angereiht haben,
und als Anhang zu Cap. IV. De codicibus oralionis, oder als dessen noth-
wendige Folge.). Aus diesem Verzeichniss ersieht man, wie der bis-
herige kritische Apparat jetzt wesentlich durch neue, wohl zu beachtende
Hülfsmittel vermehrt worden ist. Unter diese gehört besonders die Col-
lation einer — jetzt verlorenen —- Handschrift von Tegernsee, übersendet
im Jahre 1789 durch Hari ess an Garatoni und in dessen Nachlass