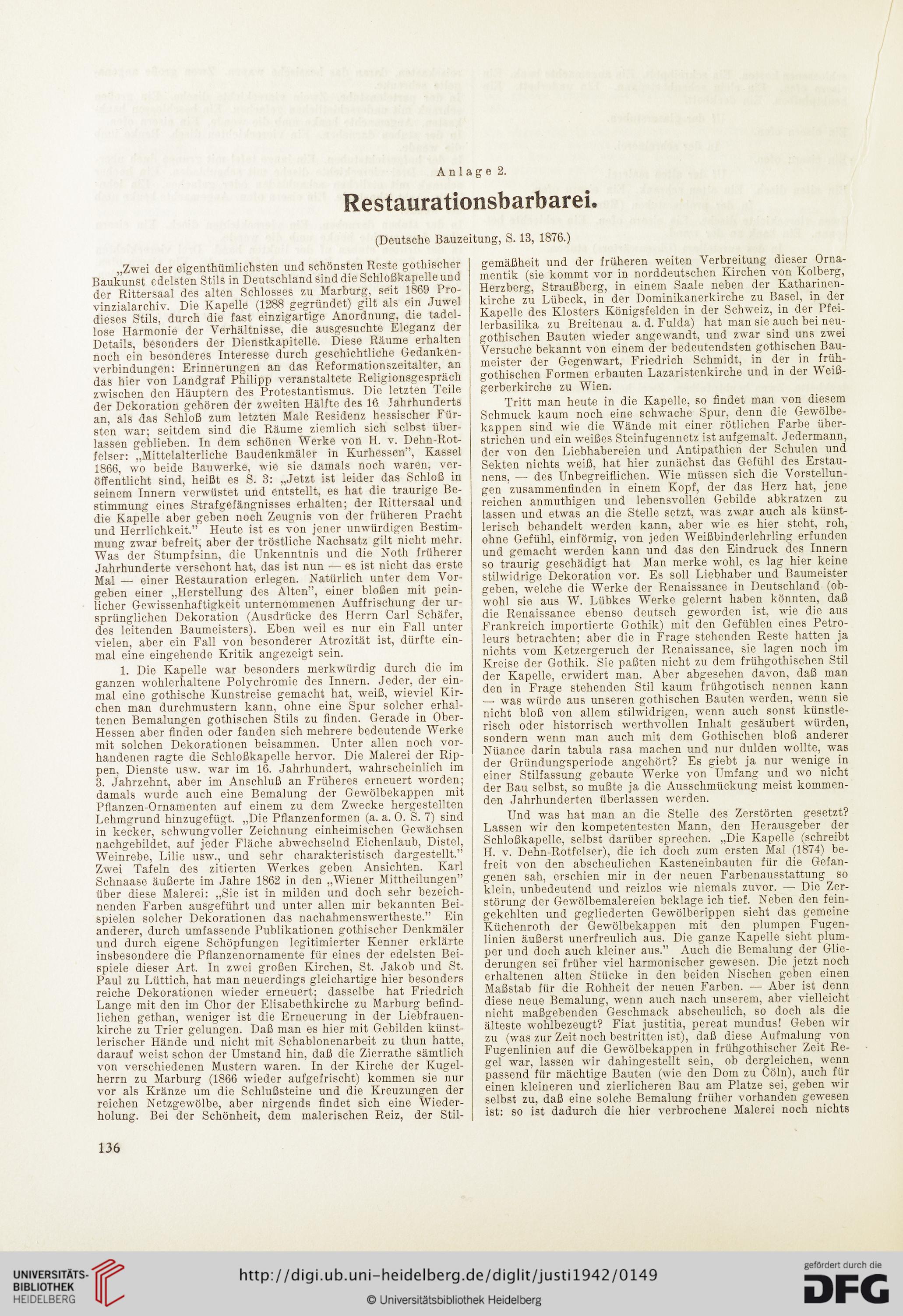Anlage 2.
Restaurationsbarbarei.
(Deutsche Bauzeitung, S. 13, 1876.)
„Zwei der eigentümlichsten und schönsten Reste gothischer
Baukunst edelsten Stils in Deutschland sind die Schloßkapelle und
der Rittersaal des alten Schlosses zu Marburg, seit 1869 Pro-
vinzialarchiv. Die Kapelle (1288 gegründet) gilt als ein Juwel
dieses Stils, durch die fast einzigartige Anordnung, die tadel-
lose Harmonie der Verhältnisse, die ausgesuchte Eleganz der
Details, besonders der Dienstkapitelle. Diese Räume erhalten
noch ein besonderes Interesse durch geschichtliche Gedanken-
verbindungen: Erinnerungen an das Reformationszeitalter, an
das hier von Landgraf Philipp veranstaltete Religionsgespräch
zwischen den Häuptern des Protestantismus. Die letzten Teile
der Dekoration gehören der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
an, als das Schloß zum letzten Male Residenz hessischer Für-
sten war; seitdem sind die Räume ziemlich sich selbst über-
lassen geblieben. In dem schönen Werke von H. v. Dehn-Rot-
felser: „Mittelalterliche Baudenkmäler in Kurhessen”, Kassel
1866, wo beide Bauwerke, wie sie damals noch waren, ver-
öffentlicht sind, heißt es S. 3: „Jetzt ist leider das Schloß in
seinem Innern verwüstet und entstellt, es hat die traurige Be-
stimmung eines Strafgefängnisses erhalten; der Rittersaal und
die Kapelle aber geben noch Zeugnis von der früheren Pracht
und Herrlichkeit.” Heute ist es von jener unwürdigen Bestim-
mung zwar befreit, aber der tröstliche Nachsatz gilt nicht mehr.
Was der Stumpfsinn, die Unkenntnis und die Noth früherer
Jahrhunderte verschont hat, das ist nun — es ist nicht das erste
Mal — einer Restauration erlegen. Natürlich unter dem Vor-
geben einer „Herstellung des Alten”, einer bloßen mit pein-
licher Gewissenhaftigkeit unternommenen Auffrischung der ur-
sprünglichen Dekoration (Ausdrücke des Herrn Carl Schäfer,
des leitenden Baumeisters). Eben weil es nur ein Fall unter
vielen, aber ein Fall von besonderer Atrozität ist, dürfte ein-
mal eine eingehende Kritik angezeigt sein.
1. Die Kapelle war besonders merkwürdig durch die im
ganzen wohlerhaltene Polychromie des Innern. Jeder, der ein-
mal eine gothische Kunstreise gemacht hat, weiß, wieviel Kir-
chen man durchmustern kann, ohne eine Spur solcher erhal-
tenen Bemalungen gothischen Stils zu finden. Gerade in Ober-
Hessen aber finden oder fanden sich mehrere bedeutende Werke
mit solchen Dekorationen beisammen. Unter allen noch vor-
handenen ragte die Schloßkapelle hervor. Die Malerei der Rip-
pen, Dienste usw. war im 16. Jahrhundert, wahrscheinlich im
3. Jahrzehnt, aber im Anschluß an Früheres erneuert worden;
damals wurde auch eine Bemalung der Gewölbekappen mit
Pflanzen-Ornamenten auf einem zu dem Zwecke hergestellten
Lehmgrund hinzugefügt. „Die Pflanzenformen (a. a. 0. S. 7) sind
in kecker, schwungvoller Zeichnung einheimischen Gewächsen
nachgebildet, auf jeder Fläche abwechselnd Eichenlaub, Distel,
Weinrebe, Lilie usw., und sehr charakteristisch dargestellt.”
Zwei Tafeln des zitierten Werkes geben Ansichten. Karl
Schnaase äußerte im Jahre 1862 in den „Wiener Mittheilungen”
über diese Malerei: „Sie ist in milden und doch sehr bezeich-
nenden Farben ausgeführt und unter allen mir bekannten Bei-
spielen solcher Dekorationen das nachahmenswertheste.” Ein
anderer, durch umfassende Publikationen gothischer Denkmäler
und durch eigene Schöpfungen legitimierter Kenner erklärte
insbesondere die Pflanzenornamente für eines der edelsten Bei-
spiele dieser Art. In zwei großen Kirchen, St. Jakob und St.
Paul zu Lüttich, hat man neuerdings gleichartige hier besonders
reiche Dekorationen wieder erneuert; dasselbe hat Friedrich
Lange mit den im Chor der Elisabethkirche zu Marburg befind-
lichen gethan, weniger ist die Erneuerung in der Liebfrauen-
kirche zu Trier gelungen. Daß man es hier mit Gebilden künst-
lerischer Hände und nicht mit Schablonenarbeit zu thun hatte,
darauf weist schon der Umstand hin, daß die Zierrathe sämtlich
von verschiedenen Mustern waren. In der Kirche der Kugel-
herrn zu Marburg (1866 wieder aufgefrischt) kommen sie nur
vor als Kränze um die Schlußsteine und die Kreuzungen der
reichen Netzgewölbe, aber nirgends findet sich eine Wieder-
holung. Bei der Schönheit, dem malerischen Reiz, der Stil-
gemäßheit und der früheren weiten Verbreitung dieser Orna-
mentik (sie kommt vor in norddeutschen Kirchen von Kolberg,
Herzberg, Straußberg, in einem Saale neben der Katharinen-
kirche zu Lübeck, in der Dominikanerkirche zu Basel, in der
Kapelle des Klosters Königsfelden in der Schweiz, in der Pfei-
lerbasilika zu Breitenau a. d. Fulda) hat man sie auch bei neu-
gothischen Bauten wieder angewandt, und zwar sind uns zwei
Versuche bekannt von einem der bedeutendsten gothischen Bau-
meister der Gegenwart, Friedrich Schmidt, in der in früh-
gothischen Formen erbauten Lazaristenkirche und in der Weiß-
gerberkirche zu Wien.
Tritt man heute in die Kapelle, so findet man von diesem
Schmuck kaum noch eine schwache Spur, denn die Gewölbe-
kappen sind wie die Wände mit einer rötlichen Farbe über-
strichen und ein weißes Steinfugennetz ist aufgemalt. Jedermann,
der von den Liebhabereien und Antipathien der Schulen und
Sekten nichts weiß, hat hier zunächst das Gefühl des Erstau-
nens, — des Unbegreiflichen. Wie müssen sich die Vorstellun-
gen zusammenfinden in einem Kopf, der das Herz hat, jene
reichen anmuthigen und lebensvollen Gebilde abkratzen zu
lassen und etwas an die Stelle setzt, was zwar auch als künst-
lerisch behandelt werden kann, aber wie es hier steht, roh,
ohne Gefühl, einförmig, von jeden Weißbinderlehrling erfunden
und gemacht werden kann und das den Eindruck des Innern
so traurig geschädigt hat Man merke wohl, es lag hier keine
stilwidrige Dekoration vor. Es soll Liebhaber und Baumeister
geben, welche die Werke der Renaissance in Deutschland (ob-
wohl sie aus W. Liibkes Werke gelernt haben könnten, daß
die Renaissance ebenso deutsch geworden ist, wie die aus
Frankreich importierte Gothik) mit den Gefühlen eines Petro-
leurs betrachten; aber die in Frage stehenden Reste hatten ja
nichts vom Ketzergeruch der Renaissance, sie lagen noch im
Kreise der Gothik. Sie paßten nicht zu dem frühgothischen Stil
der Kapelle, erwidert man. Aber abgesehen davon, daß man
den in Frage stehenden Stil kaum frühgotisch nennen kann
— was würde aus unseren gothischen Bauten werden, wenn sie
nicht bloß von allem stilwidrigen, wenn auch sonst künstle-
risch oder historrisch werthvollen Inhalt gesäubert würden,
sondern wenn man auch mit dem Gothischen bloß anderer
Nüance darin tabula rasa machen und nur dulden wollte, was
der Gründungsperiode angehört? Es giebt ja nur wenige in
einer Stilfassung gebaute Werke von Umfang und wo nicht
der Bau selbst, so mußte ja die Ausschmückung meist kommen-
den Jahrhunderten überlassen werden.
Und was hat man an die Stelle des Zerstörten gesetzt?
Lassen wir den kompetentesten Mann, den Herausgeber der
Schloßkapelle, selbst darüber sprechen. „Die Kapelle (schreibt
H. v. Dehn-Rotfelser), die ich doch zum ersten Mal (1874) be-
freit von den abscheulichen Kasteneinbauten für die Gefan-
genen sah, erschien mir in der neuen Farbenausstattung so
klein, unbedeutend und reizlos wie niemals zuvor. — Die Zer-
störung der Gewölbemalereien beklage ich tief. Neben den fein-
gekehlten und gegliederten Gewölberippen sieht das gemeine
Küchenroth der Gewölbekappen mit den plumpen Fugen-
linien äußerst unerfreulich aus. Die ganze Kapelle sieht plum-
per und doch auch kleiner aus.” Auch die Bemalung der Glie-
derungen sei früher viel harmonischer gewesen. Die jetzt noch
erhaltenen alten Stücke in den beiden Nischen geben einen
Maßstab für die Rohheit der neuen Farben. — Aber ist denn
diese neue Bemalung, wenn auch nach unserem, aber vielleicht
nicht maßgebenden Geschmack abscheulich, so doch als die
älteste wohlbezeugt? Fiat justitia, pereat mundus! Geben wir
zu (was zur Zeit noch bestritten ist), daß diese Aufmalung von
Fugenlinien auf die Gewölbekappen in frühgothischer Zeit Re-
gel war, lassen wir dahingestellt sein, ob dergleichen, wenn
passend für mächtige Bauten (wie den Dom zu Cöln), auch für
einen kleineren und zierlicheren Bau am Platze sei, geben wir
selbst zu, daß eine solche Bemalung früher vorhanden gewesen
ist: so ist dadurch die hier verbrochene Malerei noch nichts
136
Restaurationsbarbarei.
(Deutsche Bauzeitung, S. 13, 1876.)
„Zwei der eigentümlichsten und schönsten Reste gothischer
Baukunst edelsten Stils in Deutschland sind die Schloßkapelle und
der Rittersaal des alten Schlosses zu Marburg, seit 1869 Pro-
vinzialarchiv. Die Kapelle (1288 gegründet) gilt als ein Juwel
dieses Stils, durch die fast einzigartige Anordnung, die tadel-
lose Harmonie der Verhältnisse, die ausgesuchte Eleganz der
Details, besonders der Dienstkapitelle. Diese Räume erhalten
noch ein besonderes Interesse durch geschichtliche Gedanken-
verbindungen: Erinnerungen an das Reformationszeitalter, an
das hier von Landgraf Philipp veranstaltete Religionsgespräch
zwischen den Häuptern des Protestantismus. Die letzten Teile
der Dekoration gehören der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
an, als das Schloß zum letzten Male Residenz hessischer Für-
sten war; seitdem sind die Räume ziemlich sich selbst über-
lassen geblieben. In dem schönen Werke von H. v. Dehn-Rot-
felser: „Mittelalterliche Baudenkmäler in Kurhessen”, Kassel
1866, wo beide Bauwerke, wie sie damals noch waren, ver-
öffentlicht sind, heißt es S. 3: „Jetzt ist leider das Schloß in
seinem Innern verwüstet und entstellt, es hat die traurige Be-
stimmung eines Strafgefängnisses erhalten; der Rittersaal und
die Kapelle aber geben noch Zeugnis von der früheren Pracht
und Herrlichkeit.” Heute ist es von jener unwürdigen Bestim-
mung zwar befreit, aber der tröstliche Nachsatz gilt nicht mehr.
Was der Stumpfsinn, die Unkenntnis und die Noth früherer
Jahrhunderte verschont hat, das ist nun — es ist nicht das erste
Mal — einer Restauration erlegen. Natürlich unter dem Vor-
geben einer „Herstellung des Alten”, einer bloßen mit pein-
licher Gewissenhaftigkeit unternommenen Auffrischung der ur-
sprünglichen Dekoration (Ausdrücke des Herrn Carl Schäfer,
des leitenden Baumeisters). Eben weil es nur ein Fall unter
vielen, aber ein Fall von besonderer Atrozität ist, dürfte ein-
mal eine eingehende Kritik angezeigt sein.
1. Die Kapelle war besonders merkwürdig durch die im
ganzen wohlerhaltene Polychromie des Innern. Jeder, der ein-
mal eine gothische Kunstreise gemacht hat, weiß, wieviel Kir-
chen man durchmustern kann, ohne eine Spur solcher erhal-
tenen Bemalungen gothischen Stils zu finden. Gerade in Ober-
Hessen aber finden oder fanden sich mehrere bedeutende Werke
mit solchen Dekorationen beisammen. Unter allen noch vor-
handenen ragte die Schloßkapelle hervor. Die Malerei der Rip-
pen, Dienste usw. war im 16. Jahrhundert, wahrscheinlich im
3. Jahrzehnt, aber im Anschluß an Früheres erneuert worden;
damals wurde auch eine Bemalung der Gewölbekappen mit
Pflanzen-Ornamenten auf einem zu dem Zwecke hergestellten
Lehmgrund hinzugefügt. „Die Pflanzenformen (a. a. 0. S. 7) sind
in kecker, schwungvoller Zeichnung einheimischen Gewächsen
nachgebildet, auf jeder Fläche abwechselnd Eichenlaub, Distel,
Weinrebe, Lilie usw., und sehr charakteristisch dargestellt.”
Zwei Tafeln des zitierten Werkes geben Ansichten. Karl
Schnaase äußerte im Jahre 1862 in den „Wiener Mittheilungen”
über diese Malerei: „Sie ist in milden und doch sehr bezeich-
nenden Farben ausgeführt und unter allen mir bekannten Bei-
spielen solcher Dekorationen das nachahmenswertheste.” Ein
anderer, durch umfassende Publikationen gothischer Denkmäler
und durch eigene Schöpfungen legitimierter Kenner erklärte
insbesondere die Pflanzenornamente für eines der edelsten Bei-
spiele dieser Art. In zwei großen Kirchen, St. Jakob und St.
Paul zu Lüttich, hat man neuerdings gleichartige hier besonders
reiche Dekorationen wieder erneuert; dasselbe hat Friedrich
Lange mit den im Chor der Elisabethkirche zu Marburg befind-
lichen gethan, weniger ist die Erneuerung in der Liebfrauen-
kirche zu Trier gelungen. Daß man es hier mit Gebilden künst-
lerischer Hände und nicht mit Schablonenarbeit zu thun hatte,
darauf weist schon der Umstand hin, daß die Zierrathe sämtlich
von verschiedenen Mustern waren. In der Kirche der Kugel-
herrn zu Marburg (1866 wieder aufgefrischt) kommen sie nur
vor als Kränze um die Schlußsteine und die Kreuzungen der
reichen Netzgewölbe, aber nirgends findet sich eine Wieder-
holung. Bei der Schönheit, dem malerischen Reiz, der Stil-
gemäßheit und der früheren weiten Verbreitung dieser Orna-
mentik (sie kommt vor in norddeutschen Kirchen von Kolberg,
Herzberg, Straußberg, in einem Saale neben der Katharinen-
kirche zu Lübeck, in der Dominikanerkirche zu Basel, in der
Kapelle des Klosters Königsfelden in der Schweiz, in der Pfei-
lerbasilika zu Breitenau a. d. Fulda) hat man sie auch bei neu-
gothischen Bauten wieder angewandt, und zwar sind uns zwei
Versuche bekannt von einem der bedeutendsten gothischen Bau-
meister der Gegenwart, Friedrich Schmidt, in der in früh-
gothischen Formen erbauten Lazaristenkirche und in der Weiß-
gerberkirche zu Wien.
Tritt man heute in die Kapelle, so findet man von diesem
Schmuck kaum noch eine schwache Spur, denn die Gewölbe-
kappen sind wie die Wände mit einer rötlichen Farbe über-
strichen und ein weißes Steinfugennetz ist aufgemalt. Jedermann,
der von den Liebhabereien und Antipathien der Schulen und
Sekten nichts weiß, hat hier zunächst das Gefühl des Erstau-
nens, — des Unbegreiflichen. Wie müssen sich die Vorstellun-
gen zusammenfinden in einem Kopf, der das Herz hat, jene
reichen anmuthigen und lebensvollen Gebilde abkratzen zu
lassen und etwas an die Stelle setzt, was zwar auch als künst-
lerisch behandelt werden kann, aber wie es hier steht, roh,
ohne Gefühl, einförmig, von jeden Weißbinderlehrling erfunden
und gemacht werden kann und das den Eindruck des Innern
so traurig geschädigt hat Man merke wohl, es lag hier keine
stilwidrige Dekoration vor. Es soll Liebhaber und Baumeister
geben, welche die Werke der Renaissance in Deutschland (ob-
wohl sie aus W. Liibkes Werke gelernt haben könnten, daß
die Renaissance ebenso deutsch geworden ist, wie die aus
Frankreich importierte Gothik) mit den Gefühlen eines Petro-
leurs betrachten; aber die in Frage stehenden Reste hatten ja
nichts vom Ketzergeruch der Renaissance, sie lagen noch im
Kreise der Gothik. Sie paßten nicht zu dem frühgothischen Stil
der Kapelle, erwidert man. Aber abgesehen davon, daß man
den in Frage stehenden Stil kaum frühgotisch nennen kann
— was würde aus unseren gothischen Bauten werden, wenn sie
nicht bloß von allem stilwidrigen, wenn auch sonst künstle-
risch oder historrisch werthvollen Inhalt gesäubert würden,
sondern wenn man auch mit dem Gothischen bloß anderer
Nüance darin tabula rasa machen und nur dulden wollte, was
der Gründungsperiode angehört? Es giebt ja nur wenige in
einer Stilfassung gebaute Werke von Umfang und wo nicht
der Bau selbst, so mußte ja die Ausschmückung meist kommen-
den Jahrhunderten überlassen werden.
Und was hat man an die Stelle des Zerstörten gesetzt?
Lassen wir den kompetentesten Mann, den Herausgeber der
Schloßkapelle, selbst darüber sprechen. „Die Kapelle (schreibt
H. v. Dehn-Rotfelser), die ich doch zum ersten Mal (1874) be-
freit von den abscheulichen Kasteneinbauten für die Gefan-
genen sah, erschien mir in der neuen Farbenausstattung so
klein, unbedeutend und reizlos wie niemals zuvor. — Die Zer-
störung der Gewölbemalereien beklage ich tief. Neben den fein-
gekehlten und gegliederten Gewölberippen sieht das gemeine
Küchenroth der Gewölbekappen mit den plumpen Fugen-
linien äußerst unerfreulich aus. Die ganze Kapelle sieht plum-
per und doch auch kleiner aus.” Auch die Bemalung der Glie-
derungen sei früher viel harmonischer gewesen. Die jetzt noch
erhaltenen alten Stücke in den beiden Nischen geben einen
Maßstab für die Rohheit der neuen Farben. — Aber ist denn
diese neue Bemalung, wenn auch nach unserem, aber vielleicht
nicht maßgebenden Geschmack abscheulich, so doch als die
älteste wohlbezeugt? Fiat justitia, pereat mundus! Geben wir
zu (was zur Zeit noch bestritten ist), daß diese Aufmalung von
Fugenlinien auf die Gewölbekappen in frühgothischer Zeit Re-
gel war, lassen wir dahingestellt sein, ob dergleichen, wenn
passend für mächtige Bauten (wie den Dom zu Cöln), auch für
einen kleineren und zierlicheren Bau am Platze sei, geben wir
selbst zu, daß eine solche Bemalung früher vorhanden gewesen
ist: so ist dadurch die hier verbrochene Malerei noch nichts
136