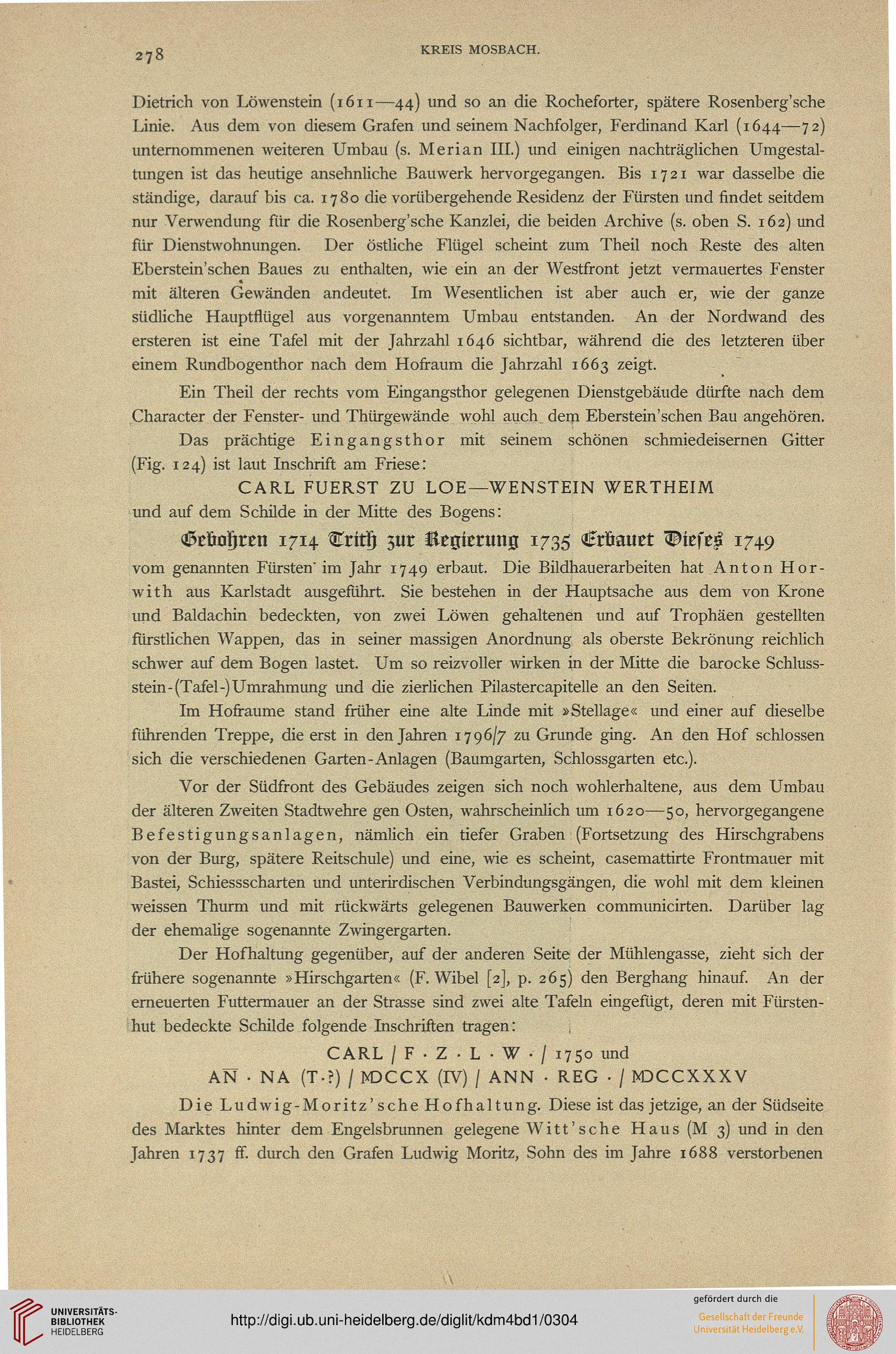278
KREIS MOSBACH.
Dietrich von Löwenstein (1611—44) und so an die Rocheforter, spätere Rosenberg'sche
Linie. Aus dem von diesem Grafen und seinem Nachfolger, Ferdinand Karl (1644—72)
unternommenen weiteren Umbau (s. Merian III.) und einigen nachträglichen Umgestal-
tungen ist das heutige ansehnliche Bauwerk hervorgegangen. Bis 1721 war dasselbe die
ständige, darauf bis ca. 1780 die vorübergehende Residenz der Fürsten und findet seitdem
nur Verwendung für die Rosenberg'sche Kanzlei, die beiden Archive (s. oben S. 162) und
für Dienstwohnungen. Der östliche Flügel scheint zum Theil noch Reste des alten
Eberstein'schen Baues zu enthalten, wie ein an der Westfront jetzt vermauertes Fenster
mit älteren Gewänden andeutet. Im Wesentlichen ist aber auch er, wie der ganze
südliche Hauptflügel aus vorgenanntem Umbau entstanden. An der Nordwand des
ersteren ist eine Tafel mit der Jahrzahl 1646 sichtbar, während die des letzteren über
einem Rundbogenthor nach dem Hofraum die Jahrzahl 1663 zeigt.
Ein Theil der rechts vom Eingangsthor gelegenen Dienstgebäude dürfte nach dem
Character der Fenster- und Thürgewände wohl auch_ dem Eberstein'schen Bau angehören.
Das prächtige Eingangsthor mit seinem schönen schmiedeisernen Gitter
(Fig. 124) ist laut Inschrift am Friese:
CARL FUERST ZU LOE—WENSTEIN WERTHEIM
und auf dem Schilde in der Mitte des Bogens:
afeöoljren 1714 §Tritfj 311t Itegtetirag 1735 Cr&auet 3£iefe£ 1749
vom genannten Fürsten" im Jahr 1749 erbaut. Die Bildhauerarbeiten hat Anton Hor-
with aus Karlstadt ausgeführt. Sie bestehen in der Hauptsache aus dem von Krone
und Baldachin bedeckten, von zwei Löwen gehaltenen und auf Trophäen gestellten
fürstlichen Wappen, das in seiner massigen Anordnung als oberste Bekrönung reichlich
schwer auf dem Bogen lastet. Um so reizvoller wirken in der Mitte die barocke Schluss-
stein-(Tafel-) Umrahmung und die zierlichen Pilastercapitelle an den Seiten.
Im Hofraume stand früher eine alte Linde mit »Stellage« und einer auf dieselbe
führenden Treppe, die erst in den Jahren 1796/7 zu Grunde ging. An den Hof schlössen
sich die verschiedenen Garten-Anlagen (Baumgarten, Schlossgarten etc.).
Vor der Südfront des Gebäudes zeigen sich noch wohlerhaltene, aus dem Umbau
der älteren Zweiten Stadtwehre gen Osten, wahrscheinlich um 1620—50, hervorgegangene
Befestigungsanlagen, nämlich ein tiefer Graben (Fortsetzung des Hirschgrabens
von der Burg, spätere Reitschule) und eine, wie es scheint, casemattirte Frontmauer mit
Bastei, Schiessscharten und unterirdischen Verbindungsgängen, die wohl mit dem kleinen
weissen Thurm und mit rückwärts gelegenen Bauwerken communicirten. Darüber lag
der ehemalige sogenannte Zwingergarten.
Der Hofhaltung gegenüber, auf der anderen Seite der Mühlengasse, zieht sich der
frühere sogenannte »Hirschgarten« (F. Wibel [2], p. 265) den Berghang hinauf. An der
erneuerten Futtermauer an der Strasse sind zwei alte Tafeln eingefugt, deren mit Fürsten-
hut bedeckte Schilde folgende Inschriften tragen:
CARL / F ■ Z • L • W • / 1750 und
AN • NA (T-?) / M5CCX (W) / ANN • REG ■ / NDCCXXXV
Die Ludwig-Moritz' sehe Hofhaltung. Diese ist das jetzige, an der Südseite
des Marktes hinter dem Engelsbrunnen gelegene Witt'sehe Haus (M 3) und in den
Jahren 1737 ff. durch den Grafen Ludwig Moritz, Sohn des im Jahre 1688 verstorbenen
KREIS MOSBACH.
Dietrich von Löwenstein (1611—44) und so an die Rocheforter, spätere Rosenberg'sche
Linie. Aus dem von diesem Grafen und seinem Nachfolger, Ferdinand Karl (1644—72)
unternommenen weiteren Umbau (s. Merian III.) und einigen nachträglichen Umgestal-
tungen ist das heutige ansehnliche Bauwerk hervorgegangen. Bis 1721 war dasselbe die
ständige, darauf bis ca. 1780 die vorübergehende Residenz der Fürsten und findet seitdem
nur Verwendung für die Rosenberg'sche Kanzlei, die beiden Archive (s. oben S. 162) und
für Dienstwohnungen. Der östliche Flügel scheint zum Theil noch Reste des alten
Eberstein'schen Baues zu enthalten, wie ein an der Westfront jetzt vermauertes Fenster
mit älteren Gewänden andeutet. Im Wesentlichen ist aber auch er, wie der ganze
südliche Hauptflügel aus vorgenanntem Umbau entstanden. An der Nordwand des
ersteren ist eine Tafel mit der Jahrzahl 1646 sichtbar, während die des letzteren über
einem Rundbogenthor nach dem Hofraum die Jahrzahl 1663 zeigt.
Ein Theil der rechts vom Eingangsthor gelegenen Dienstgebäude dürfte nach dem
Character der Fenster- und Thürgewände wohl auch_ dem Eberstein'schen Bau angehören.
Das prächtige Eingangsthor mit seinem schönen schmiedeisernen Gitter
(Fig. 124) ist laut Inschrift am Friese:
CARL FUERST ZU LOE—WENSTEIN WERTHEIM
und auf dem Schilde in der Mitte des Bogens:
afeöoljren 1714 §Tritfj 311t Itegtetirag 1735 Cr&auet 3£iefe£ 1749
vom genannten Fürsten" im Jahr 1749 erbaut. Die Bildhauerarbeiten hat Anton Hor-
with aus Karlstadt ausgeführt. Sie bestehen in der Hauptsache aus dem von Krone
und Baldachin bedeckten, von zwei Löwen gehaltenen und auf Trophäen gestellten
fürstlichen Wappen, das in seiner massigen Anordnung als oberste Bekrönung reichlich
schwer auf dem Bogen lastet. Um so reizvoller wirken in der Mitte die barocke Schluss-
stein-(Tafel-) Umrahmung und die zierlichen Pilastercapitelle an den Seiten.
Im Hofraume stand früher eine alte Linde mit »Stellage« und einer auf dieselbe
führenden Treppe, die erst in den Jahren 1796/7 zu Grunde ging. An den Hof schlössen
sich die verschiedenen Garten-Anlagen (Baumgarten, Schlossgarten etc.).
Vor der Südfront des Gebäudes zeigen sich noch wohlerhaltene, aus dem Umbau
der älteren Zweiten Stadtwehre gen Osten, wahrscheinlich um 1620—50, hervorgegangene
Befestigungsanlagen, nämlich ein tiefer Graben (Fortsetzung des Hirschgrabens
von der Burg, spätere Reitschule) und eine, wie es scheint, casemattirte Frontmauer mit
Bastei, Schiessscharten und unterirdischen Verbindungsgängen, die wohl mit dem kleinen
weissen Thurm und mit rückwärts gelegenen Bauwerken communicirten. Darüber lag
der ehemalige sogenannte Zwingergarten.
Der Hofhaltung gegenüber, auf der anderen Seite der Mühlengasse, zieht sich der
frühere sogenannte »Hirschgarten« (F. Wibel [2], p. 265) den Berghang hinauf. An der
erneuerten Futtermauer an der Strasse sind zwei alte Tafeln eingefugt, deren mit Fürsten-
hut bedeckte Schilde folgende Inschriften tragen:
CARL / F ■ Z • L • W • / 1750 und
AN • NA (T-?) / M5CCX (W) / ANN • REG ■ / NDCCXXXV
Die Ludwig-Moritz' sehe Hofhaltung. Diese ist das jetzige, an der Südseite
des Marktes hinter dem Engelsbrunnen gelegene Witt'sehe Haus (M 3) und in den
Jahren 1737 ff. durch den Grafen Ludwig Moritz, Sohn des im Jahre 1688 verstorbenen