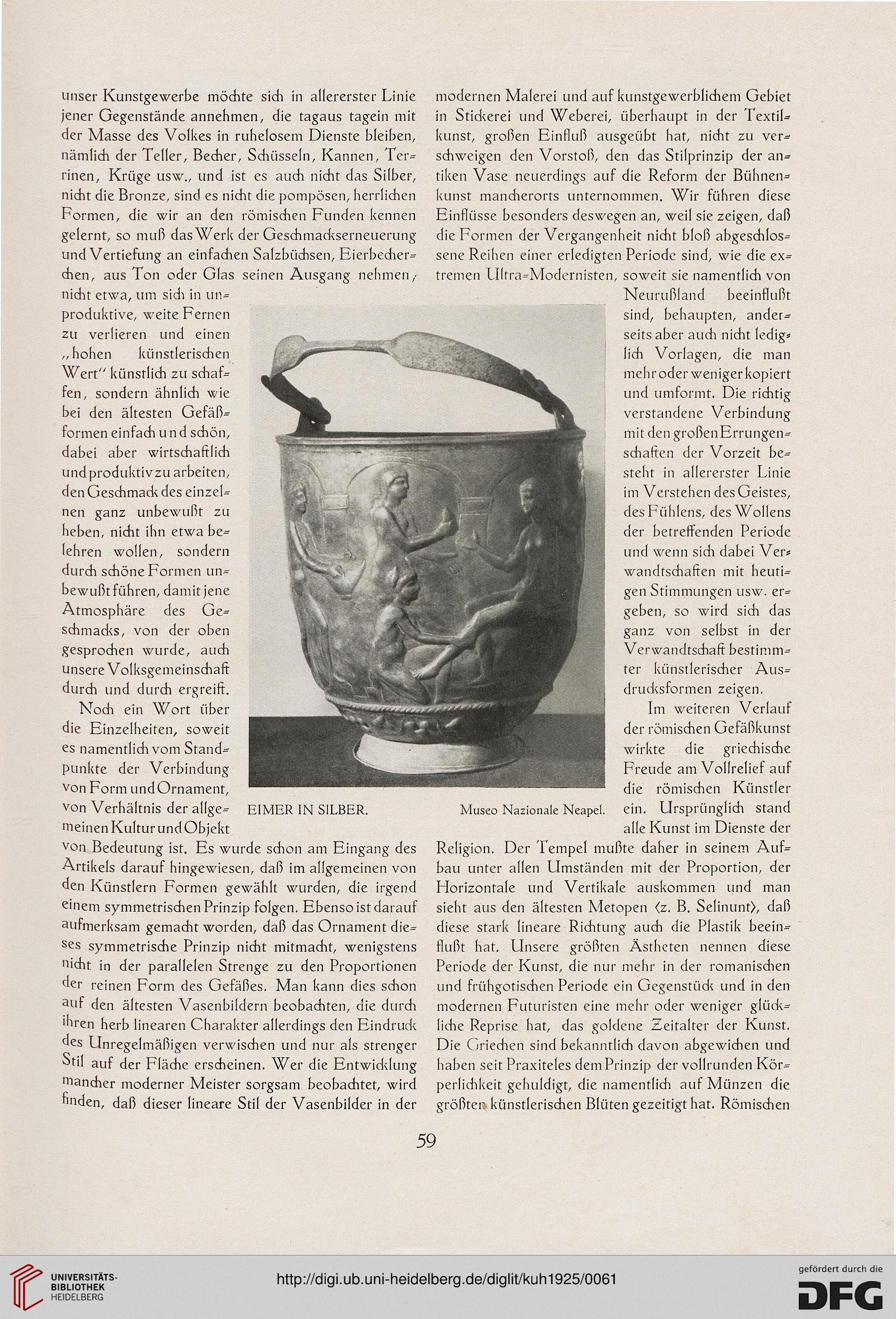unser Kunstgewerbe möchte sich in allererster Linie
jener Gegenstände annehmen, die tagaus tagein mit
der Masse des Volkes in ruhelosem Dienste bleiben,
nämlich der Teller, Becher, Schüsseln, Kannen, Ter-
rinen, Krüge usw., und ist es auch nicht das Silber,
nicht die Bronze, sind es nicht die pompösen, herrlichen
Formen, die wir an den römischen Funden kennen
gelernt, so muß das Werk der Geschmackserneuerung
und Vertiefung an einfachen Salzbüchsen, Eierbecher-
chen, aus Ton oder Glas seinen Ausgang nehmen,-
nicht etwa, um sidi in un-
produktive, weite Fernen
zu verlieren und einen , v
„ hohen künstlerischen
Wert" künstlich zu schaf-
fen, sondern ähnlich wie
bei den ältesten Gefäße
formen einfach und schön,
dabei aber wirtschaftlich
undproduktivzu arbeiten,
den Geschmack des einzel-
nen ganz unbewußt zu
heben, nicht ihn etwa be-
lehren wollen, sondern
durch schöne Formen un-
bewußt führen, damit jene
Atmosphäre des Ge-
schmacks, von der oben
gesprochen wurde, auch
unsere Volksgemeinschaft
durch und durch ergreift.
Noch ein Wort über
die Einzelheiten, soweit
es namentlich vom Stand-
punkte der Verbindung
von Form undOrnament,
von Verhältnis der allge-
meinen Kultur und Objekt
von Bedeutung ist. Es wurde schon am Eingang des
Artikels darauf hingewiesen, daß im allgemeinen von
den Künstlern Formen gewählt wurden, die irgend
einem symmetrischen Prinzip folgen. Ebenso ist darauf
aufmerksam gemacht worden, daß das Ornament die-
ses symmetrische Prinzip nicht mitmacht, wenigstens
•licht in der parallelen Strenge zu den Proportionen
der reinen Form des Gefäßes. Man kann dies schon
auf den ältesten Vasenbildern beobachten, die durch
'hren herb linearen Charakter allerdings den Eindrudc
des Unregelmäßigen verwischen und nur als strenger
Stil auf der Fläche erscheinen. Wer die Entwicklung
mancher moderner Meister sorgsam beobachtet, wird
finden, daß dieser lineare Stil der Vasenbilder in der
EIMER IN SILBER.
modernen Malerei und auf kunstgewerblichem Gebiet
in Stidterei und Weberei, überhaupt in der Textil-
kunst, großen Einfluß ausgeübt hat, nicht zu ver-
schweigen den Vorstoß, den das Stilprinzip der an-
tiken Vase neuerdings auf die Reform der Bühnen-
kunst mancherorts unternommen. Wir führen diese
Einflüsse besonders deswegen an, weil sie zeigen, daß
die Formen der Vergangenheit nicht bloß abgeschlos-
sene Reihen einer erledigten Periode sind, wie die ex-
tremen Ultra-Modernisten, soweit sie namentlich von
Neurußland beeinflußt
sind, behaupten, ander-
seits aber auch nicht ledig*
lieh Vorlagen, die man
mehr oder weniger kopiert
und umformt. Die richtig
verstandene Verbindung
mit den großenErrungen-
schaften der Vorzeit be-
steht in allererster Linie
im Verstehen des Geistes,
des Fühlens, des Wollens
der betreffenden Periode
und wenn sich dabei Ver«
wandtsdiaften mit heuti-
gen Stimmungen usw. er-
geben, so wird sich das
ganz von selbst in der
Verwandtschaft bestimm-
ter künstlerischer Aus-
drucksformen zeigen.
Im weiteren Verlauf
der römischen Gefäßkunst
wirkte die griechische
Freude am Vollrelief auf
die römischen Künstler
ein. Ursprünglich stand
alle Kunst im Dienste der
Religion. Der Tempel mußte daher in seinem Auf-
bau unter allen Umständen mit der Proportion, der
Horizontale und Vertikale auskommen und man
sieht aus den ältesten Metopen <z. B. Selinunt), daß
diese stark lineare Richtung auch die Plastik beein-
flußt hat. Unsere größten Ästheten nennen diese
Periode der Kunst, die nur mehr in der romanischen
und frühgotischen Periode ein Gegenstüdi und in den
modernen Futuristen eine mehr oder weniger glück-
liche Reprise hat, das goldene Zeitalter der Kunst.
Die Griechen sind bekanntlich davon abgewichen und
haben seit Praxiteles dem Prinzip der vollrunden Kör-
perlichkeit gehuldigt, die namentlich auf Münzen die
größten künstlerischen Blüten gezeitigt hat. Römischen
Museo Nazionale Neapel.
59
jener Gegenstände annehmen, die tagaus tagein mit
der Masse des Volkes in ruhelosem Dienste bleiben,
nämlich der Teller, Becher, Schüsseln, Kannen, Ter-
rinen, Krüge usw., und ist es auch nicht das Silber,
nicht die Bronze, sind es nicht die pompösen, herrlichen
Formen, die wir an den römischen Funden kennen
gelernt, so muß das Werk der Geschmackserneuerung
und Vertiefung an einfachen Salzbüchsen, Eierbecher-
chen, aus Ton oder Glas seinen Ausgang nehmen,-
nicht etwa, um sidi in un-
produktive, weite Fernen
zu verlieren und einen , v
„ hohen künstlerischen
Wert" künstlich zu schaf-
fen, sondern ähnlich wie
bei den ältesten Gefäße
formen einfach und schön,
dabei aber wirtschaftlich
undproduktivzu arbeiten,
den Geschmack des einzel-
nen ganz unbewußt zu
heben, nicht ihn etwa be-
lehren wollen, sondern
durch schöne Formen un-
bewußt führen, damit jene
Atmosphäre des Ge-
schmacks, von der oben
gesprochen wurde, auch
unsere Volksgemeinschaft
durch und durch ergreift.
Noch ein Wort über
die Einzelheiten, soweit
es namentlich vom Stand-
punkte der Verbindung
von Form undOrnament,
von Verhältnis der allge-
meinen Kultur und Objekt
von Bedeutung ist. Es wurde schon am Eingang des
Artikels darauf hingewiesen, daß im allgemeinen von
den Künstlern Formen gewählt wurden, die irgend
einem symmetrischen Prinzip folgen. Ebenso ist darauf
aufmerksam gemacht worden, daß das Ornament die-
ses symmetrische Prinzip nicht mitmacht, wenigstens
•licht in der parallelen Strenge zu den Proportionen
der reinen Form des Gefäßes. Man kann dies schon
auf den ältesten Vasenbildern beobachten, die durch
'hren herb linearen Charakter allerdings den Eindrudc
des Unregelmäßigen verwischen und nur als strenger
Stil auf der Fläche erscheinen. Wer die Entwicklung
mancher moderner Meister sorgsam beobachtet, wird
finden, daß dieser lineare Stil der Vasenbilder in der
EIMER IN SILBER.
modernen Malerei und auf kunstgewerblichem Gebiet
in Stidterei und Weberei, überhaupt in der Textil-
kunst, großen Einfluß ausgeübt hat, nicht zu ver-
schweigen den Vorstoß, den das Stilprinzip der an-
tiken Vase neuerdings auf die Reform der Bühnen-
kunst mancherorts unternommen. Wir führen diese
Einflüsse besonders deswegen an, weil sie zeigen, daß
die Formen der Vergangenheit nicht bloß abgeschlos-
sene Reihen einer erledigten Periode sind, wie die ex-
tremen Ultra-Modernisten, soweit sie namentlich von
Neurußland beeinflußt
sind, behaupten, ander-
seits aber auch nicht ledig*
lieh Vorlagen, die man
mehr oder weniger kopiert
und umformt. Die richtig
verstandene Verbindung
mit den großenErrungen-
schaften der Vorzeit be-
steht in allererster Linie
im Verstehen des Geistes,
des Fühlens, des Wollens
der betreffenden Periode
und wenn sich dabei Ver«
wandtsdiaften mit heuti-
gen Stimmungen usw. er-
geben, so wird sich das
ganz von selbst in der
Verwandtschaft bestimm-
ter künstlerischer Aus-
drucksformen zeigen.
Im weiteren Verlauf
der römischen Gefäßkunst
wirkte die griechische
Freude am Vollrelief auf
die römischen Künstler
ein. Ursprünglich stand
alle Kunst im Dienste der
Religion. Der Tempel mußte daher in seinem Auf-
bau unter allen Umständen mit der Proportion, der
Horizontale und Vertikale auskommen und man
sieht aus den ältesten Metopen <z. B. Selinunt), daß
diese stark lineare Richtung auch die Plastik beein-
flußt hat. Unsere größten Ästheten nennen diese
Periode der Kunst, die nur mehr in der romanischen
und frühgotischen Periode ein Gegenstüdi und in den
modernen Futuristen eine mehr oder weniger glück-
liche Reprise hat, das goldene Zeitalter der Kunst.
Die Griechen sind bekanntlich davon abgewichen und
haben seit Praxiteles dem Prinzip der vollrunden Kör-
perlichkeit gehuldigt, die namentlich auf Münzen die
größten künstlerischen Blüten gezeitigt hat. Römischen
Museo Nazionale Neapel.
59