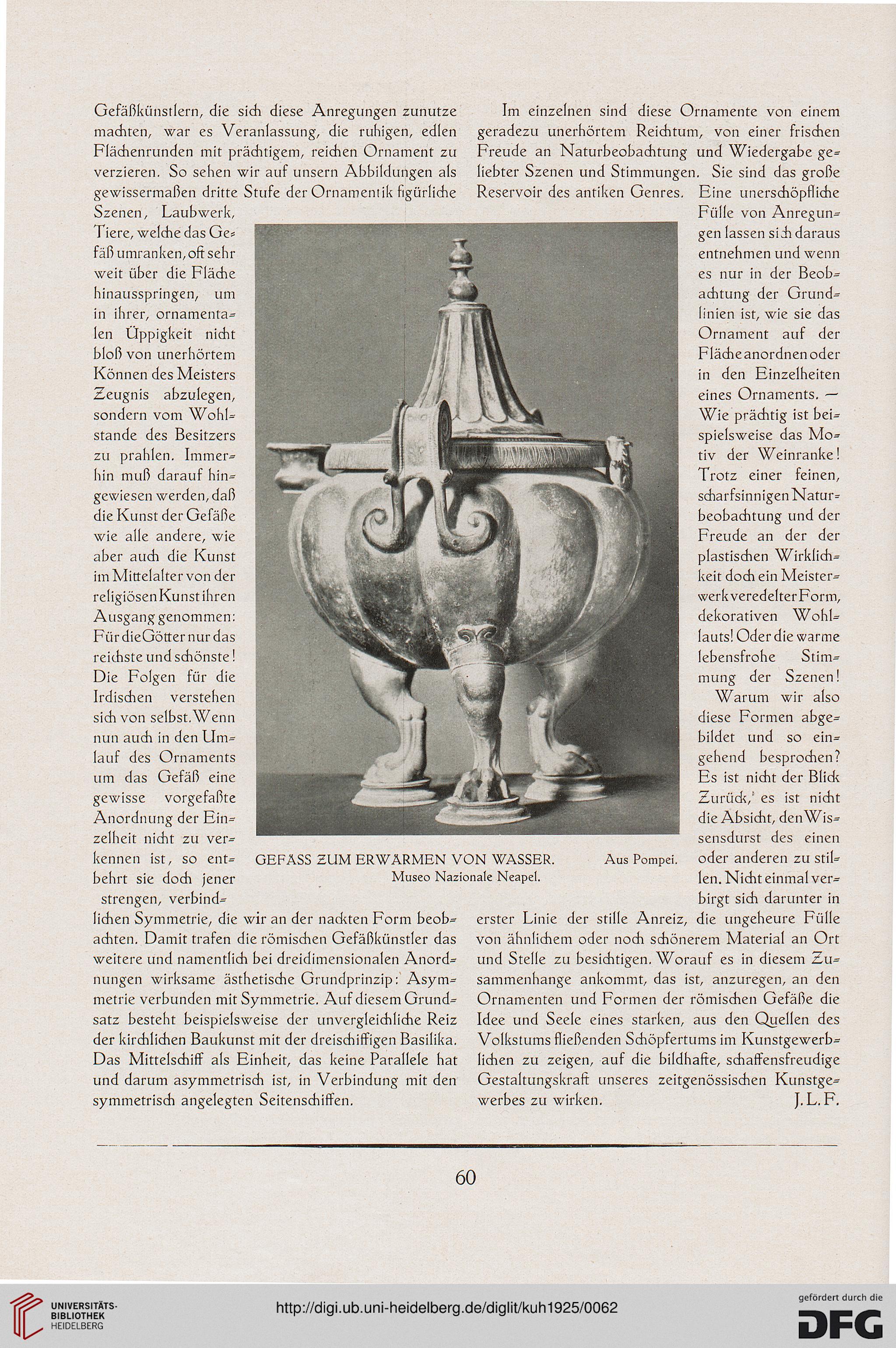Gefäßkünstlern, die sich diese Anregungen zunutze
machten, war es Veranlassung, die ruhigen, edlen
Flächenrunden mit prächtigem, reichen Ornament zu
verzieren. So sehen wir auf unsern Abbildungen als
gewissermaßen dritte Stufe der Ornamentik figürliche
Szenen, Laubwerk,
Tiere, welche das Ge-
faß umranken, oft sehr
weit über die Fläche
hinausspringen, um
in ihrer, ornamental
len Üppigkeit nicht
bloß von unerhörtem
Können des Meisters
Zeugnis abzulegen,
sondern vom Wohl»
stände des Besitzers
zu prahlen. Immer»
hin muß darauf hin»
gewiesen werden, daß
die Kunst der Gefäße
wie alle andere, wie
aber auch die Kunst
im Mittelalter von der
religiösen Kunst ihren
Ausgang genommen:
Für dieGötter nur das
reichste und schönste!
Die Folgen für die
Irdischen verstehen
sich von selbst. Wenn
nun auch in den Um»
lauf des Ornaments
um das Gefäß eine
gewisse vorgefaßte
Anordnung der Ein»
zelheit nicht zu ver»
GEFÄSS ZUM ERWÄRMEN VON WASSER
Museo Nazionale Neapel.
kennen ist, so ent»
behrt sie doch jener
strengen, verbind-
lichen Symmetrie, die wir an der nackten Form beob»
achten. Damit trafen die römischen Gefäßkünstler das
weitere und namentlich bei dreidimensionalen Anord»
nungen wirksame ästhetische Grundprinzip: Asym»
metrie verbunden mit Symmetrie. Auf diesem Grund»
satz besteht beispielsweise der unvergleichliche Reiz
der kirchlichen Baukunst mit der dreischiffigen Basilika.
Das Mittelschiff als Einheit, das keine Parallele hat
und darum asymmetrisch ist, in Verbindung mit den
symmetrisch angelegten Seitenschiffen.
Im einzelnen sind diese Ornamente von einem
geradezu unerhörtem Reichtum, von einer frischen
Freude an Naturbeobachtung und Wiedergabe ge»
liebter Szenen und Stimmungen. Sie sind das große
Reservoir des antiken Genres. Eine unerschöpfliche
Fülle von Anregun»
gen lassen siii daraus
entnehmen und wenn
es nur in der Beob»
achtung der Grund»
linien ist, wie sie das
Ornament auf der
Fläche anordnen oder
in den Einzelheiten
eines Ornaments. —
Wie prächtig ist bei-
spielsweise das Mo»
tiv der Weinranke!
Trotz einer feinen,
scharfsinnigen Natur»
beobachtung und der
Freude an der der
plastischen Wirklich»
keit doch ein Meister»
werk veredelter Form,
dekorativen Wohl»
lauts! Oder die warme
lebensfrohe Stirn»
mung der Szenen!
Warum wir also
diese Formen abge»
bildet und so ein»
gehend besprochen?
Es ist nicht der Blidc
Zurück,' es ist nicht
die Absicht, denWis»
sensdurst des einen
oder anderen zu stil»
len. Nidit einmal ver»
birgt sich darunter in
erster Linie der stille Anreiz, die ungeheure Fülle
von ähnlichem oder noch schönerem Material an Ort
und Stelle zu besichtigen. Worauf es in diesem Zu»
sammenhange ankommt, das ist, anzuregen, an den
Ornamenten und Formen der römischen Gefäße die
Idee und Seele eines starken, aus den Quellen des
Volkstums fließenden Schöpfertums im Kunstgewerb»
liehen zu zeigen, auf die bildhafte, schaffensfreudige
Gestaltungskraft unseres zeitgenössischen Kunstge»
werbes zu wirken. J. L. F.
Aus Pompei
60
machten, war es Veranlassung, die ruhigen, edlen
Flächenrunden mit prächtigem, reichen Ornament zu
verzieren. So sehen wir auf unsern Abbildungen als
gewissermaßen dritte Stufe der Ornamentik figürliche
Szenen, Laubwerk,
Tiere, welche das Ge-
faß umranken, oft sehr
weit über die Fläche
hinausspringen, um
in ihrer, ornamental
len Üppigkeit nicht
bloß von unerhörtem
Können des Meisters
Zeugnis abzulegen,
sondern vom Wohl»
stände des Besitzers
zu prahlen. Immer»
hin muß darauf hin»
gewiesen werden, daß
die Kunst der Gefäße
wie alle andere, wie
aber auch die Kunst
im Mittelalter von der
religiösen Kunst ihren
Ausgang genommen:
Für dieGötter nur das
reichste und schönste!
Die Folgen für die
Irdischen verstehen
sich von selbst. Wenn
nun auch in den Um»
lauf des Ornaments
um das Gefäß eine
gewisse vorgefaßte
Anordnung der Ein»
zelheit nicht zu ver»
GEFÄSS ZUM ERWÄRMEN VON WASSER
Museo Nazionale Neapel.
kennen ist, so ent»
behrt sie doch jener
strengen, verbind-
lichen Symmetrie, die wir an der nackten Form beob»
achten. Damit trafen die römischen Gefäßkünstler das
weitere und namentlich bei dreidimensionalen Anord»
nungen wirksame ästhetische Grundprinzip: Asym»
metrie verbunden mit Symmetrie. Auf diesem Grund»
satz besteht beispielsweise der unvergleichliche Reiz
der kirchlichen Baukunst mit der dreischiffigen Basilika.
Das Mittelschiff als Einheit, das keine Parallele hat
und darum asymmetrisch ist, in Verbindung mit den
symmetrisch angelegten Seitenschiffen.
Im einzelnen sind diese Ornamente von einem
geradezu unerhörtem Reichtum, von einer frischen
Freude an Naturbeobachtung und Wiedergabe ge»
liebter Szenen und Stimmungen. Sie sind das große
Reservoir des antiken Genres. Eine unerschöpfliche
Fülle von Anregun»
gen lassen siii daraus
entnehmen und wenn
es nur in der Beob»
achtung der Grund»
linien ist, wie sie das
Ornament auf der
Fläche anordnen oder
in den Einzelheiten
eines Ornaments. —
Wie prächtig ist bei-
spielsweise das Mo»
tiv der Weinranke!
Trotz einer feinen,
scharfsinnigen Natur»
beobachtung und der
Freude an der der
plastischen Wirklich»
keit doch ein Meister»
werk veredelter Form,
dekorativen Wohl»
lauts! Oder die warme
lebensfrohe Stirn»
mung der Szenen!
Warum wir also
diese Formen abge»
bildet und so ein»
gehend besprochen?
Es ist nicht der Blidc
Zurück,' es ist nicht
die Absicht, denWis»
sensdurst des einen
oder anderen zu stil»
len. Nidit einmal ver»
birgt sich darunter in
erster Linie der stille Anreiz, die ungeheure Fülle
von ähnlichem oder noch schönerem Material an Ort
und Stelle zu besichtigen. Worauf es in diesem Zu»
sammenhange ankommt, das ist, anzuregen, an den
Ornamenten und Formen der römischen Gefäße die
Idee und Seele eines starken, aus den Quellen des
Volkstums fließenden Schöpfertums im Kunstgewerb»
liehen zu zeigen, auf die bildhafte, schaffensfreudige
Gestaltungskraft unseres zeitgenössischen Kunstge»
werbes zu wirken. J. L. F.
Aus Pompei
60