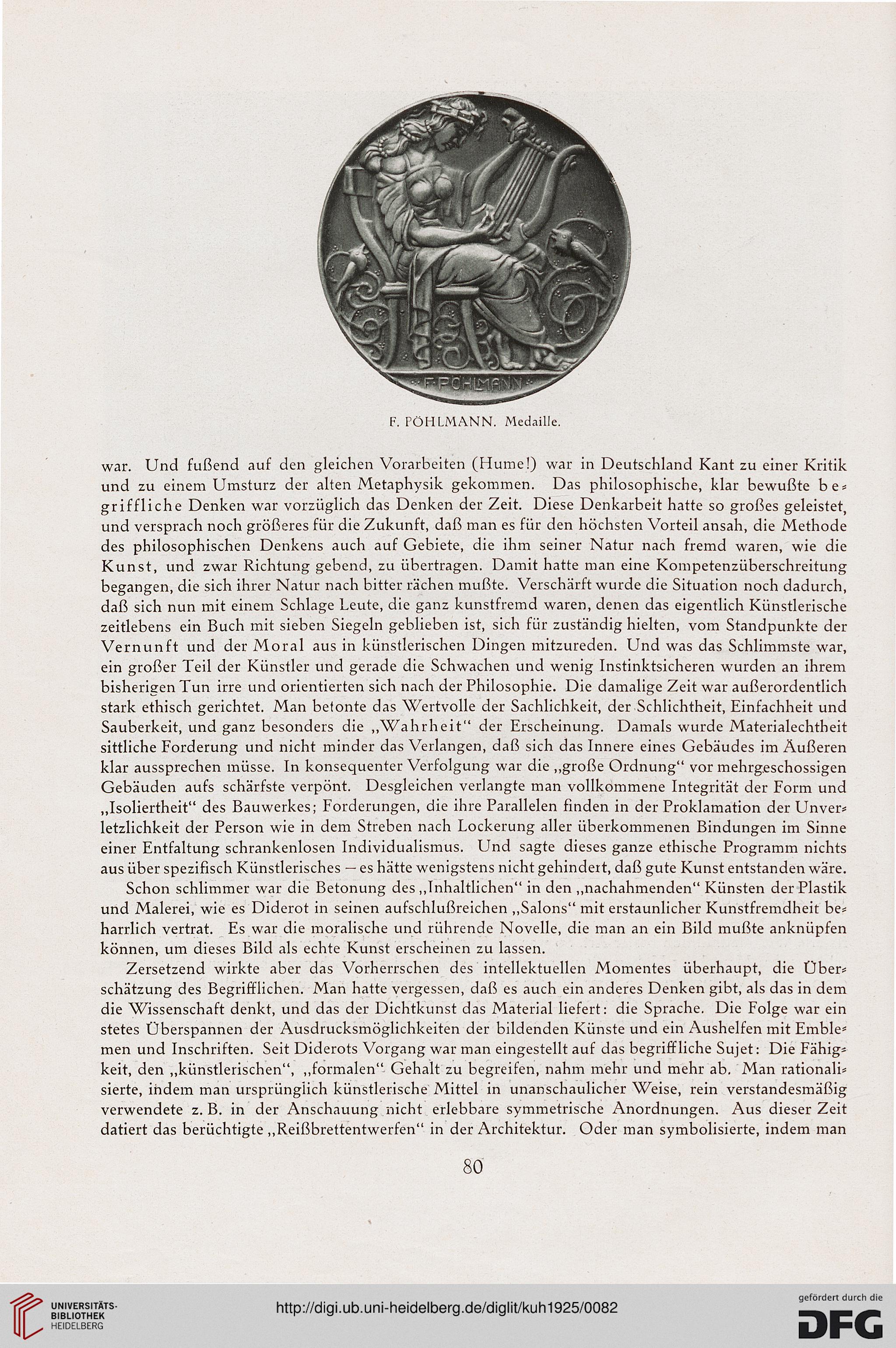F. PÖHLMANN. Medaille.
war. Und fußend auf den gleichen Vorarbeiten (Hume!) war in Deutschland Kant zu einer Kritik
und zu einem Umsturz der alten Metaphysik gekommen. Das philosophische, klar bewußte be -
griffliche Denken war vorzüglich das Denken der Zeit. Diese Denkarbeit hatte so großes geleistet,
und versprach noch größeres für die Zukunft, daß man es für den höchsten Vorteil ansah, die Methode
des philosophischen Denkens auch auf Gebiete, die ihm seiner Natur nach fremd waren, wie die
Kunst, und zwar Richtung gebend, zu übertragen. Damit hatte man eine Kompetenzüberschreitung
begangen, die sich ihrer Natur nach bitter rächen mußte. Verschärft wurde die Situation noch dadurch,
daß sich nun mit einem Schlage Leute, die ganz kunstfremd waren, denen das eigentlich Künstlerische
zeitlebens ein Buch mit sieben Siegeln geblieben ist, sich für zuständig hielten, vom Standpunkte der
Vernunft und der Moral aus in künstlerischen Dingen mitzureden. Und was das Schlimmste war,
ein großer Teil der Künstler und gerade die Schwachen und wenig Instinktsicheren wurden an ihrem
bisherigen Tun irre und orientierten sich nach der Philosophie. Die damalige Zeit war außerordentlich
stark ethisch gerichtet. Man betonte das Wertvolle der Sachlichkeit, der Schlichtheit, Einfachheit und
Sauberkeit, und ganz besonders die „Wahrheit" der Erscheinung. Damals wurde Materialechtheit
sittliche Forderung und nicht minder das Verlangen, daß sich das Innere eines Gebäudes im Äußeren
klar aussprechen müsse. In konsequenter Verfolgung war die „große Ordnung" vor mehrgeschossigen
Gebäuden aufs schärfste verpönt. Desgleichen verlangte man vollkommene Integrität der Form und
„Isoliertheit" des Bauwerkes; Forderungen, die ihre Parallelen finden in der Proklamation der Unver*
letzlichkeit der Person wie in dem Streben nach Lockerung aller überkommenen Bindungen im Sinne
einer Entfaltung schrankenlosen Individualismus. Und sagte dieses ganze ethische Programm nichts
aus über spezifisch Künstlerisches — es hätte wenigstens nicht gehindert, daß gute Kunst entstanden wäre.
Schon schlimmer war die Betonung des „Inhaltlichen" in den „nachahmenden" Künsten der Plastik
und Malerei, wie es Diderot in seinen aufschlußreichen „Salons" mit erstaunlicher Kunstfremdheit be-
harrlich vertrat. Es war die moralische und rührende Novelle, die man an ein Bild mußte anknüpfen
können, um dieses Bild als echte Kunst erscheinen zu lassen.
Zersetzend wirkte aber das Vorherrschen des intellektuellen Momentes überhaupt, die Über*
Schätzung des Begrifflichen. Man hatte vergessen, daß es auch ein anderes Denken gibt, als das in dem
die Wissenschaft denkt, und das der Dichtkunst das Material liefert: die Sprache. Die Folge war ein
stetes Überspannen der Ausdrucksmöglichkeiten der bildenden Künste und ein Aushelfen mit Emble*
men und Inschriften. Seit Diderots Vorgang war man eingestellt auf das begriffliche Sujet: Die Fähig-
keit, den „künstlerischen", „formalen" Gehalt zu begreifen, nahm mehr und mehr ab. Man rational^
sierte, indem man ursprünglich künstlerische Mittel in unanschaulicher Weise, rein verstandesmäßig
verwendete z. B. in der Anschauung nicht erlebbare symmetrische Anordnungen. Aus dieser Zeit
datiert das berüchtigte „Reißbrettentwerfen" in der Architektur. Oder man symbolisierte, indem man
80
war. Und fußend auf den gleichen Vorarbeiten (Hume!) war in Deutschland Kant zu einer Kritik
und zu einem Umsturz der alten Metaphysik gekommen. Das philosophische, klar bewußte be -
griffliche Denken war vorzüglich das Denken der Zeit. Diese Denkarbeit hatte so großes geleistet,
und versprach noch größeres für die Zukunft, daß man es für den höchsten Vorteil ansah, die Methode
des philosophischen Denkens auch auf Gebiete, die ihm seiner Natur nach fremd waren, wie die
Kunst, und zwar Richtung gebend, zu übertragen. Damit hatte man eine Kompetenzüberschreitung
begangen, die sich ihrer Natur nach bitter rächen mußte. Verschärft wurde die Situation noch dadurch,
daß sich nun mit einem Schlage Leute, die ganz kunstfremd waren, denen das eigentlich Künstlerische
zeitlebens ein Buch mit sieben Siegeln geblieben ist, sich für zuständig hielten, vom Standpunkte der
Vernunft und der Moral aus in künstlerischen Dingen mitzureden. Und was das Schlimmste war,
ein großer Teil der Künstler und gerade die Schwachen und wenig Instinktsicheren wurden an ihrem
bisherigen Tun irre und orientierten sich nach der Philosophie. Die damalige Zeit war außerordentlich
stark ethisch gerichtet. Man betonte das Wertvolle der Sachlichkeit, der Schlichtheit, Einfachheit und
Sauberkeit, und ganz besonders die „Wahrheit" der Erscheinung. Damals wurde Materialechtheit
sittliche Forderung und nicht minder das Verlangen, daß sich das Innere eines Gebäudes im Äußeren
klar aussprechen müsse. In konsequenter Verfolgung war die „große Ordnung" vor mehrgeschossigen
Gebäuden aufs schärfste verpönt. Desgleichen verlangte man vollkommene Integrität der Form und
„Isoliertheit" des Bauwerkes; Forderungen, die ihre Parallelen finden in der Proklamation der Unver*
letzlichkeit der Person wie in dem Streben nach Lockerung aller überkommenen Bindungen im Sinne
einer Entfaltung schrankenlosen Individualismus. Und sagte dieses ganze ethische Programm nichts
aus über spezifisch Künstlerisches — es hätte wenigstens nicht gehindert, daß gute Kunst entstanden wäre.
Schon schlimmer war die Betonung des „Inhaltlichen" in den „nachahmenden" Künsten der Plastik
und Malerei, wie es Diderot in seinen aufschlußreichen „Salons" mit erstaunlicher Kunstfremdheit be-
harrlich vertrat. Es war die moralische und rührende Novelle, die man an ein Bild mußte anknüpfen
können, um dieses Bild als echte Kunst erscheinen zu lassen.
Zersetzend wirkte aber das Vorherrschen des intellektuellen Momentes überhaupt, die Über*
Schätzung des Begrifflichen. Man hatte vergessen, daß es auch ein anderes Denken gibt, als das in dem
die Wissenschaft denkt, und das der Dichtkunst das Material liefert: die Sprache. Die Folge war ein
stetes Überspannen der Ausdrucksmöglichkeiten der bildenden Künste und ein Aushelfen mit Emble*
men und Inschriften. Seit Diderots Vorgang war man eingestellt auf das begriffliche Sujet: Die Fähig-
keit, den „künstlerischen", „formalen" Gehalt zu begreifen, nahm mehr und mehr ab. Man rational^
sierte, indem man ursprünglich künstlerische Mittel in unanschaulicher Weise, rein verstandesmäßig
verwendete z. B. in der Anschauung nicht erlebbare symmetrische Anordnungen. Aus dieser Zeit
datiert das berüchtigte „Reißbrettentwerfen" in der Architektur. Oder man symbolisierte, indem man
80