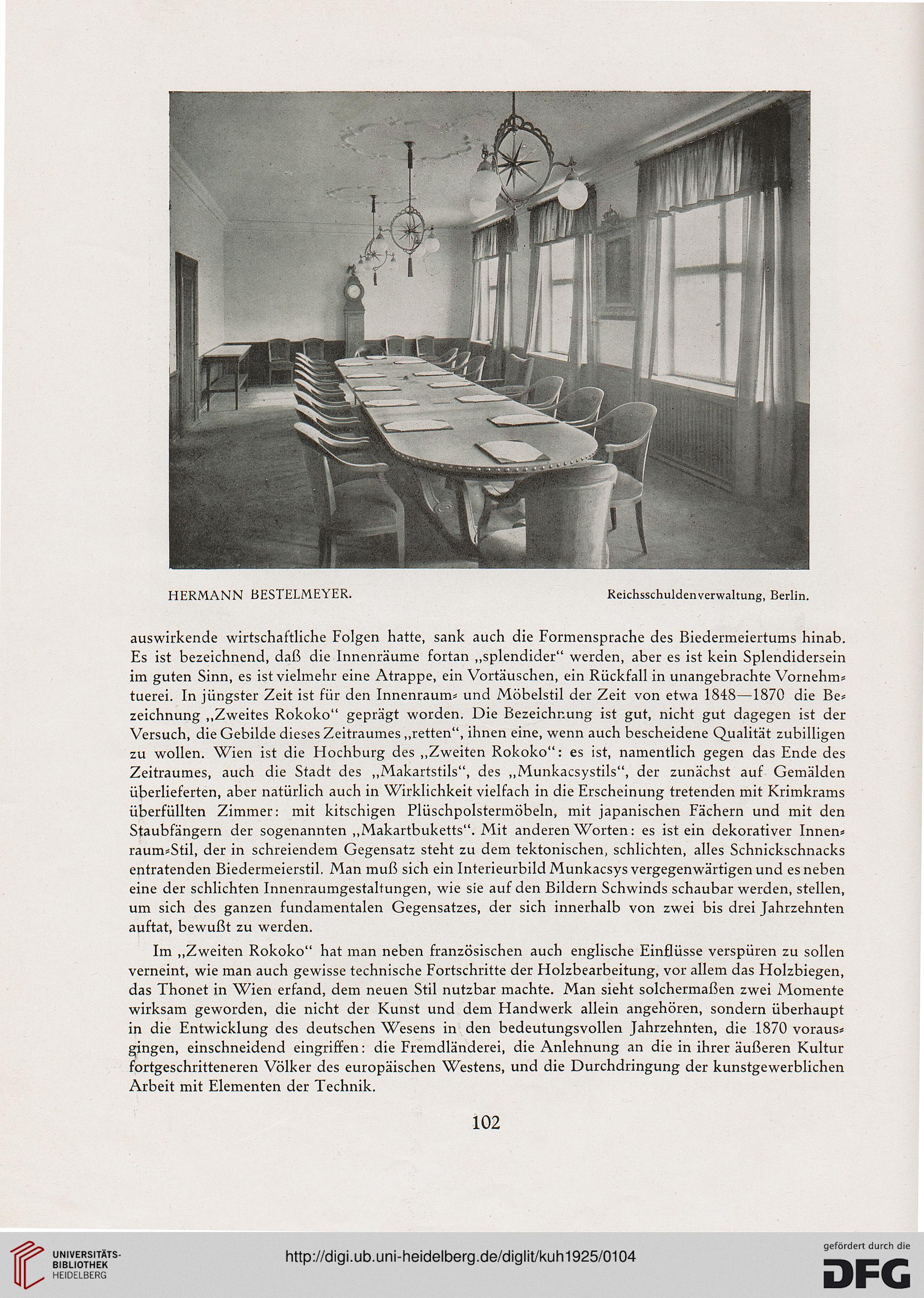HERMANN BESTELMEYER.
Reichsschulden Verwaltung, Berlin.
auswirkende wirtschaftliche Folgen hatte, sank auch die Formensprache des Biedermeiertums hinab.
Es ist bezeichnend, daß die Innenräume fortan „splendider" werden, aber es ist kein Splendidersein
im guten Sinn, es ist vielmehr eine Atrappe, ein Vortäuschen, ein Rückfall in unangebrachte Vornehm*
tuerei. In jüngster Zeit ist für den Innenraum* und Möbelstil der Zeit von etwa 1848—1870 die Be*
Zeichnung „Zweites Rokoko" geprägt worden. Die Bezeichnung ist gut, nicht gut dagegen ist der
Versuch, die Gebilde dieses Zeitraumes „retten", ihnen eine, wenn auch bescheidene Qualität zubilligen
zu wollen. Wien ist die Hochburg des „Zweiten Rokoko": es ist, namentlich gegen das Ende des
Zeitraumes, auch die Stadt des „Makartstils", des „Munkacsystils", der zunächst auf Gemälden
überlieferten, aber natürlich auch in Wirklichkeit vielfach in die Erscheinung tretenden mit Krimkrams
überfüllten Zimmer: mit kitschigen Plüschpolstermöbeln, mit japanischen Fächern und mit den
Staubfängern der sogenannten „Makartbuketts". Mit anderen Worten: es ist ein dekorativer Innen*
raum*Stil, der in schreiendem Gegensatz steht zu dem tektonischen, schlichten, alles Schnickschnacks
entratenden Biedermeierstil. Man muß sich ein Interieurbild Munkacsys vergegenwärtigen und es neben
eine der schlichten Innenraumgestaltungen, wie sie auf den Bildern Schwinds schaubar werden, stellen,
um sich des ganzen fundamentalen Gegensatzes, der sich innerhalb von zwei bis drei Jahrzehnten
auftat, bewußt zu werden.
Im „Zweiten Rokoko" hat man neben französischen auch englische Einflüsse verspüren zu sollen
verneint, wie man auch gewisse technische Fortschritte der Holzbearbeitung, vor allem das Holzbiegen,
das Thonet in Wien erfand, dem neuen Stil nutzbar machte. Man sieht solchermaßen zwei Momente
wirksam geworden, die nicht der Kunst und dem Handwerk allein angehören, sondern überhaupt
in die Entwicklung des deutschen Wesens in den bedeutungsvollen Jahrzehnten, die 1870 voraus*
gingen, einschneidend eingriffen: die Fremdländerei, die Anlehnung an die in ihrer äußeren Kultur
fortgeschritteneren Völker des europäischen Westens, und die Durchdringung der kunstgewerblichen
Arbeit mit Elementen der Technik.
102
Reichsschulden Verwaltung, Berlin.
auswirkende wirtschaftliche Folgen hatte, sank auch die Formensprache des Biedermeiertums hinab.
Es ist bezeichnend, daß die Innenräume fortan „splendider" werden, aber es ist kein Splendidersein
im guten Sinn, es ist vielmehr eine Atrappe, ein Vortäuschen, ein Rückfall in unangebrachte Vornehm*
tuerei. In jüngster Zeit ist für den Innenraum* und Möbelstil der Zeit von etwa 1848—1870 die Be*
Zeichnung „Zweites Rokoko" geprägt worden. Die Bezeichnung ist gut, nicht gut dagegen ist der
Versuch, die Gebilde dieses Zeitraumes „retten", ihnen eine, wenn auch bescheidene Qualität zubilligen
zu wollen. Wien ist die Hochburg des „Zweiten Rokoko": es ist, namentlich gegen das Ende des
Zeitraumes, auch die Stadt des „Makartstils", des „Munkacsystils", der zunächst auf Gemälden
überlieferten, aber natürlich auch in Wirklichkeit vielfach in die Erscheinung tretenden mit Krimkrams
überfüllten Zimmer: mit kitschigen Plüschpolstermöbeln, mit japanischen Fächern und mit den
Staubfängern der sogenannten „Makartbuketts". Mit anderen Worten: es ist ein dekorativer Innen*
raum*Stil, der in schreiendem Gegensatz steht zu dem tektonischen, schlichten, alles Schnickschnacks
entratenden Biedermeierstil. Man muß sich ein Interieurbild Munkacsys vergegenwärtigen und es neben
eine der schlichten Innenraumgestaltungen, wie sie auf den Bildern Schwinds schaubar werden, stellen,
um sich des ganzen fundamentalen Gegensatzes, der sich innerhalb von zwei bis drei Jahrzehnten
auftat, bewußt zu werden.
Im „Zweiten Rokoko" hat man neben französischen auch englische Einflüsse verspüren zu sollen
verneint, wie man auch gewisse technische Fortschritte der Holzbearbeitung, vor allem das Holzbiegen,
das Thonet in Wien erfand, dem neuen Stil nutzbar machte. Man sieht solchermaßen zwei Momente
wirksam geworden, die nicht der Kunst und dem Handwerk allein angehören, sondern überhaupt
in die Entwicklung des deutschen Wesens in den bedeutungsvollen Jahrzehnten, die 1870 voraus*
gingen, einschneidend eingriffen: die Fremdländerei, die Anlehnung an die in ihrer äußeren Kultur
fortgeschritteneren Völker des europäischen Westens, und die Durchdringung der kunstgewerblichen
Arbeit mit Elementen der Technik.
102