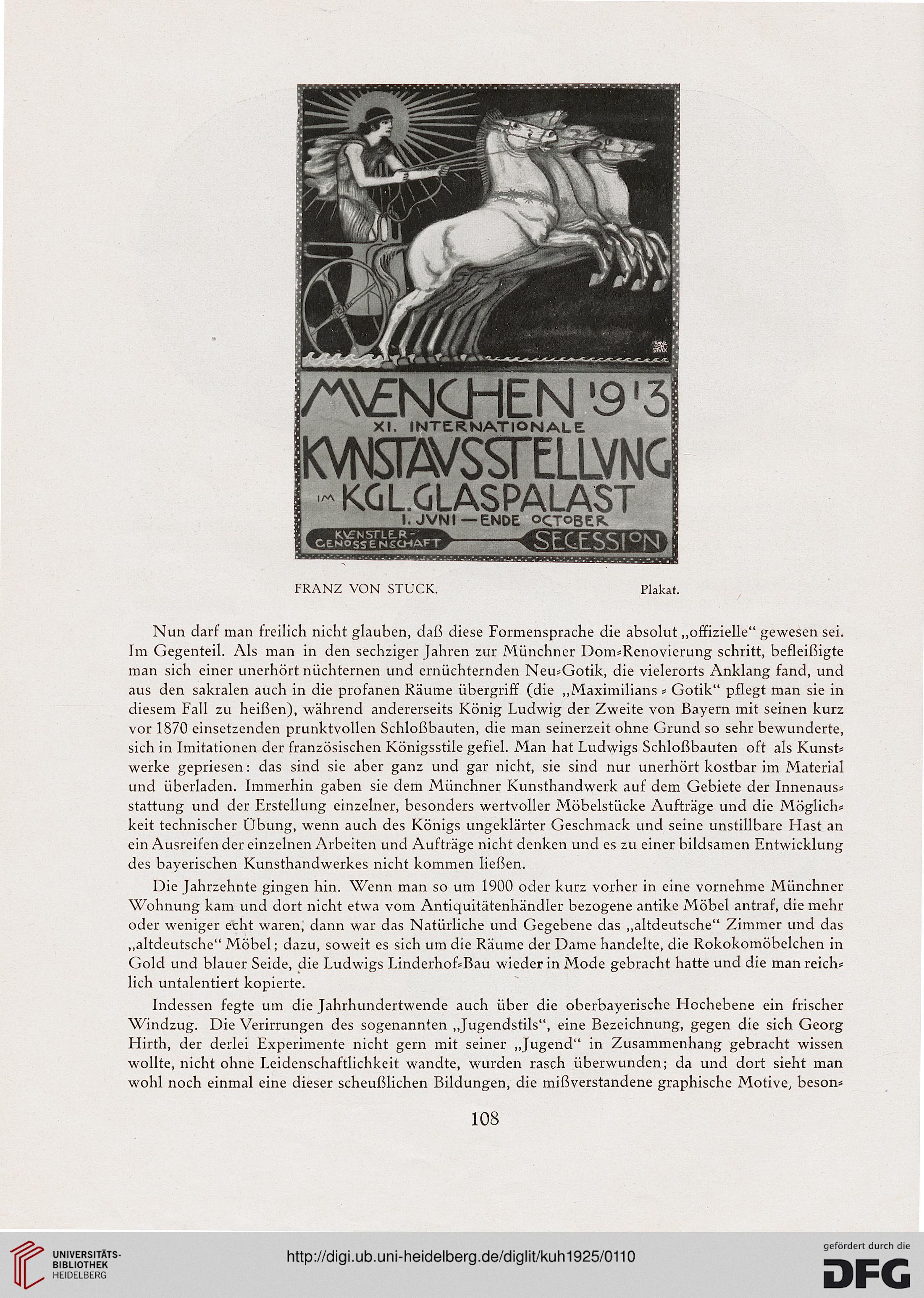XI. INTERNATIONALE
KVNSTAVSSTELLVN
l/A
KGLGLASPALAST
_I. JVNI — ENDE OCTQBER
FRANZ VON STUCK. Plakat.
Nun darf man freilich nicht glauben, daß diese Formensprache die absolut „offizielle" gewesen sei.
Im Gegenteil. Als man in den sechziger Jahren zur Münchner Dom*Renovierung schritt, befleißigte
man sich einer unerhört nüchternen und ernüchternden Neu*Gotik, die vielerorts Anklang fand, und
aus den sakralen auch in die profanen Räume übergriff (die „Maximilians * Gotik" pflegt man sie in
diesem Fall zu heißen), während andererseits König Ludwig der Zweite von Bayern mit seinen kurz
vor 1870 einsetzenden prunktvollen Schloßbauten, die man seinerzeit ohne Grund so sehr bewunderte,
sich in Imitationen der französischen Königsstile gefiel. Man hat Ludwigs Schloßbauten oft als Kunst*
werke gepriesen: das sind sie aber ganz und gar nicht, sie sind nur unerhört kostbar im Material
und überladen. Immerhin gaben sie dem Münchner Kunsthandwerk auf dem Gebiete der Innenaus*
stattung und der Erstellung einzelner, besonders wertvoller Möbelstücke Aufträge und die Möglich*
keit technischer Übung, wenn auch des Königs ungeklärter Geschmack und seine unstillbare Hast an
ein Ausreifen der einzelnen Arbeiten und Aufträge nicht denken und es zu einer bildsamen Entwicklung
des bayerischen Kunsthandwerkes nicht kommen ließen.
Die Jahrzehnte gingen hin. Wenn man so um 1900 oder kurz vorher in eine vornehme Münchner
Wohnung kam und dort nicht etwa vom Antiquitätenhändler bezogene antike Möbel antraf, die mehr
oder weniger echt waren; dann war das Natürliche und Gegebene das „altdeutsche" Zimmer und das
„altdeutsche" Möbel; dazu, soweit es sich um die Räume der Dame handelte, die Rokokomöbelchen in
Gold und blauer Seide, die Ludwigs Linderhof*Bau wieder in Mode gebracht hatte und die man reich*
lieh untalentiert kopierte.
Indessen fegte um die Jahrhundertwende auch über die oberbayerische Hochebene ein frischer
Windzug. Die Verirrungen des sogenannten „Jugendstils", eine Bezeichnung, gegen die sich Georg
Hirth, der derlei Experimente nicht gern mit seiner „Jugend" in Zusammenhang gebracht wissen
wollte, nicht ohne Leidenschaftlichkeit wandte, wurden rasch überwunden; da und dort sieht man
wohl noch einmal eine dieser scheußlichen Bildungen, die mißverstandene graphische Motive, beson*
108
KVNSTAVSSTELLVN
l/A
KGLGLASPALAST
_I. JVNI — ENDE OCTQBER
FRANZ VON STUCK. Plakat.
Nun darf man freilich nicht glauben, daß diese Formensprache die absolut „offizielle" gewesen sei.
Im Gegenteil. Als man in den sechziger Jahren zur Münchner Dom*Renovierung schritt, befleißigte
man sich einer unerhört nüchternen und ernüchternden Neu*Gotik, die vielerorts Anklang fand, und
aus den sakralen auch in die profanen Räume übergriff (die „Maximilians * Gotik" pflegt man sie in
diesem Fall zu heißen), während andererseits König Ludwig der Zweite von Bayern mit seinen kurz
vor 1870 einsetzenden prunktvollen Schloßbauten, die man seinerzeit ohne Grund so sehr bewunderte,
sich in Imitationen der französischen Königsstile gefiel. Man hat Ludwigs Schloßbauten oft als Kunst*
werke gepriesen: das sind sie aber ganz und gar nicht, sie sind nur unerhört kostbar im Material
und überladen. Immerhin gaben sie dem Münchner Kunsthandwerk auf dem Gebiete der Innenaus*
stattung und der Erstellung einzelner, besonders wertvoller Möbelstücke Aufträge und die Möglich*
keit technischer Übung, wenn auch des Königs ungeklärter Geschmack und seine unstillbare Hast an
ein Ausreifen der einzelnen Arbeiten und Aufträge nicht denken und es zu einer bildsamen Entwicklung
des bayerischen Kunsthandwerkes nicht kommen ließen.
Die Jahrzehnte gingen hin. Wenn man so um 1900 oder kurz vorher in eine vornehme Münchner
Wohnung kam und dort nicht etwa vom Antiquitätenhändler bezogene antike Möbel antraf, die mehr
oder weniger echt waren; dann war das Natürliche und Gegebene das „altdeutsche" Zimmer und das
„altdeutsche" Möbel; dazu, soweit es sich um die Räume der Dame handelte, die Rokokomöbelchen in
Gold und blauer Seide, die Ludwigs Linderhof*Bau wieder in Mode gebracht hatte und die man reich*
lieh untalentiert kopierte.
Indessen fegte um die Jahrhundertwende auch über die oberbayerische Hochebene ein frischer
Windzug. Die Verirrungen des sogenannten „Jugendstils", eine Bezeichnung, gegen die sich Georg
Hirth, der derlei Experimente nicht gern mit seiner „Jugend" in Zusammenhang gebracht wissen
wollte, nicht ohne Leidenschaftlichkeit wandte, wurden rasch überwunden; da und dort sieht man
wohl noch einmal eine dieser scheußlichen Bildungen, die mißverstandene graphische Motive, beson*
108