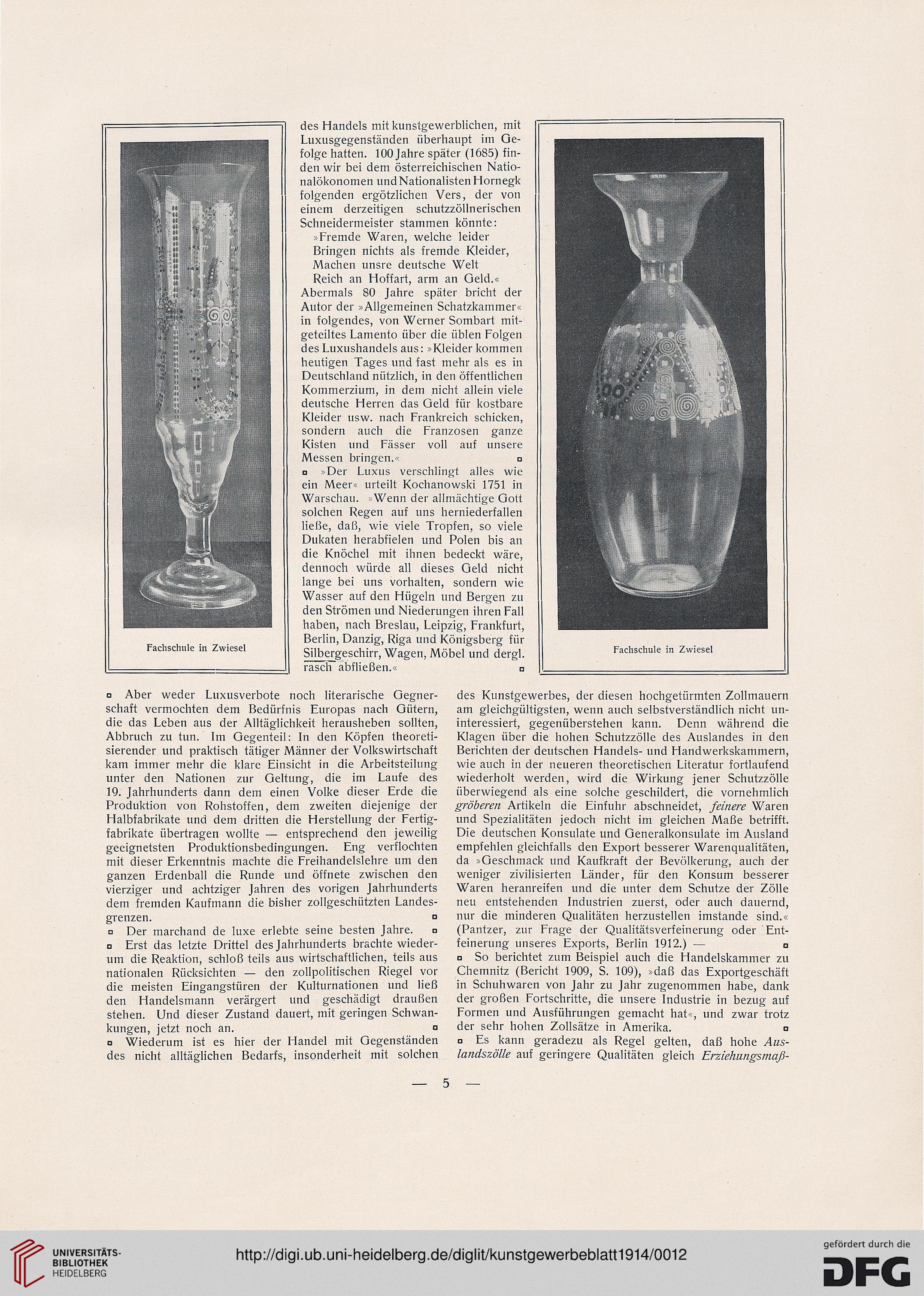des Handels mit kunstgewerblichen, mit
Luxusgegenständen überhaupt im Ge-
folge hatten. lOOJahre später (1685) fin-
den wir bei dem österreichischen Natio-
nalökonomen und Nationalisten Hornegk
folgenden ergötzlichen Vers, der von
einem derzeitigen schutzzöllnerischen
Schneidermeister stammen könnte:
»Fremde Waren, welche leider
Bringen nichts als fremde Kleider,
Machen unsre deutsche Welt
Reich an Hoffart, arm an Geld.«
Abermals 80 Jahre später bricht der
Autor der »Allgemeinen Schatzkammer«
in folgendes, von Werner Sombart mit-
geteiites Lamento über die üblen Folgen
des Luxushandels aus: »Kleider kommen
heutigen Tages und fast mehr als es in
Deutschland nützlich, in den öffentlichen
Kommerzium, in dem nicht allein viele
deutsche Herren das Geld für kostbare
Kleider usw. nach Frankreich schicken,
sondern auch die Franzosen ganze
Kisten und Fässer voll auf unsere
Messen bringen.« □
n »Der Luxus verschlingt alles wie
ein Meer« urteilt Kochanowski 1751 in
Warschau. »Wenn der allmächtige Gott
solchen Regen auf uns herniederfallen
ließe, daß, wie viele Tropfen, so viele
Dukaten herabfielen und Polen bis an
die Knöchel mit ihnen bedeckt wäre,
dennoch würde all dieses Geld nicht
lange bei uns Vorhalten, sondern wie
Wasser auf den Hügeln und Bergen zu
den Strömen und Niederungen ihren Fall
haben, nach Breslau, Leipzig, Frankfurt,
Berlin, Danzig, Riga und Königsberg für
Silbergeschirr, Wagen, Möbel und dergl.
rasch abfließen.« o
□ Aber weder Luxusverbote noch literarische Gegner-
schaft vermochten dem Bedürfnis Europas nach Gütern,
die das Leben aus der Alltäglichkeit herausheben sollten,
Abbruch zu tun. Im Gegenteil: In den Köpfen theoreti-
sierender und praktisch tätiger Männer der Volkswirtschaft
kam immer mehr die klare Einsicht in die Arbeitsteilung
unter den Nationen zur Geltung, die im Laufe des
19. Jahrhunderts dann dem einen Volke dieser Erde die
Produktion von Rohstoffen, dem zweiten diejenige der
Halbfabrikate und dem dritten die Herstellung der Fertig-
fabrikate übertragen wollte — entsprechend den jeweilig
geeignetsten Produktionsbedingungen. Eng verflochten
mit dieser Erkenntnis machte die Freihandelslehre um den
ganzen Erdenball die Runde und öffnete zwischen den
vierziger und achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
dem fremden Kaufmann die bisher zollgeschützten Landes-
grenzen. °
□ Der marchand de luxe erlebte seine besten Jahre. n
□ Erst das letzte Drittel des Jahrhunderts brachte wieder-
um die Reaktion, schloß teils aus wirtschaftlichen, teils aus
nationalen Rücksichten — den zollpolitischen Riegel vor
die meisten Eingangstüren der Kulturnationen und ließ
den Llandelsmann verärgert und geschädigt draußen
stehen. Und dieser Zustand dauert, mit geringen Schwan-
kungen, jetzt noch an. °
□ Wiederum ist es hier der Handel mit Gegenständen
des nicht alltäglichen Bedarfs, insonderheit mit solchen
des Kunstgewerbes, der diesen hochgetürmten Zollmauern
am gleichgültigsten, wenn auch selbstverständlich nicht un-
interessiert, gegenüberstehen kann. Denn während die
Klagen über die hohen Schutzzölle des Auslandes in den
Berichten der deutschen Handels- und Llandwerkskammern,
wie auch in der neueren theoretischen Literatur fortlaufend
wiederholt werden, wird die Wirkung jener Schutzzölle
überwiegend als eine solche geschildert, die vornehmlich
gröberen Artikeln die Einfuhr abschneidet, feinere Waren
und Spezialitäten jedoch nicht im gleichen Maße betrifft.
Die deutschen Konsulate und Generalkonsulate im Ausland
empfehlen gleichfalls den Export besserer Warenqualitäten,
da »Geschmack und Kaufkraft der Bevölkerung, auch der
weniger zivilisierten Länder, für den Konsum besserer
Waren heranreifen und die unter dem Schutze der Zölle
neu entstehenden Industrien zuerst, oder auch dauernd,
nur die minderen Qualitäten herzustellen imstande sind.«
(Pantzer, zur Frage der Qualitätsverfeinerung oder Ent-
feinerung unseres Exports, Berlin 1912.) — n
□ So berichtet zum Beispiel auch die Handelskammer zu
Chemnitz (Bericht 1909, S. 109), »daß das Exportgeschäft
in Schuhwaren von Jahr zu Jahr zugenommen habe, dank
der großen Fortschritte, die unsere Industrie in bezug auf
Formen und Ausführungen gemacht hat«, und zwar trotz
der sehr hohen Zollsätze in Amerika. q
n Es kann geradezu als Regel gelten, daß hohe Aus-
landszölle auf geringere Qualitäten gleich Erziehungsmaß-
5