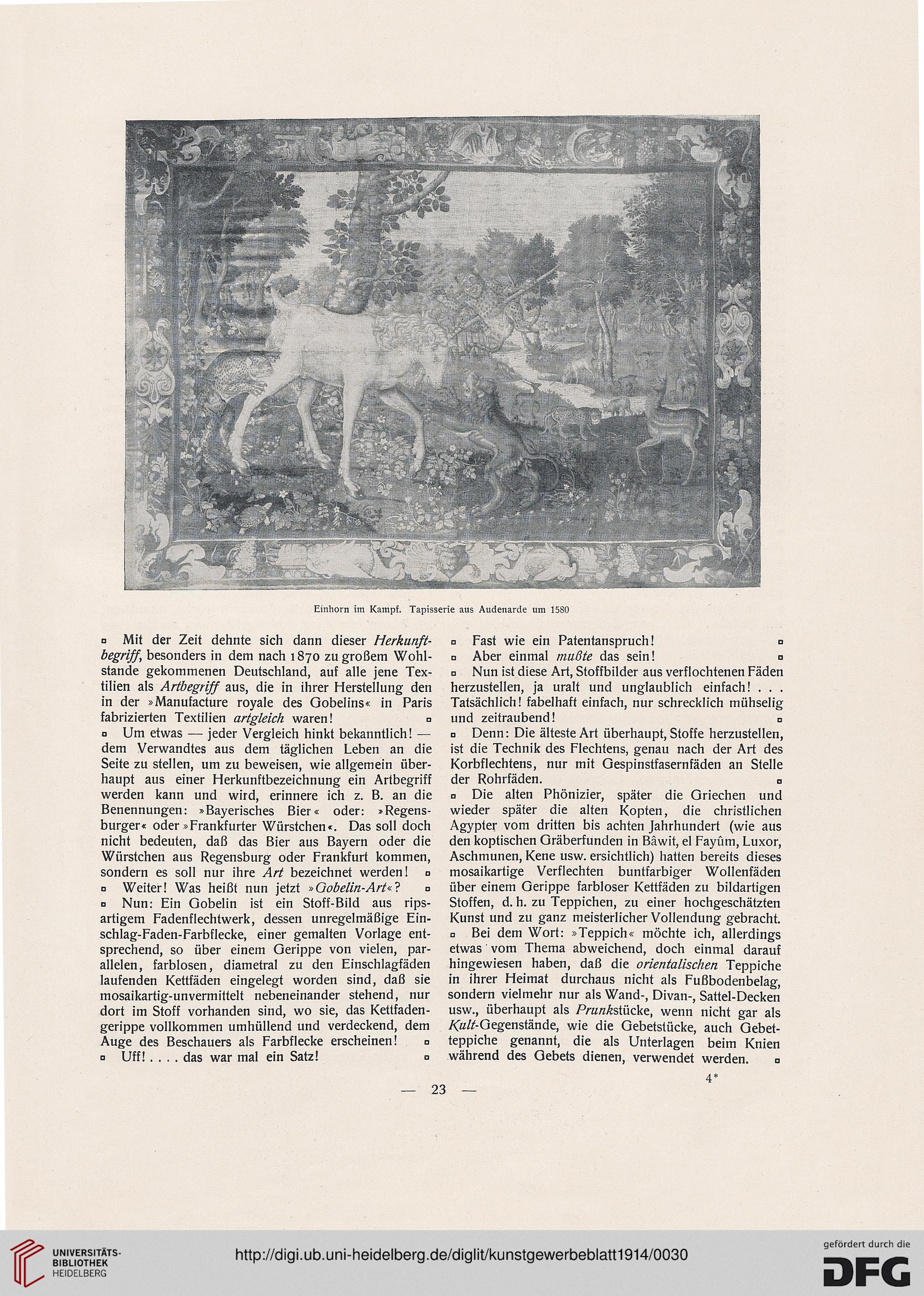Einhorn im Kampf. Tapisserie aus Audenarde um 1580
n Mit der Zeit dehnte sich dann dieser Herkunft-
begriff, besonders in dem nach 1870 zu großem Wohl-
stände gekommenen Deutschland, auf alle jene Tex-
tilien als Artbegriff aus, die in ihrer Herstellung den
in der »Manufacture royale des Gobelins« in Paris
fabrizierten Textilien artgleich waren! □
o Um etwas — jeder Vergleich hinkt bekanntlich! —
dem Verwandtes aus dem täglichen Leben an die
Seite zu stellen, um zu beweisen, wie allgemein über-
haupt aus einer Herkunftbezeichnung ein Artbegriff
werden kann und wird, erinnere ich z. B. an die
Benennungen: »Bayerisches Bier« oder: »Regens-
burger« oder »Frankfurter Würstchen«. Das soll doch
nicht bedeuten, daß das Bier aus Bayern oder die
Würstchen aus Regensburg oder Frankfurt kommen,
sondern es soll nur ihre Art bezeichnet werden! n
□ Weiter! Was heißt nun jetzt »Gobelin-Art«? n
□ Nun: Ein Gobelin ist ein Stoff-Bild aus rips-
artigem Fadenflechtwerk, dessen unregelmäßige Ein-
schlag-Faden-Farbflecke, einer gemalten Vorlage ent-
sprechend, so über einem Gerippe von vielen, par-
allelen, farblosen, diametral zu den Einschlagfäden
laufenden Kettfäden eingelegt worden sind, daß sie
mosaikartig-unvermittelt nebeneinander stehend, nur
dort im Stoff vorhanden sind, wo sie, das Kettfaden-
gerippe vollkommen umhüllend und verdeckend, dem
Auge des Beschauers als Farbflecke erscheinen! □
d Uff!.... das war mal ein Satz! □
a Fast wie ein Patentanspruch! o
□ Aber einmal mußte das sein! n
□ Nun ist diese Art, Stoffbilder aus verflochtenen Fäden
herzustellen, ja uralt und unglaublich einfach! . . .
Tatsächlich! fabelhaft einfach, nur schrecklich mühselig
und zeitraubend! □
□ Denn: Die älteste Art überhaupt, Stoffe herzustellen,
ist die Technik des Flechtens, genau nach der Art des
Korbflechtens, nur mit Gespinstfasernfäden an Stelle
der Rohrfäden. □
□ Die alten Phönizier, später die Griechen und
wieder später die alten Kopten, die christlichen
Ägypter vom dritten bis achten Jahrhundert (wie aus
den koptischen Gräberfunden in Bäwit, el Fayüm, Luxor,
Aschmunen, Kene usw. ersichtlich) hatten bereits dieses
mosaikartige Verflechten buntfarbiger Wollenfäden
über einem Gerippe farbloser Kettfäden zu bildartigen
Stoffen, d. h. zu Teppichen, zu einer hochgeschätzten
Kunst und zu ganz meisterlicher Vollendung gebracht.
□ Bei dem Wort: »Teppich« möchte ich, allerdings
etwas vom Thema abweichend, doch einmal darauf
hingewiesen haben, daß die orientalischen Teppiche
in ihrer Heimat durchaus nicht als Fußbodenbelag,
sondern vielmehr nur als Wand-, Divan-, Sattel-Decken
usw., überhaupt als /V«/z/estücke, wenn nicht gar als
/(«/^Gegenstände, wie die Gebetstücke, auch Gebet-
teppiche genannt, die als Unterlagen beim Knien
während des Gebets dienen, verwendet werden. »
23
4