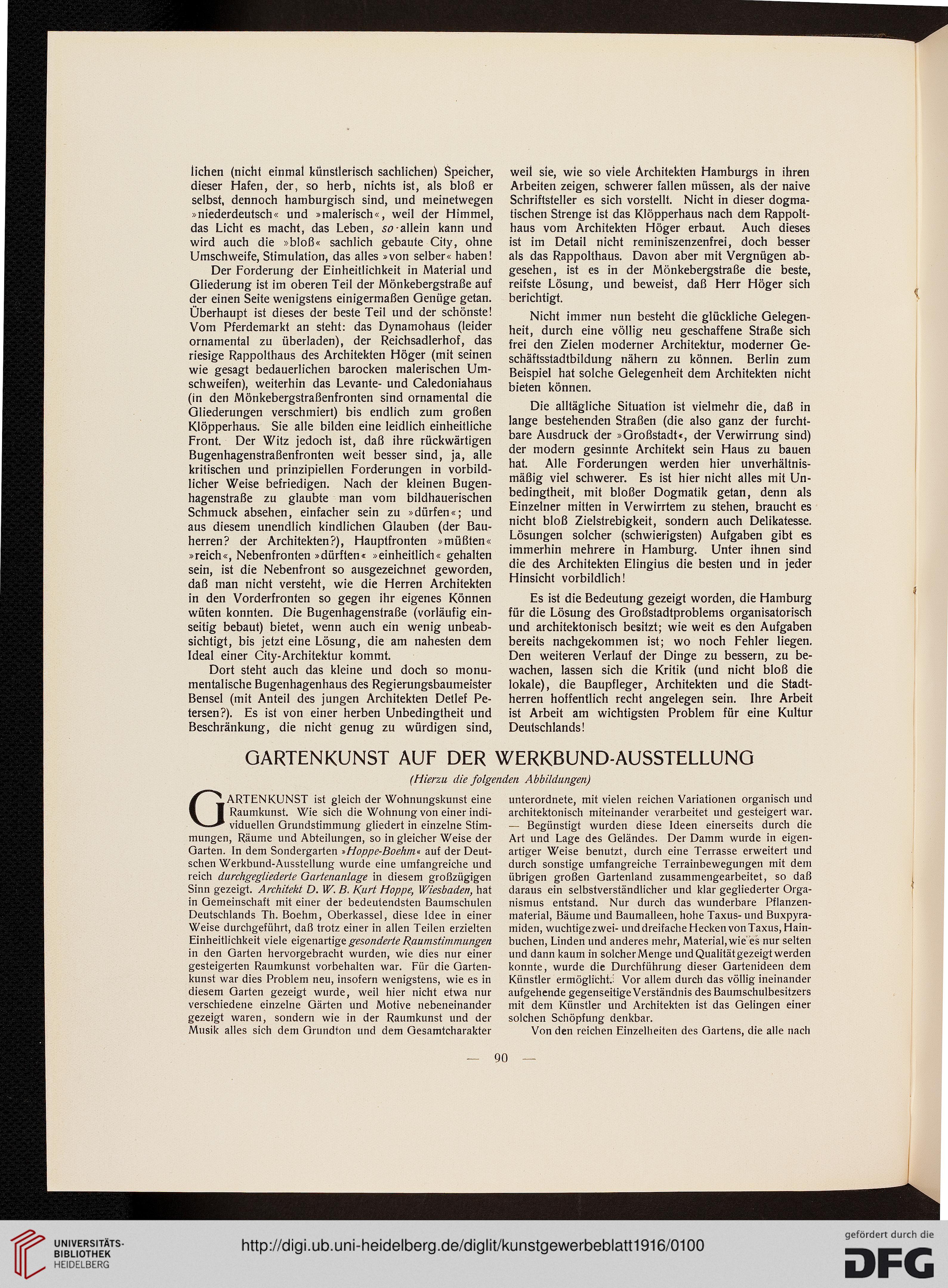liehen (nicht einmal künstlerisch sachlichen) Speicher,
dieser Hafen, der, so herb, nichts ist, als bloß er
selbst, dennoch hamburgisch sind, und meinetwegen
»niederdeutsch« und »malerisch«, weil der Himmel,
das Licht es macht, das Leben, so -allein kann und
wird auch die »bloß« sachlich gebaute City, ohne
Umschweife, Stimulation, das alles »von selber« haben!
Der Forderung der Einheitlichkeit in Material und
Gliederung ist im oberen Teil der Mönkebergstraße auf
der einen Seite wenigstens einigermaßen Genüge getan.
Überhaupt ist dieses der beste Teil und der schönste!
Vom Pferdemarkt an steht: das Dynamohaus (leider
ornamental zu überladen), der Reichsadlerhof, das
riesige Rappolthaus des Architekten Höger (mit seinen
wie gesagt bedauerlichen barocken malerischen Um-
schweifen), weiterhin das Levante- und Caledoniahaus
(in den Mönkebergstraßenfronten sind ornamental die
Gliederungen verschmiert) bis endlich zum großen
Klöpperhaus. Sie alle bilden eine leidlich einheitliche
Front. Der Witz jedoch ist, daß ihre rückwärtigen
Bugenhagenstraßenfronten weit besser sind, ja, alle
kritischen und prinzipiellen Forderungen in vorbild-
licher Weise befriedigen. Nach der kleinen Bugen-
hagenstraße zu glaubte man vom bildhauerischen
Schmuck absehen, einfacher sein zu »dürfen«; und
aus diesem unendlich kindlichen Glauben (der Bau-
herren? der Architekten?), Hauptfronten »müßten«
»reich«, Nebenfronten »dürften« »einheitlich« gehalten
sein, ist die Nebenfront so ausgezeichnet geworden,
daß man nicht versteht, wie die Herren Architekten
in den Vorderfronten so gegen ihr eigenes Können
wüten konnten. Die Bugenhagenstraße (vorläufig ein-
seitig bebaut) bietet, wenn auch ein wenig unbeab-
sichtigt, bis jetzt eine Lösung, die am nahesten dem
Ideal einer City-Architektur kommt.
Dort steht auch das kleine und doch so monu-
mentalische Bugenhagenhaus des Regierungsbaumeister
Bensei (mit Anteil des jungen Architekten Detlef Pe-
tersen?). Es ist von einer herben Unbedingtheit und
Beschränkung, die nicht genug zu würdigen sind,
weil sie, wie so viele Architekten Hamburgs in ihren
Arbeiten zeigen, schwerer fallen müssen, als der naive
Schriftsteller es sich vorstellt. Nicht in dieser dogma-
tischen Strenge ist das Klöpperhaus nach dem Rappolt-
haus vom Architekten Höger erbaut. Auch dieses
ist im Detail nicht reminiszenzenfrei, doch besser
als das Rappolthaus. Davon aber mit Vergnügen ab-
gesehen, ist es in der Mönkebergstraße die beste,
reifste Lösung, und beweist, daß Herr Höger sich
berichtigt.
Nicht immer nun besteht die glückliche Gelegen-
heit, durch eine völlig neu geschaffene Straße sich
frei den Zielen moderner Architektur, moderner Ge-
schäftsstadtbildung nähern zu können. Berlin zum
Beispiel hat solche Gelegenheit dem Architekten nicht
bieten können.
Die alltägliche Situation ist vielmehr die, daß in
lange bestehenden Straßen (die also ganz der furcht-
bare Ausdruck der »Großstadt«, der Verwirrung sind)
der modern gesinnte Architekt sein Haus zu bauen
hat. Alle Forderungen werden hier unverhältnis-
mäßig viel schwerer. Es ist hier nicht alles mit Un-
bedingtheit, mit bloßer Dogmatik getan, denn als
Einzelner mitten in Verwirrtem zu stehen, braucht es
nicht bloß Zielstrebigkeit, sondern auch Delikatesse.
Lösungen solcher (schwierigsten) Aufgaben gibt es
immerhin mehrere in Hamburg. Unter ihnen sind
die des Architekten Elingius die besten und in jeder
Hinsicht vorbildlich!
Es ist die Bedeutung gezeigt worden, die Hamburg
für die Lösung des Großstadtproblems organisatorisch
und architektonisch besitzt; wie weit es den Aufgaben
bereits nachgekommen ist; wo noch Fehler liegen.
Den weiteren Verlauf der Dinge zu bessern, zu be-
wachen, lassen sich die Kritik (und nicht bloß die
lokale), die Baupfleger, Architekten und die Stadt-
herren hoffentlich recht angelegen sein. Ihre Arbeit
ist Arbeit am wichtigsten Problem für eine Kultur
Deutschlands!
GARTENKUNST AUF DER WERKBUND-AUSSTELLUNG
(Hierzu die folgenden Abbildungen)
GARTENKUNST ist gleich der Wohnungskunst eine
Raumkunst. Wie sich die Wohnung von einer indi-
viduellen Grundstimmung gliedert in einzelne Stim-
mungen, Räume und Abteilungen, so in gleicher Weise der
Garten. In dem Sondergarten »Hoppe-Boehm« auf der Deut-
schen Werkbund-Ausstellung wurde eine umfangreiche und
reich durchgegliederte Gartenanlage in diesem großzügigen
Sinn gezeigt. Architekt D. W. B. Kurt Hoppe, Wiesbaden, hat
in Gemeinschaft mit einer der bedeutendsten Baumschulen
Deutschlands Th. Boehm, Oberkassel, diese Idee in einer
Weise durchgeführt, daß trotz einer in allen Teilen erzielten
Einheitlichkeit viele eigenartige gesonderte Raumstimmungen
in den Garten hervorgebracht wurden, wie dies nur einer
gesteigerten Raumkunst vorbehalten war. Für die Garten-
kunst war dies Problem neu, insofern wenigstens, wie es in
diesem Garten gezeigt wurde, weil hier nicht etwa nur
verschiedene einzelne Gärten und Motive nebeneinander
gezeigt waren, sondern wie in der Raumkunst und der
Musik alles sich dem Grundton und dem Gesamtcharakter
unterordnete, mit vielen reichen Variationen organisch und
architektonisch miteinander verarbeitet und gesteigert war.
— Begünstigt wurden diese Ideen einerseits durch die
Art und Lage des Geländes. Der Damm wurde in eigen-
artiger Weise benutzt, durch eine Terrasse erweitert und
durch sonstige umfangreiche Terrainbewegungen mit dem
übrigen großen Gartenland zusammengearbeitet, so daß
daraus ein selbstverständlicher und klar gegliederter Orga-
nismus entstand. Nur durch das wunderbare Pflanzen-
material, Bäume und Baumalleen, hohe Taxus- und Buxpyra-
miden, wuchtige zwei- und dreifache Hecken von Taxus, Hain-
buchen, Linden und anderes mehr, Material, wie es nur selten
und dann kaum in solcher Menge und Qualität gezeigt werden
konnte, wurde die Durchführung dieser Gartenideen dem
Künstler ermöglicht.: Vor allem durch das völlig ineinander
aufgehende gegenseitige Verständnis des Baumschulbesitzers
mit dem Künstler und Architekten ist das Gelingen einer
solchen Schöpfung denkbar.
Von den reichen Einzelheiten des Gartens, die alle nach
90
dieser Hafen, der, so herb, nichts ist, als bloß er
selbst, dennoch hamburgisch sind, und meinetwegen
»niederdeutsch« und »malerisch«, weil der Himmel,
das Licht es macht, das Leben, so -allein kann und
wird auch die »bloß« sachlich gebaute City, ohne
Umschweife, Stimulation, das alles »von selber« haben!
Der Forderung der Einheitlichkeit in Material und
Gliederung ist im oberen Teil der Mönkebergstraße auf
der einen Seite wenigstens einigermaßen Genüge getan.
Überhaupt ist dieses der beste Teil und der schönste!
Vom Pferdemarkt an steht: das Dynamohaus (leider
ornamental zu überladen), der Reichsadlerhof, das
riesige Rappolthaus des Architekten Höger (mit seinen
wie gesagt bedauerlichen barocken malerischen Um-
schweifen), weiterhin das Levante- und Caledoniahaus
(in den Mönkebergstraßenfronten sind ornamental die
Gliederungen verschmiert) bis endlich zum großen
Klöpperhaus. Sie alle bilden eine leidlich einheitliche
Front. Der Witz jedoch ist, daß ihre rückwärtigen
Bugenhagenstraßenfronten weit besser sind, ja, alle
kritischen und prinzipiellen Forderungen in vorbild-
licher Weise befriedigen. Nach der kleinen Bugen-
hagenstraße zu glaubte man vom bildhauerischen
Schmuck absehen, einfacher sein zu »dürfen«; und
aus diesem unendlich kindlichen Glauben (der Bau-
herren? der Architekten?), Hauptfronten »müßten«
»reich«, Nebenfronten »dürften« »einheitlich« gehalten
sein, ist die Nebenfront so ausgezeichnet geworden,
daß man nicht versteht, wie die Herren Architekten
in den Vorderfronten so gegen ihr eigenes Können
wüten konnten. Die Bugenhagenstraße (vorläufig ein-
seitig bebaut) bietet, wenn auch ein wenig unbeab-
sichtigt, bis jetzt eine Lösung, die am nahesten dem
Ideal einer City-Architektur kommt.
Dort steht auch das kleine und doch so monu-
mentalische Bugenhagenhaus des Regierungsbaumeister
Bensei (mit Anteil des jungen Architekten Detlef Pe-
tersen?). Es ist von einer herben Unbedingtheit und
Beschränkung, die nicht genug zu würdigen sind,
weil sie, wie so viele Architekten Hamburgs in ihren
Arbeiten zeigen, schwerer fallen müssen, als der naive
Schriftsteller es sich vorstellt. Nicht in dieser dogma-
tischen Strenge ist das Klöpperhaus nach dem Rappolt-
haus vom Architekten Höger erbaut. Auch dieses
ist im Detail nicht reminiszenzenfrei, doch besser
als das Rappolthaus. Davon aber mit Vergnügen ab-
gesehen, ist es in der Mönkebergstraße die beste,
reifste Lösung, und beweist, daß Herr Höger sich
berichtigt.
Nicht immer nun besteht die glückliche Gelegen-
heit, durch eine völlig neu geschaffene Straße sich
frei den Zielen moderner Architektur, moderner Ge-
schäftsstadtbildung nähern zu können. Berlin zum
Beispiel hat solche Gelegenheit dem Architekten nicht
bieten können.
Die alltägliche Situation ist vielmehr die, daß in
lange bestehenden Straßen (die also ganz der furcht-
bare Ausdruck der »Großstadt«, der Verwirrung sind)
der modern gesinnte Architekt sein Haus zu bauen
hat. Alle Forderungen werden hier unverhältnis-
mäßig viel schwerer. Es ist hier nicht alles mit Un-
bedingtheit, mit bloßer Dogmatik getan, denn als
Einzelner mitten in Verwirrtem zu stehen, braucht es
nicht bloß Zielstrebigkeit, sondern auch Delikatesse.
Lösungen solcher (schwierigsten) Aufgaben gibt es
immerhin mehrere in Hamburg. Unter ihnen sind
die des Architekten Elingius die besten und in jeder
Hinsicht vorbildlich!
Es ist die Bedeutung gezeigt worden, die Hamburg
für die Lösung des Großstadtproblems organisatorisch
und architektonisch besitzt; wie weit es den Aufgaben
bereits nachgekommen ist; wo noch Fehler liegen.
Den weiteren Verlauf der Dinge zu bessern, zu be-
wachen, lassen sich die Kritik (und nicht bloß die
lokale), die Baupfleger, Architekten und die Stadt-
herren hoffentlich recht angelegen sein. Ihre Arbeit
ist Arbeit am wichtigsten Problem für eine Kultur
Deutschlands!
GARTENKUNST AUF DER WERKBUND-AUSSTELLUNG
(Hierzu die folgenden Abbildungen)
GARTENKUNST ist gleich der Wohnungskunst eine
Raumkunst. Wie sich die Wohnung von einer indi-
viduellen Grundstimmung gliedert in einzelne Stim-
mungen, Räume und Abteilungen, so in gleicher Weise der
Garten. In dem Sondergarten »Hoppe-Boehm« auf der Deut-
schen Werkbund-Ausstellung wurde eine umfangreiche und
reich durchgegliederte Gartenanlage in diesem großzügigen
Sinn gezeigt. Architekt D. W. B. Kurt Hoppe, Wiesbaden, hat
in Gemeinschaft mit einer der bedeutendsten Baumschulen
Deutschlands Th. Boehm, Oberkassel, diese Idee in einer
Weise durchgeführt, daß trotz einer in allen Teilen erzielten
Einheitlichkeit viele eigenartige gesonderte Raumstimmungen
in den Garten hervorgebracht wurden, wie dies nur einer
gesteigerten Raumkunst vorbehalten war. Für die Garten-
kunst war dies Problem neu, insofern wenigstens, wie es in
diesem Garten gezeigt wurde, weil hier nicht etwa nur
verschiedene einzelne Gärten und Motive nebeneinander
gezeigt waren, sondern wie in der Raumkunst und der
Musik alles sich dem Grundton und dem Gesamtcharakter
unterordnete, mit vielen reichen Variationen organisch und
architektonisch miteinander verarbeitet und gesteigert war.
— Begünstigt wurden diese Ideen einerseits durch die
Art und Lage des Geländes. Der Damm wurde in eigen-
artiger Weise benutzt, durch eine Terrasse erweitert und
durch sonstige umfangreiche Terrainbewegungen mit dem
übrigen großen Gartenland zusammengearbeitet, so daß
daraus ein selbstverständlicher und klar gegliederter Orga-
nismus entstand. Nur durch das wunderbare Pflanzen-
material, Bäume und Baumalleen, hohe Taxus- und Buxpyra-
miden, wuchtige zwei- und dreifache Hecken von Taxus, Hain-
buchen, Linden und anderes mehr, Material, wie es nur selten
und dann kaum in solcher Menge und Qualität gezeigt werden
konnte, wurde die Durchführung dieser Gartenideen dem
Künstler ermöglicht.: Vor allem durch das völlig ineinander
aufgehende gegenseitige Verständnis des Baumschulbesitzers
mit dem Künstler und Architekten ist das Gelingen einer
solchen Schöpfung denkbar.
Von den reichen Einzelheiten des Gartens, die alle nach
90