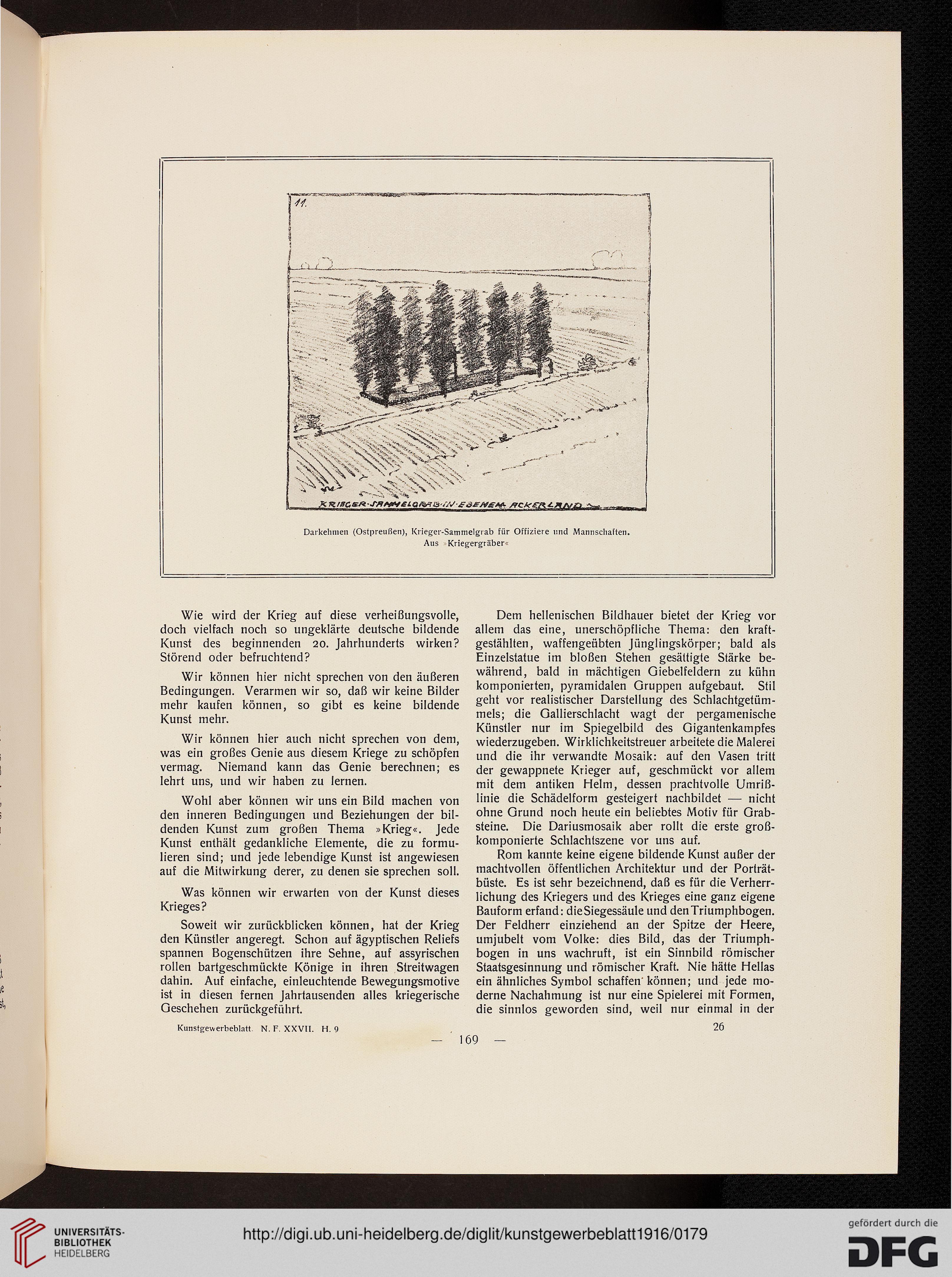-
j<K/8asj9-s/rAW£ia^&-ssv'*~£&/v&^s7eK£fä*.Mjytßiiifv. .r—„^
Darkehmen (Ostpreußen), Krieger-Sammelgrab für Offiziere und Mannschaften.
Aus Kriegergräber«
Wie wird der Krieg auf diese verheißungsvolle,
doch vielfach noch so ungeklärte deutsche bildende
Kunst des beginnenden 20. Jahrhunderts wirken?
Störend oder befruchtend?
Wir können hier nicht sprechen von den äußeren
Bedingungen. Verarmen wir so, daß wir keine Bilder
mehr kaufen können, so gibt es keine bildende
Kunst mehr.
Wir können hier auch nicht sprechen von dem,
was ein großes Genie aus diesem Kriege zu schöpfen
vermag. Niemand kann das Genie berechnen; es
lehrt uns, und wir haben zu lernen.
Wohl aber können wir uns ein Bild machen von
den inneren Bedingungen und Beziehungen der bil-
denden Kunst zum großen Thema »Krieg«. Jede
Kunst enthält gedankliche Elemente, die zu formu-
lieren sind; und jede lebendige Kunst ist angewiesen
auf die Mitwirkung derer, zu denen sie sprechen soll.
Was können wir erwarten von der Kunst dieses
Krieges?
Soweit wir zurückblicken können, hat der Krieg
den Künstler angeregt. Schon auf ägyptischen Reliefs
spannen Bogenschützen ihre Sehne, auf assyrischen
rollen bartgeschmückte Könige in ihren Streitwagen
dahin. Auf einfache, einleuchtende Bewegungsmotive
ist in diesen fernen Jahrtausenden alles kriegerische
Geschehen zurückgeführt.
Kunstgewerbeblatt N. F. XXVII. H. 9
— 1
Dem hellenischen Bildhauer bietet der Krieg vor
allem das eine, unerschöpfliche Thema: den kraft-
gestählten, waffengeübten Jünglingskörper; bald als
Einzelstatue im bloßen Stehen gesättigte Stärke be-
während, bald in mächtigen Giebelfeldern zu kühn
komponierten, pyramidalen Gruppen aufgebaut. Stil
geht vor realistischer Darstellung des Schlachtgetüm-
mels; die Gallierschlacht wagt der pergamenische
Künstler nur im Spiegelbild des Gigantenkampfes
wiederzugeben. Wirklichkeitstreuer arbeitete die Malerei
und die ihr verwandte Mosaik: auf den Vasen tritt
der gewappnete Krieger auf, geschmückt vor allem
mit dem antiken Helm, dessen prachtvolle Umriß-
linie die Schädelform gesteigert nachbildet — nicht
ohne Grund noch heute ein beliebtes Motiv für Grab-
steine. Die Dariusmosaik aber rollt die erste groß-
komponierte Schlachtszene vor uns auf.
Rom kannte keine eigene bildende Kunst außer der
machtvollen öffentlichen Architektur und der Porträt-
büste. Es ist sehr bezeichnend, daß es für die Verherr-
lichung des Kriegers und des Krieges eine ganz eigene
Bauform erfand: die Siegessäule und den Triumphbogen.
Der Feldherr einziehend an der Spitze der Heere,
umjubelt vom Volke: dies Bild, das der Triumph-
bogen in uns wachruft, ist ein Sinnbild römischer
Staatsgesinnung und römischer Kraft. Nie hätte Hellas
ein ähnliches Symbol schaffen'können; und jede mo-
derne Nachahmung ist nur eine Spielerei mit Formen,
die sinnlos geworden sind, weil nur einmal in der
26
69 —