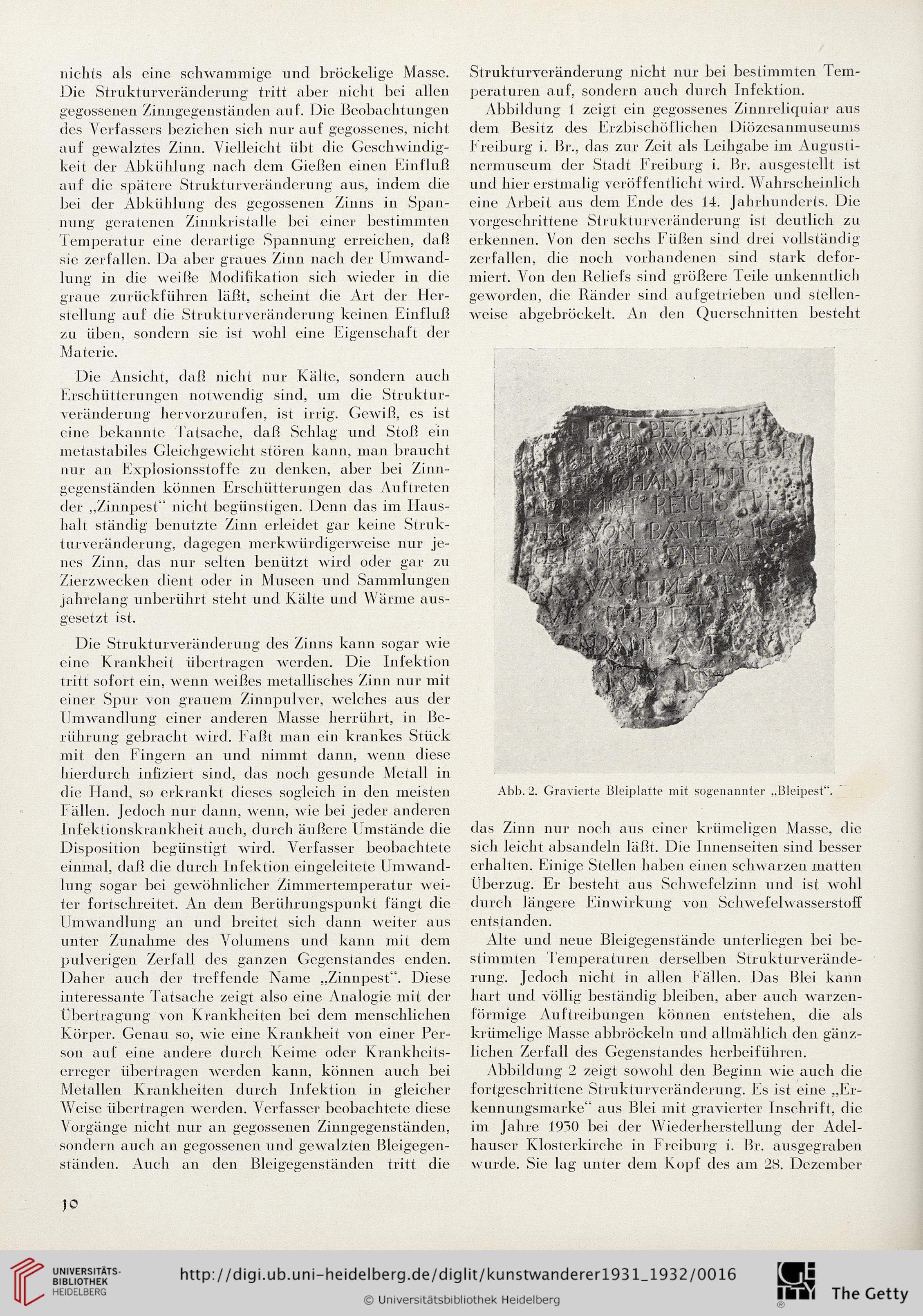nichts als eine schwammige uncl bröckelige Masse.
Die Strukturveränderung tritt aber nicht bei allen
gegossenen Zinngegenständen auf. Die Beobachtungen
ties Yerfassers beziehen sicli nur auf gegossenes, nicht
auf gewalztes Zinn. Viefleicht iibt die Geschwindig-
keit der Abkiihlung nach dem Gießen einen Einfluß
auf die spätere Struktiirveränderung aus, indem die
bei der Abkühlung des gegossenen Zinns in Span-
nung geratenen Zinnkristalle bei einer bestimmten
Temperatur eine derartige Spannung erreiclien, daß
sie zerfallen. J)a aber graues Zinn nacli der Umwand-
lung in die weiße Modifikation sicli wieder in die
graue zurlickführen läßt, scheint die Art der Her-
stellung auf die Strukturveränderung keinen Einfluß
zu iiben, sondern sie ist wolil eine Eigenschaft der
Materie.
Die Ansicht, daß nicht nur Kälte, sondern auch
Erschiitterungen notwendig sind, um die Struktur-
veränderung liervorzurufen, ist irrig. Gewiß, es ist
cine bekannte Tatsaclie, daß Schlag und Stoß ein
metastabiles Gleicligewiclit stören kann, man lnraucht
nur an Explosionsstoffe zu denken, alier Jiei Zinn-
gegenständen können Erscliiitterungen das Auftreten
cler „Zinnpest“ nicht begünstigen. Denn das im Haus-
lialt ständig benutzte Zinn erleidet gar keine Struk-
turveränderung, dagegen merkwürdigerweise nur je-
nes Zinn, das nur selten Jienützt wircl oder gar zu
Zierzwecken dient oder in Museen und Sammlungen
jahrelang unberührt stelit uncl Kälte uncl Wärnie aus-
gesetzt ist.
Die Strukturveränderung des Zinns kann sogar wie
cine Krankheit iibertragen werden. Die Infektion
tritt sofort ein, wenn weißes metallisclies Zinn nur mit
einer Spur von grauem Zinnpulver, welches aus der
Umwandlung einer anderen Masse herrührt, in Be-
rührung gebracht wird. Faßt man ein krankes Stück
mit clen Eingern an und nimmt dann, wenn diese
liierdurcli infiziert sincl, das noch gesunde Metall in
die Hancl, so erkrankt dieses sogleicli in den meisten
lällen. jecloch nur dann, wenn, wie bei jeder anderen
Infektionskrankheit auch, durch äußere Umstände die
Disposition begünstigt wird. Yerfasser beobachtete
einmal, daß. die durch Infektion eingeleitete Umwand-
lung sogar bei gewöhnlicher Zinunertemperatur wei-
ter fortschreitet. An dem Berührungspunkt fängt die
Umwandlung an und breitet sich dann weiter aus
unter Zunahme des Yolumens und kann mit dem
pulverigen Zerfall des ganzen Gegenstandes enden.
Daher auch der tref’fende Name „Zinnpest“. Diese
interessante Tatsache zeigt also eine Analogie mit der
Übertragung von Krankheiten bei dem menschlichen
Körper. Genau so, wie eine Krankheit von einer Per-
son auf eine andere durcli Keime oder Krankheits-
erreger tibertragen werden kann, können auch bei
Metallen Krankheiten durch Infektion in gleicher
Weise übertragen werden. Verfasser beobachtete diese
Vorgänge nicht nur an gegossenen Zinngegenstänclen,
sondern auch an gegossenen und gewalzten Bleigegen-
ständen. Auch an den Bleigegenständen tritt die
Strukturveränderung nicht nur bei bestimmten Tem-
peraturen auf, sondern auch durch Infektion.
Abbildung I zeigt ein gegossenes Zinnreliquiar aus
dem Besitz des Erzbischöflichen Diözesanmuseums
Ereiburg i. Br„ das zur Zeit als Leihgabe im Augusti-
nermuseum cler Stadt Ereibnrg i. Br. ausgestellt ist
und hier erstmalig veröffentlicht wircl. Wahrscheinlich
eine Arbeit aus dem Ende cles 14. Jahrhunderts. Die
vorgeschrittene Strukturveränderung ist deutlich zu
erkennen. Von den seclis Fiißen sind drei vollständig
zerfallen, die noch vorhandenen sind stark defor-
miert. Von den Reliefs sind größere Teile unkenntlich
geworden, die Räncler sincl aufgetrieben und stellen-
weise abgebröckelt. An clen Querschnitten besteht
Abb. 2. Gravicrte Bleiplattc mit sogenannter „Blcipest“.
das Zinn nur noch aus einer krümeligen Masse, die
sicli leicht absandeln läßt. Die Innenseiten sind besser
erhalten. Einige Stellen Iiaben einen schwarzen matten
Überzug. Er besteht aus Schwefelzinn und ist wohl
clurch längere Einwirkung von Schwefelwasserstoff
entstanden.
Alte und neue Bleigegenstände unterliegen bei be-
stimmten Temperaturen derselben Strukturverände-
rung. Jedocli nicht in allen Fällen. Das Blei kann
hart und völlig beständig bleiben, aber auch warzen-
förmige Auftreibungen können entstehen, clie als
krümelige Masse abbröckeln uncl allmählich den gänz-
lichen Zerfall des Gegenstandes herbeiführen.
Abbildung 2 zeigt sowohl den Beginn wie aucli die
fortgeschrittene Strukturveränderung. Es ist eine „Er-
kennungsmarke“ aus Blei mit gravierter Inschrift, die
im Jahre 1950 bei cler Wiederherstellung der Adel-
hauser Klosterkirche in Freiburg i. Br. ausgegraben
wurde. Sie lag unter dem Kopf cles am 28. Dezember
Die Strukturveränderung tritt aber nicht bei allen
gegossenen Zinngegenständen auf. Die Beobachtungen
ties Yerfassers beziehen sicli nur auf gegossenes, nicht
auf gewalztes Zinn. Viefleicht iibt die Geschwindig-
keit der Abkiihlung nach dem Gießen einen Einfluß
auf die spätere Struktiirveränderung aus, indem die
bei der Abkühlung des gegossenen Zinns in Span-
nung geratenen Zinnkristalle bei einer bestimmten
Temperatur eine derartige Spannung erreiclien, daß
sie zerfallen. J)a aber graues Zinn nacli der Umwand-
lung in die weiße Modifikation sicli wieder in die
graue zurlickführen läßt, scheint die Art der Her-
stellung auf die Strukturveränderung keinen Einfluß
zu iiben, sondern sie ist wolil eine Eigenschaft der
Materie.
Die Ansicht, daß nicht nur Kälte, sondern auch
Erschiitterungen notwendig sind, um die Struktur-
veränderung liervorzurufen, ist irrig. Gewiß, es ist
cine bekannte Tatsaclie, daß Schlag und Stoß ein
metastabiles Gleicligewiclit stören kann, man lnraucht
nur an Explosionsstoffe zu denken, alier Jiei Zinn-
gegenständen können Erscliiitterungen das Auftreten
cler „Zinnpest“ nicht begünstigen. Denn das im Haus-
lialt ständig benutzte Zinn erleidet gar keine Struk-
turveränderung, dagegen merkwürdigerweise nur je-
nes Zinn, das nur selten Jienützt wircl oder gar zu
Zierzwecken dient oder in Museen und Sammlungen
jahrelang unberührt stelit uncl Kälte uncl Wärnie aus-
gesetzt ist.
Die Strukturveränderung des Zinns kann sogar wie
cine Krankheit iibertragen werden. Die Infektion
tritt sofort ein, wenn weißes metallisclies Zinn nur mit
einer Spur von grauem Zinnpulver, welches aus der
Umwandlung einer anderen Masse herrührt, in Be-
rührung gebracht wird. Faßt man ein krankes Stück
mit clen Eingern an und nimmt dann, wenn diese
liierdurcli infiziert sincl, das noch gesunde Metall in
die Hancl, so erkrankt dieses sogleicli in den meisten
lällen. jecloch nur dann, wenn, wie bei jeder anderen
Infektionskrankheit auch, durch äußere Umstände die
Disposition begünstigt wird. Yerfasser beobachtete
einmal, daß. die durch Infektion eingeleitete Umwand-
lung sogar bei gewöhnlicher Zinunertemperatur wei-
ter fortschreitet. An dem Berührungspunkt fängt die
Umwandlung an und breitet sich dann weiter aus
unter Zunahme des Yolumens und kann mit dem
pulverigen Zerfall des ganzen Gegenstandes enden.
Daher auch der tref’fende Name „Zinnpest“. Diese
interessante Tatsache zeigt also eine Analogie mit der
Übertragung von Krankheiten bei dem menschlichen
Körper. Genau so, wie eine Krankheit von einer Per-
son auf eine andere durcli Keime oder Krankheits-
erreger tibertragen werden kann, können auch bei
Metallen Krankheiten durch Infektion in gleicher
Weise übertragen werden. Verfasser beobachtete diese
Vorgänge nicht nur an gegossenen Zinngegenstänclen,
sondern auch an gegossenen und gewalzten Bleigegen-
ständen. Auch an den Bleigegenständen tritt die
Strukturveränderung nicht nur bei bestimmten Tem-
peraturen auf, sondern auch durch Infektion.
Abbildung I zeigt ein gegossenes Zinnreliquiar aus
dem Besitz des Erzbischöflichen Diözesanmuseums
Ereiburg i. Br„ das zur Zeit als Leihgabe im Augusti-
nermuseum cler Stadt Ereibnrg i. Br. ausgestellt ist
und hier erstmalig veröffentlicht wircl. Wahrscheinlich
eine Arbeit aus dem Ende cles 14. Jahrhunderts. Die
vorgeschrittene Strukturveränderung ist deutlich zu
erkennen. Von den seclis Fiißen sind drei vollständig
zerfallen, die noch vorhandenen sind stark defor-
miert. Von den Reliefs sind größere Teile unkenntlich
geworden, die Räncler sincl aufgetrieben und stellen-
weise abgebröckelt. An clen Querschnitten besteht
Abb. 2. Gravicrte Bleiplattc mit sogenannter „Blcipest“.
das Zinn nur noch aus einer krümeligen Masse, die
sicli leicht absandeln läßt. Die Innenseiten sind besser
erhalten. Einige Stellen Iiaben einen schwarzen matten
Überzug. Er besteht aus Schwefelzinn und ist wohl
clurch längere Einwirkung von Schwefelwasserstoff
entstanden.
Alte und neue Bleigegenstände unterliegen bei be-
stimmten Temperaturen derselben Strukturverände-
rung. Jedocli nicht in allen Fällen. Das Blei kann
hart und völlig beständig bleiben, aber auch warzen-
förmige Auftreibungen können entstehen, clie als
krümelige Masse abbröckeln uncl allmählich den gänz-
lichen Zerfall des Gegenstandes herbeiführen.
Abbildung 2 zeigt sowohl den Beginn wie aucli die
fortgeschrittene Strukturveränderung. Es ist eine „Er-
kennungsmarke“ aus Blei mit gravierter Inschrift, die
im Jahre 1950 bei cler Wiederherstellung der Adel-
hauser Klosterkirche in Freiburg i. Br. ausgegraben
wurde. Sie lag unter dem Kopf cles am 28. Dezember