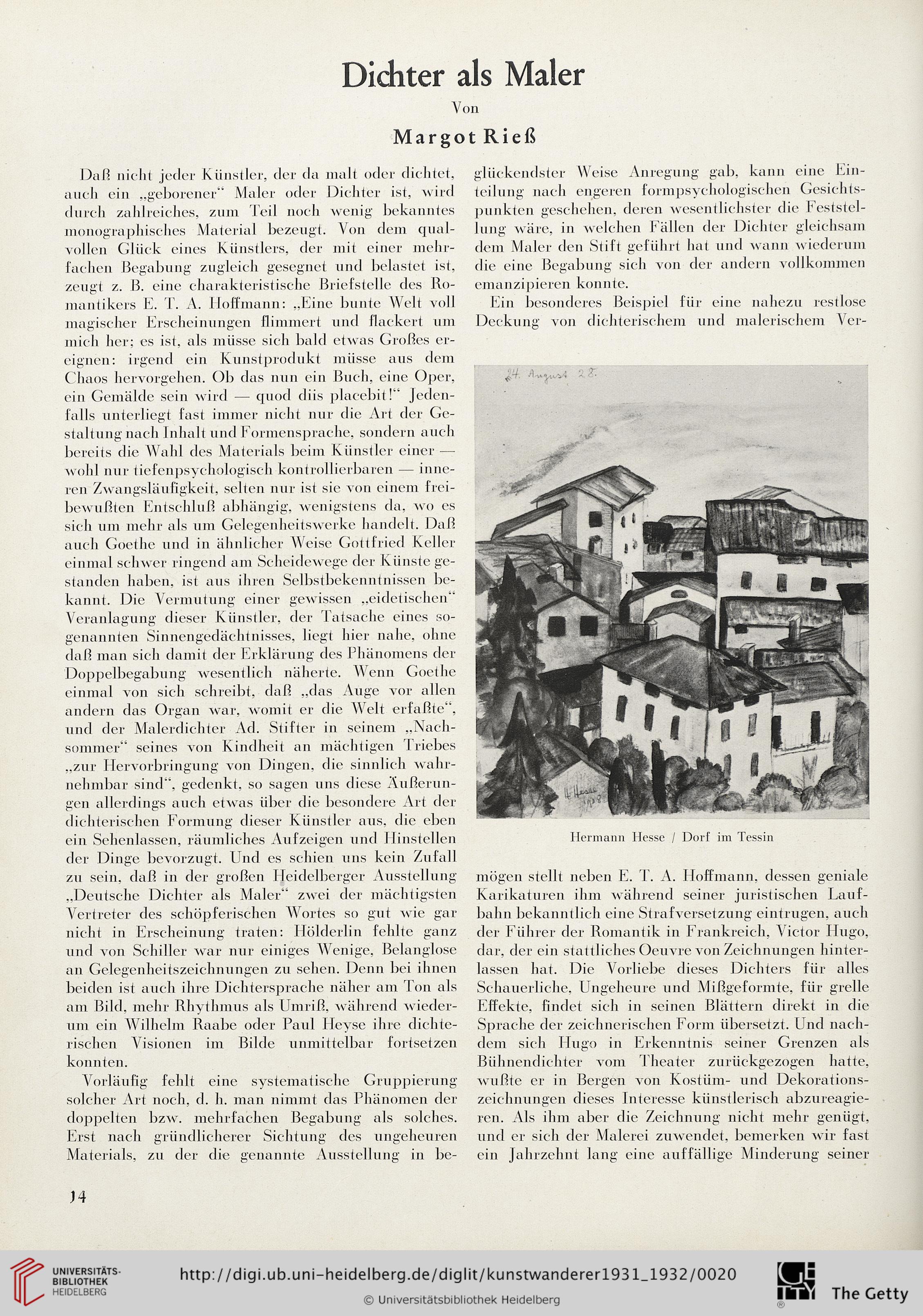Dichter als Maler
Yon
Margot Rieß
Daß niclit jeder Künstler, der da malt oder diclitet,
auch ein „geborener“ Maler oder Dichter ist, wird
durch zahlreiches, zum Teil noch wenig bekanntes
monographisches Material bezeugt. Von dem qual-
vollen Glück eines Künstlers, der mit einer mehr-
fachen Begabung zugleich gesegnet und belastet ist,
zeugt z. B. eine charakteristische Briefstelle des Ro-
mantikers E. T. A. Hoffmann: „Eine bunte Welt yoII
magischer Erscheinungen flimmert und flackert um
mich her; es ist, als miisse sich bald etwas Großes er-
eignen: irgend ein Kunstprodukt miisse aus dem
Chaos hervorgehen. Ob das nun ein Buch, eine Oper,
ein Gemälde sein wird — quod diis placebit!“ Jeden-
falls unterliegt fast immer nicht nur die Art der Ge-
staltung nach Inhalt und Formensprache, sondern auch
bereits die Walil des Materials beim Kiinstler einer —
wohl nur tiefenpsychologisch kontrollierbaren — inne-
ren Zwangsläufigkeit, selten nur ist sie von einem frei-
bewußten Entschluß abhängig, wenigstens da, wo es
sich um mehr als um Gelegenheitswerke handelt. Daß
aueh Goethe und in ähnlicher Weise Gottfried Keller
einmal schwer ringend am Scheidewege der Kiinste ge-
standen haben, ist aus ihren Selbstbekenntnissen be-
kannt. Die Vermutung einer gewissen „eidetischen“
Veranlagung dieser Kiinstler, der Tatsache eines so-
genannten Sinnengedächtnisses, liegt liier nalie, ohne
daß man sicli damit der Erklärung dcs Phänomens der
Doppelbegabung wesentlich näherte. Wenn Goethe
einmal von sich schreibt, daß „das Auge vor allen
andern das Organ war, womit er die Welt erfaßte“,
und der Malerdichter Ad. Stifter in seinem „Nach-
sommer“ seines von Kindheit an mächtigen Triebes
„zur Hervorbringung von Dingen, die sinnlich walir-
nehmbar sind“, gedenkt, so sagen uns diese Äußerun-
gen allerdings auch etwas iiber die besondere Art der
dichterischen Formung dieser Kiinstler aus, die eben
ein Sehenlassen, räumliches Aufzeigen und Hinstellen
der Dinge bevorzugt. Und es schien uns kein Zufall
zu sein, daß in cler großen Ileidelberger Ausstellung
„Deutsche Dichter als Maler“ zwei der mächtigsten
Vertreter des schöpferischen Wortes so gut wie gar
nicht in Erscheinung traten: Hölderlin fehlte ganz
und von Schiller war nur einiges Wenige, Belanglose
an Gelegenheitszeichnungen zu sehen. Denn bei ihnen
beiden ist auch ihre Dichtersprache näher am Ton als
am Bild, mehr Rhythmus als Umriß, während wieder-
um ein Wilhelm Raabe oder Paul Heyse ihre dichte-
rischen Visionen im Bilde unmittelbar fortsetzen
konnten.
Vorläufig fehlt eine systematische Gruppierung
solcher Art noch, d. h. man nimmt das Phänomen der
doppelten bzw. mehrfachen Begabung als solches.
Erst nach griindlicherer Sichtung des ungeheuren
Materials, zu der die genannte Ausstellung in be-
glückendster VVeise Anregung gab, kann eine Ein-
teilung nach engeren formpsychologischen Gesichts-
punkten geschehen, deren wesenilichstcr die Eeststel-
lung wäre, in welchen Fällen der Dichter gleichsam
dem Maler den Stift geführt hat und wann wiederum
flie eine Begabung sicli von der andern vollkommen
emanzipieren konnte.
Ein besonderes Beispiel für eine nahezu restlose
Deckung von dichterischem und maleriscliem Ver-
Hermann Hesse / Dorf im Tessin
mögen stellt neben E. T. A. Hoffmann, dessen geniale
Karikaturen ihm während seiner juristischen Lauf-
balin bekanntlich eine Strafversetzung eintrugen, aucli
der Eührer der Romantik in Frankreich, Victor Ilugo,
dar, der ein stattliches öeuvrevon Zeichnungen hinter-
lassen hat. Die Vorliebe dieses Dichters für alles
Schauerliche, Ungeheure und Mißgeformte, fiir grelle
Effekte, findet sich in seinen Blättern direkt in die
Sprache der zeichnerischen Form übersetzt. Und nach-
dem sich Hugo in Erkenntnis seiner Grenzen als
Bühnendichter vom Theater zurückgezogen hatte,
wußte er in Bergen von Kostüm- und Dekorations-
zeiehnungen dieses Interesse künstlerisch abzureagie-
ren. AIs ihm aber die Zeichnung nicht mehr genügt,
und er sich der Malerei zuwendet, bemerken wir fast
ein jahrzehnt lang eine auffällige Minderung seiner
14
Yon
Margot Rieß
Daß niclit jeder Künstler, der da malt oder diclitet,
auch ein „geborener“ Maler oder Dichter ist, wird
durch zahlreiches, zum Teil noch wenig bekanntes
monographisches Material bezeugt. Von dem qual-
vollen Glück eines Künstlers, der mit einer mehr-
fachen Begabung zugleich gesegnet und belastet ist,
zeugt z. B. eine charakteristische Briefstelle des Ro-
mantikers E. T. A. Hoffmann: „Eine bunte Welt yoII
magischer Erscheinungen flimmert und flackert um
mich her; es ist, als miisse sich bald etwas Großes er-
eignen: irgend ein Kunstprodukt miisse aus dem
Chaos hervorgehen. Ob das nun ein Buch, eine Oper,
ein Gemälde sein wird — quod diis placebit!“ Jeden-
falls unterliegt fast immer nicht nur die Art der Ge-
staltung nach Inhalt und Formensprache, sondern auch
bereits die Walil des Materials beim Kiinstler einer —
wohl nur tiefenpsychologisch kontrollierbaren — inne-
ren Zwangsläufigkeit, selten nur ist sie von einem frei-
bewußten Entschluß abhängig, wenigstens da, wo es
sich um mehr als um Gelegenheitswerke handelt. Daß
aueh Goethe und in ähnlicher Weise Gottfried Keller
einmal schwer ringend am Scheidewege der Kiinste ge-
standen haben, ist aus ihren Selbstbekenntnissen be-
kannt. Die Vermutung einer gewissen „eidetischen“
Veranlagung dieser Kiinstler, der Tatsache eines so-
genannten Sinnengedächtnisses, liegt liier nalie, ohne
daß man sicli damit der Erklärung dcs Phänomens der
Doppelbegabung wesentlich näherte. Wenn Goethe
einmal von sich schreibt, daß „das Auge vor allen
andern das Organ war, womit er die Welt erfaßte“,
und der Malerdichter Ad. Stifter in seinem „Nach-
sommer“ seines von Kindheit an mächtigen Triebes
„zur Hervorbringung von Dingen, die sinnlich walir-
nehmbar sind“, gedenkt, so sagen uns diese Äußerun-
gen allerdings auch etwas iiber die besondere Art der
dichterischen Formung dieser Kiinstler aus, die eben
ein Sehenlassen, räumliches Aufzeigen und Hinstellen
der Dinge bevorzugt. Und es schien uns kein Zufall
zu sein, daß in cler großen Ileidelberger Ausstellung
„Deutsche Dichter als Maler“ zwei der mächtigsten
Vertreter des schöpferischen Wortes so gut wie gar
nicht in Erscheinung traten: Hölderlin fehlte ganz
und von Schiller war nur einiges Wenige, Belanglose
an Gelegenheitszeichnungen zu sehen. Denn bei ihnen
beiden ist auch ihre Dichtersprache näher am Ton als
am Bild, mehr Rhythmus als Umriß, während wieder-
um ein Wilhelm Raabe oder Paul Heyse ihre dichte-
rischen Visionen im Bilde unmittelbar fortsetzen
konnten.
Vorläufig fehlt eine systematische Gruppierung
solcher Art noch, d. h. man nimmt das Phänomen der
doppelten bzw. mehrfachen Begabung als solches.
Erst nach griindlicherer Sichtung des ungeheuren
Materials, zu der die genannte Ausstellung in be-
glückendster VVeise Anregung gab, kann eine Ein-
teilung nach engeren formpsychologischen Gesichts-
punkten geschehen, deren wesenilichstcr die Eeststel-
lung wäre, in welchen Fällen der Dichter gleichsam
dem Maler den Stift geführt hat und wann wiederum
flie eine Begabung sicli von der andern vollkommen
emanzipieren konnte.
Ein besonderes Beispiel für eine nahezu restlose
Deckung von dichterischem und maleriscliem Ver-
Hermann Hesse / Dorf im Tessin
mögen stellt neben E. T. A. Hoffmann, dessen geniale
Karikaturen ihm während seiner juristischen Lauf-
balin bekanntlich eine Strafversetzung eintrugen, aucli
der Eührer der Romantik in Frankreich, Victor Ilugo,
dar, der ein stattliches öeuvrevon Zeichnungen hinter-
lassen hat. Die Vorliebe dieses Dichters für alles
Schauerliche, Ungeheure und Mißgeformte, fiir grelle
Effekte, findet sich in seinen Blättern direkt in die
Sprache der zeichnerischen Form übersetzt. Und nach-
dem sich Hugo in Erkenntnis seiner Grenzen als
Bühnendichter vom Theater zurückgezogen hatte,
wußte er in Bergen von Kostüm- und Dekorations-
zeiehnungen dieses Interesse künstlerisch abzureagie-
ren. AIs ihm aber die Zeichnung nicht mehr genügt,
und er sich der Malerei zuwendet, bemerken wir fast
ein jahrzehnt lang eine auffällige Minderung seiner
14