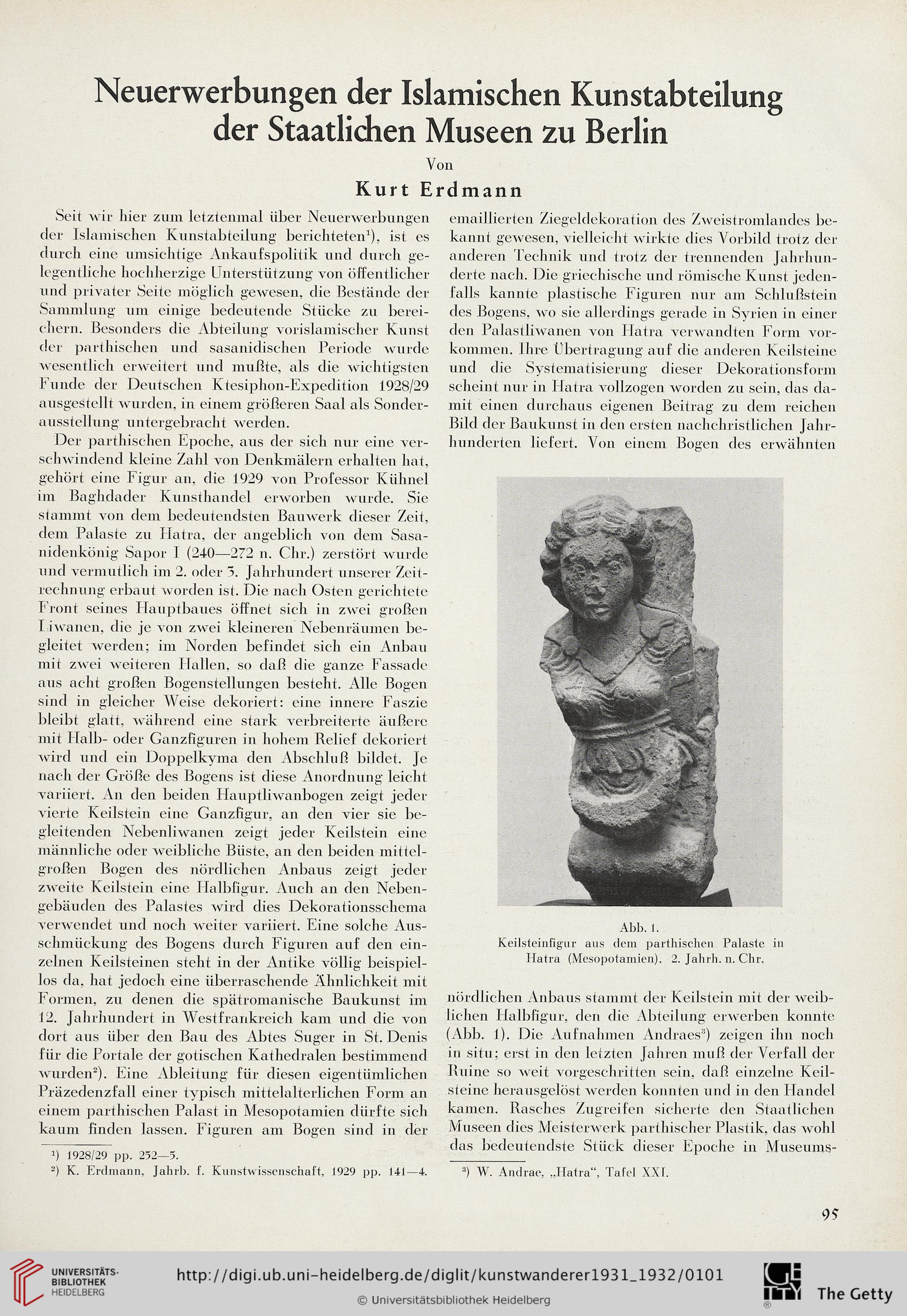Neuerwerbungen der Islamischen Kunstabteilung
der Staatlidhen Museen zu Berlin
Yon
Kurt Erdmann
Seit wir liier zum letztenmal iiber Neuerwerbungen
der Islamischen Kunstabteilung berichteten1), ist es
durcli eiue umsichtige Ankaufspolitik und durch ge-
legentliclie hochherzige Unterstützung von öffentlicher
und privater Seite möglich gewesen, die Bestände der
Sammlung um einige bedeutende Stiicke zu berei-
chern. Besonders die Abteilung vorislamischer Kunst
der parthischen und sasanidischen Periode wurde
wesentlich erweitert und mußte, als die wichtigsten
Funde der Deutschen Ktesiphon-Expedition 1928/29
ausgestellt wurden, in einem größeren Saal als Sonder-
ausstellung untergebracht werden.
Der parthischen Epoche, aus der sicli nur eine ver-
schwindend kleine Zald von Denkmälern erhalten hat,
gehört eine Figur an, die 1929 von Professor Kiihnel
irn Baghdader Kunsthandel erworben wurde. Sie
stammt von dem bedeutendsten Bauwerk dieser Zeit,
dem Palaste zu Ilatra, der angeblich von dem Sasa-
nidenkonig Sapor I (240—272 n. Chr.) zerstört wurde
und vermutlich im 2. oder 3. Jahrhundert unserer Zeit-
rechnung erbaut worden ist. Die nacli Osten gerichtete
Front seines Hauptbaues öffnet sich in zwei großen
I iwanen, die je von zwei kleineren Nebenräumen be-
gleitet werden; im Norden befindet sich ein Anbau
mit zwei weiteren Ilallen, so daß die ganze Fassade
aus acht großen Bogenstellungen besteht. Alle Bogen
sind in gleicher Weise dekoriert: eine innere Faszie
bleibt glatt, während eine stark verbreiterte äußere
mit Halb- oder Ganzfiguren in hohem Relief dekoriert
wird und ein Doppelkyma den Abschluß bildet. Je
nach der Größe des Bogens ist diese Anordnung leicht
variiert. An den beiden Hauptliwanbogen zeigt jeder
vierte Keilstein eine Ganzfigur, an den vier sie be-
gleitenden Nebenliwanen zeigt jeder Keilstein eine
männliche oder weibliche Biiste, an den beiden mittel-
großen Bogen des nördlichen Anbaus zeigt jeder
zweite Keilstein eine Halbfigur. Auch an den Neben-
gebäuden des Palastes wird dies Dekorationsschema
verwendet und noch weiter variiert. Eine solche Aus-
schmückung des Bogens durch Figuren auf den ein-
zelnen Keilsteinen steht in der Antike völlig beispiel-
los da, hat jedoch eine iiberraschende Ähnlichkeit mit
Formen, zu denen die spätromanische Baukunst im
12. Jahrhundert in Westfrankreich kam und die von
dort aus iiber den Bau des Abtes Suger in St. Denis
fiir die Portale der gotischen Kathedralen bestimmend
wurden2). Eine Ableitung fiir diesen eigentümlichen
Präzedenzfall einer typisch mittelalterlichen Form an
einem parthischen Palast in Mesopotamien dürfte sich
kaum finden lassen. Figuren am Bogen sind in der
9 1928/29 pp. 252—5.
2) K. Erdmann, Jahrb. f. Kunstwissenschaft, 1929 pp. 141—4.
emaillierten Ziegeldekoration des Zweistromlandes be-
kannt gewesen, vielleiclit wirkte dies Yorbild trotz der
anderen Technik und trotz der trennenden Jahrhun-
derte nach. Die griechische und römische Kunst jeden-
falls kannte plastische Figuren nur am Schlußstein
des Bogens, wo sie allerdings gerade in Syrien in einer
den Palastliwanen von Hatra verwandten Form vor-
kommen. Ihre Übertragung auf die anderen Keilsteine
und die Systematisierung dieser Dekorationsform
scheint nur in Hatra vollzogen worden zu sein, das da-
mit einen durchaus eigenen Beitrag zu dem reichen
Bild der Baukunst in den ersten nachchristlichen Jahr-
Imnderten liefert. Yon eincm Bogen des erwähnten
Abb. 1.
Keilsteinfigur aus tlem parthischen Palaste in
Hatra (Mesopotamien). 2. Jahrh. n. Chr.
nördlichen Anbaus stammt der Keilstein mit der weib-
lichen Halbfigur, den die Abteilung erwerben konnte
(Abb. 1). Die Aufnahmen Andraes3) zeigcn ihn noch
in situ; erst in den letzten Jahren muß der Verfall der
Ruine so weit vorgeschritten sein, daß einzelne Keil-
sieine herausgelöst werden konnten und in den Ffandel
kamen. Rasches Zugreifen sicherte den Staatlichen
Museen dies Meisterwerk parthischer Plastik, das wohl
das bedeutendste Stück dieser Epoche in Museums-
*j W. Andrae, „Hatra“, Taf'el XXI.
9?
der Staatlidhen Museen zu Berlin
Yon
Kurt Erdmann
Seit wir liier zum letztenmal iiber Neuerwerbungen
der Islamischen Kunstabteilung berichteten1), ist es
durcli eiue umsichtige Ankaufspolitik und durch ge-
legentliclie hochherzige Unterstützung von öffentlicher
und privater Seite möglich gewesen, die Bestände der
Sammlung um einige bedeutende Stiicke zu berei-
chern. Besonders die Abteilung vorislamischer Kunst
der parthischen und sasanidischen Periode wurde
wesentlich erweitert und mußte, als die wichtigsten
Funde der Deutschen Ktesiphon-Expedition 1928/29
ausgestellt wurden, in einem größeren Saal als Sonder-
ausstellung untergebracht werden.
Der parthischen Epoche, aus der sicli nur eine ver-
schwindend kleine Zald von Denkmälern erhalten hat,
gehört eine Figur an, die 1929 von Professor Kiihnel
irn Baghdader Kunsthandel erworben wurde. Sie
stammt von dem bedeutendsten Bauwerk dieser Zeit,
dem Palaste zu Ilatra, der angeblich von dem Sasa-
nidenkonig Sapor I (240—272 n. Chr.) zerstört wurde
und vermutlich im 2. oder 3. Jahrhundert unserer Zeit-
rechnung erbaut worden ist. Die nacli Osten gerichtete
Front seines Hauptbaues öffnet sich in zwei großen
I iwanen, die je von zwei kleineren Nebenräumen be-
gleitet werden; im Norden befindet sich ein Anbau
mit zwei weiteren Ilallen, so daß die ganze Fassade
aus acht großen Bogenstellungen besteht. Alle Bogen
sind in gleicher Weise dekoriert: eine innere Faszie
bleibt glatt, während eine stark verbreiterte äußere
mit Halb- oder Ganzfiguren in hohem Relief dekoriert
wird und ein Doppelkyma den Abschluß bildet. Je
nach der Größe des Bogens ist diese Anordnung leicht
variiert. An den beiden Hauptliwanbogen zeigt jeder
vierte Keilstein eine Ganzfigur, an den vier sie be-
gleitenden Nebenliwanen zeigt jeder Keilstein eine
männliche oder weibliche Biiste, an den beiden mittel-
großen Bogen des nördlichen Anbaus zeigt jeder
zweite Keilstein eine Halbfigur. Auch an den Neben-
gebäuden des Palastes wird dies Dekorationsschema
verwendet und noch weiter variiert. Eine solche Aus-
schmückung des Bogens durch Figuren auf den ein-
zelnen Keilsteinen steht in der Antike völlig beispiel-
los da, hat jedoch eine iiberraschende Ähnlichkeit mit
Formen, zu denen die spätromanische Baukunst im
12. Jahrhundert in Westfrankreich kam und die von
dort aus iiber den Bau des Abtes Suger in St. Denis
fiir die Portale der gotischen Kathedralen bestimmend
wurden2). Eine Ableitung fiir diesen eigentümlichen
Präzedenzfall einer typisch mittelalterlichen Form an
einem parthischen Palast in Mesopotamien dürfte sich
kaum finden lassen. Figuren am Bogen sind in der
9 1928/29 pp. 252—5.
2) K. Erdmann, Jahrb. f. Kunstwissenschaft, 1929 pp. 141—4.
emaillierten Ziegeldekoration des Zweistromlandes be-
kannt gewesen, vielleiclit wirkte dies Yorbild trotz der
anderen Technik und trotz der trennenden Jahrhun-
derte nach. Die griechische und römische Kunst jeden-
falls kannte plastische Figuren nur am Schlußstein
des Bogens, wo sie allerdings gerade in Syrien in einer
den Palastliwanen von Hatra verwandten Form vor-
kommen. Ihre Übertragung auf die anderen Keilsteine
und die Systematisierung dieser Dekorationsform
scheint nur in Hatra vollzogen worden zu sein, das da-
mit einen durchaus eigenen Beitrag zu dem reichen
Bild der Baukunst in den ersten nachchristlichen Jahr-
Imnderten liefert. Yon eincm Bogen des erwähnten
Abb. 1.
Keilsteinfigur aus tlem parthischen Palaste in
Hatra (Mesopotamien). 2. Jahrh. n. Chr.
nördlichen Anbaus stammt der Keilstein mit der weib-
lichen Halbfigur, den die Abteilung erwerben konnte
(Abb. 1). Die Aufnahmen Andraes3) zeigcn ihn noch
in situ; erst in den letzten Jahren muß der Verfall der
Ruine so weit vorgeschritten sein, daß einzelne Keil-
sieine herausgelöst werden konnten und in den Ffandel
kamen. Rasches Zugreifen sicherte den Staatlichen
Museen dies Meisterwerk parthischer Plastik, das wohl
das bedeutendste Stück dieser Epoche in Museums-
*j W. Andrae, „Hatra“, Taf'el XXI.
9?