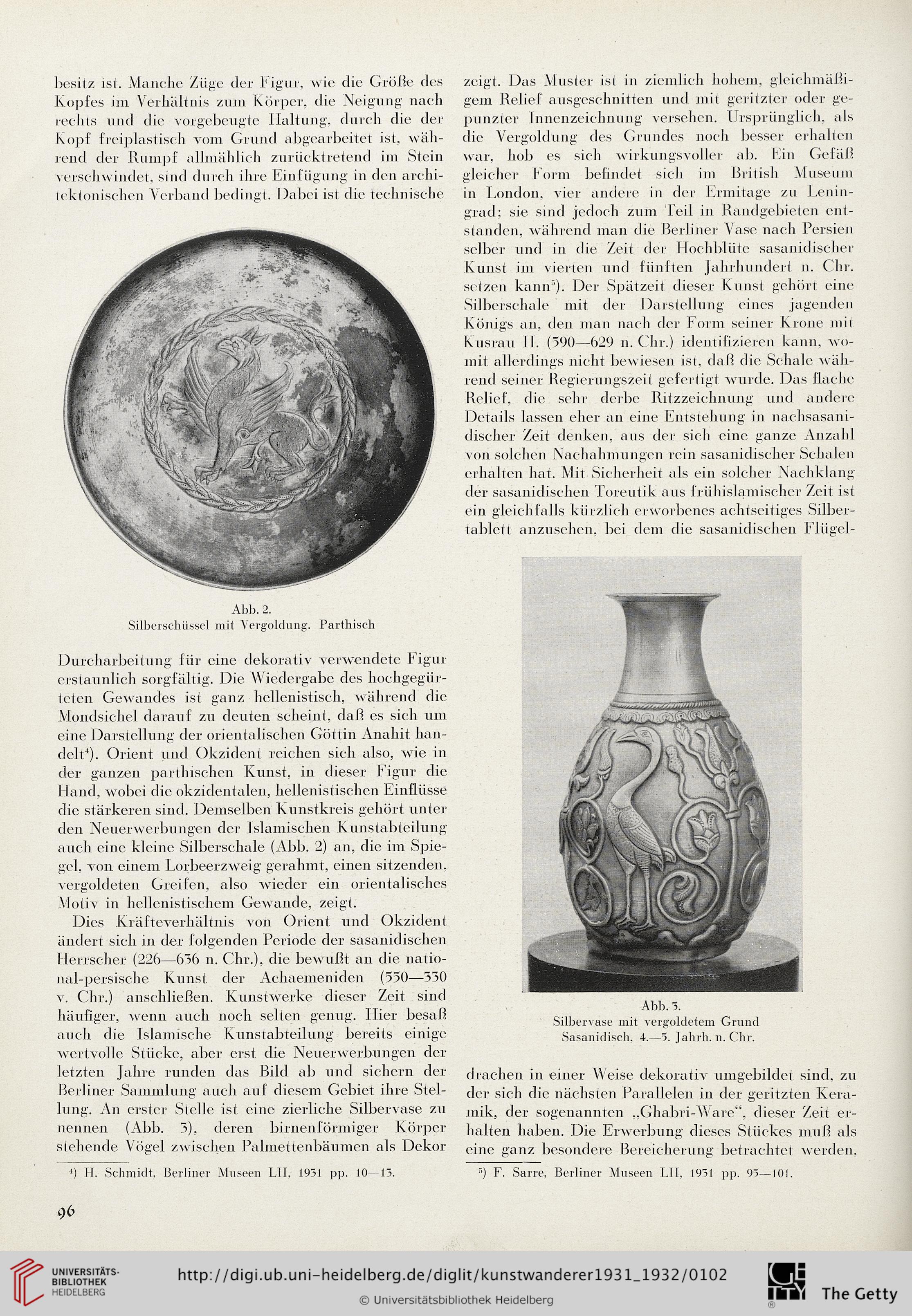besiiz lsi. Manche Ziige der Figur, wie die Gröfie des
Kopfes im Verhaltnis zum Körper, die Neigung nacli
reclits und die vorgebeugte Haltung, durch die der
Kopf freiplastisch vom Grund abgearbeitet ist, wäh-
iend der Rumpf alhnählich zuriicktretend im Stein
verschwindet, sind durch ilire Einfiigung in den archi-
icktonischen Verband bedingt. Dabei isi die technische
Durcharbeitung fiir eine dekorativ verwendete Figur
erstaunlich sorgfältig. Die Wiedergabe des hochgegür-
teten Gewandes ist ganz hellenistisch, während die
Mondsichel darauf zu deuten scheint, dafi es sicli um
eine Darstellung der orientalischen Göttin Anahit han-
delt4). Orient und Okzident reichen sich also, wie in
der ganzen partlnschen Kunst, in dieser Figur die
Hand, wobei die okzidentalen, hellenistischen Einfliisse
die stärkeren sind. Demselben Kunstkreis gehört unter
den Neuerwerbungen der Islamischen Kunstabteilung
auch eine kleine Silberschale (Abb. 2) an, die im Spie-
gel, von einem Lorbeerzweig gerahmt, einen sitzenden,
vergoldeten Greifen, also wieder ein orientalisches
Motiv in hellenistischem Gewande, zeigt.
Dies Kräfteverhältnis von Orient und Okzident
ändert sich in der folgenden Periode der sasanidischen
Merrsclier (226—636 n. Chr.), die bewufit an die natio-
nal-persische Kunst der Achaemeniden (550—330
v. Chr.) anschliefien. Kunstwerke dieser Zeit sind
häufiger, wenn auch noch selten genug. Hier besafi
aucli die Islamische Kunstabteilung bereits einige
wertvolle Stücke, aber erst die Neuerwerbungen der
letzten Jahre runden das Bild ab nnd sichern der
Berliner Sammlung auch auf diesem Gebiet ihre Stel-
lung. An erster Stelle ist eine zierliche Silbervase zn
nennen (Abb. 3), deren birnenförmiger Körper
stehende Vögel zwischen Palmettenbäumen als Dekor
4) H. Sclnnidt, Berliner Museen Lll. 1931 pp. 10—15.
zeigt. Das Muster ist in ziemlich liohem, gleichmäfii-
gem Relief ausgeschnitten und mit geritzter oder ge-
punzter Innenzeichnung versehen. Ursprünglich, als
die Vergoldung des Grundes nocli besser erhalten
war, hol) es sicJi wirkungsvoJler aJ). Ein Gefäfi
gleicher Form befindet sicJi im Britisli Museum
in London, vier andere in der Ermitage zu Lenin-
grad; sie sind jedoeh zum I eif in Randgebieten ent-
standen, während man die Berliner Vase nacli Persien
selber und in die Zeit der Hoclrblüte sasanidisclier
Kunst im vierten und fünften Jalirhundert n. Chr.
setzen kann5). Der Spätzeit dieser Kunst gehört eine
SiJberscliale mit der Darstellung eines jagenden
Königs an, den man nach der Form seiner Krone mit
Knsrau II. (590—629 n. Chr.) identifizieren kann, wo-
mit allerdings nicht bewiesen ist, dafi die Schale vväIi-
rend seiner Regierungszeit gefertigt wurde. Das flache
Relief, die selir derbe Ritzzeichnung und andere
Details lassen eher an eine Entstehung in nachsasani-
discher Zeit denken, aus der sich eine ganze Anzahl
von solchen Nachahmungen rein sasanidischer Schalen
erhalten hat. Mit Sic-herheit als ein solcher Nachklang
der sasanidischen Toreutik aus frühislamischer Zeit ist
ein gleichfalls kiirzlich erworbenes achtseitiges Silber-
tablett anzusehen, bei dem die sasanidischen Flügel-
Abb. 3.
Silbervase mit vergoldetem Grund
Sasanidisch, 4.—5. Jahrli. n. Chr.
drachen in einer Weise dekorativ umgebildet sind. zu
der sich die nächsten Parallelen in der geritzten Kera-
mik, der sogenannten „Ghabri-Ware“, dieser Zeit er-
halten haben. Die Erwerbung dieses Stückes mufi als
eine ganz besondere Bereicherung betrachtet werden,
5) F. Sarre, Berliner Museen L11, 1951 pp. 95—101.
96
Kopfes im Verhaltnis zum Körper, die Neigung nacli
reclits und die vorgebeugte Haltung, durch die der
Kopf freiplastisch vom Grund abgearbeitet ist, wäh-
iend der Rumpf alhnählich zuriicktretend im Stein
verschwindet, sind durch ilire Einfiigung in den archi-
icktonischen Verband bedingt. Dabei isi die technische
Durcharbeitung fiir eine dekorativ verwendete Figur
erstaunlich sorgfältig. Die Wiedergabe des hochgegür-
teten Gewandes ist ganz hellenistisch, während die
Mondsichel darauf zu deuten scheint, dafi es sicli um
eine Darstellung der orientalischen Göttin Anahit han-
delt4). Orient und Okzident reichen sich also, wie in
der ganzen partlnschen Kunst, in dieser Figur die
Hand, wobei die okzidentalen, hellenistischen Einfliisse
die stärkeren sind. Demselben Kunstkreis gehört unter
den Neuerwerbungen der Islamischen Kunstabteilung
auch eine kleine Silberschale (Abb. 2) an, die im Spie-
gel, von einem Lorbeerzweig gerahmt, einen sitzenden,
vergoldeten Greifen, also wieder ein orientalisches
Motiv in hellenistischem Gewande, zeigt.
Dies Kräfteverhältnis von Orient und Okzident
ändert sich in der folgenden Periode der sasanidischen
Merrsclier (226—636 n. Chr.), die bewufit an die natio-
nal-persische Kunst der Achaemeniden (550—330
v. Chr.) anschliefien. Kunstwerke dieser Zeit sind
häufiger, wenn auch noch selten genug. Hier besafi
aucli die Islamische Kunstabteilung bereits einige
wertvolle Stücke, aber erst die Neuerwerbungen der
letzten Jahre runden das Bild ab nnd sichern der
Berliner Sammlung auch auf diesem Gebiet ihre Stel-
lung. An erster Stelle ist eine zierliche Silbervase zn
nennen (Abb. 3), deren birnenförmiger Körper
stehende Vögel zwischen Palmettenbäumen als Dekor
4) H. Sclnnidt, Berliner Museen Lll. 1931 pp. 10—15.
zeigt. Das Muster ist in ziemlich liohem, gleichmäfii-
gem Relief ausgeschnitten und mit geritzter oder ge-
punzter Innenzeichnung versehen. Ursprünglich, als
die Vergoldung des Grundes nocli besser erhalten
war, hol) es sicJi wirkungsvoJler aJ). Ein Gefäfi
gleicher Form befindet sicJi im Britisli Museum
in London, vier andere in der Ermitage zu Lenin-
grad; sie sind jedoeh zum I eif in Randgebieten ent-
standen, während man die Berliner Vase nacli Persien
selber und in die Zeit der Hoclrblüte sasanidisclier
Kunst im vierten und fünften Jalirhundert n. Chr.
setzen kann5). Der Spätzeit dieser Kunst gehört eine
SiJberscliale mit der Darstellung eines jagenden
Königs an, den man nach der Form seiner Krone mit
Knsrau II. (590—629 n. Chr.) identifizieren kann, wo-
mit allerdings nicht bewiesen ist, dafi die Schale vväIi-
rend seiner Regierungszeit gefertigt wurde. Das flache
Relief, die selir derbe Ritzzeichnung und andere
Details lassen eher an eine Entstehung in nachsasani-
discher Zeit denken, aus der sich eine ganze Anzahl
von solchen Nachahmungen rein sasanidischer Schalen
erhalten hat. Mit Sic-herheit als ein solcher Nachklang
der sasanidischen Toreutik aus frühislamischer Zeit ist
ein gleichfalls kiirzlich erworbenes achtseitiges Silber-
tablett anzusehen, bei dem die sasanidischen Flügel-
Abb. 3.
Silbervase mit vergoldetem Grund
Sasanidisch, 4.—5. Jahrli. n. Chr.
drachen in einer Weise dekorativ umgebildet sind. zu
der sich die nächsten Parallelen in der geritzten Kera-
mik, der sogenannten „Ghabri-Ware“, dieser Zeit er-
halten haben. Die Erwerbung dieses Stückes mufi als
eine ganz besondere Bereicherung betrachtet werden,
5) F. Sarre, Berliner Museen L11, 1951 pp. 95—101.
96