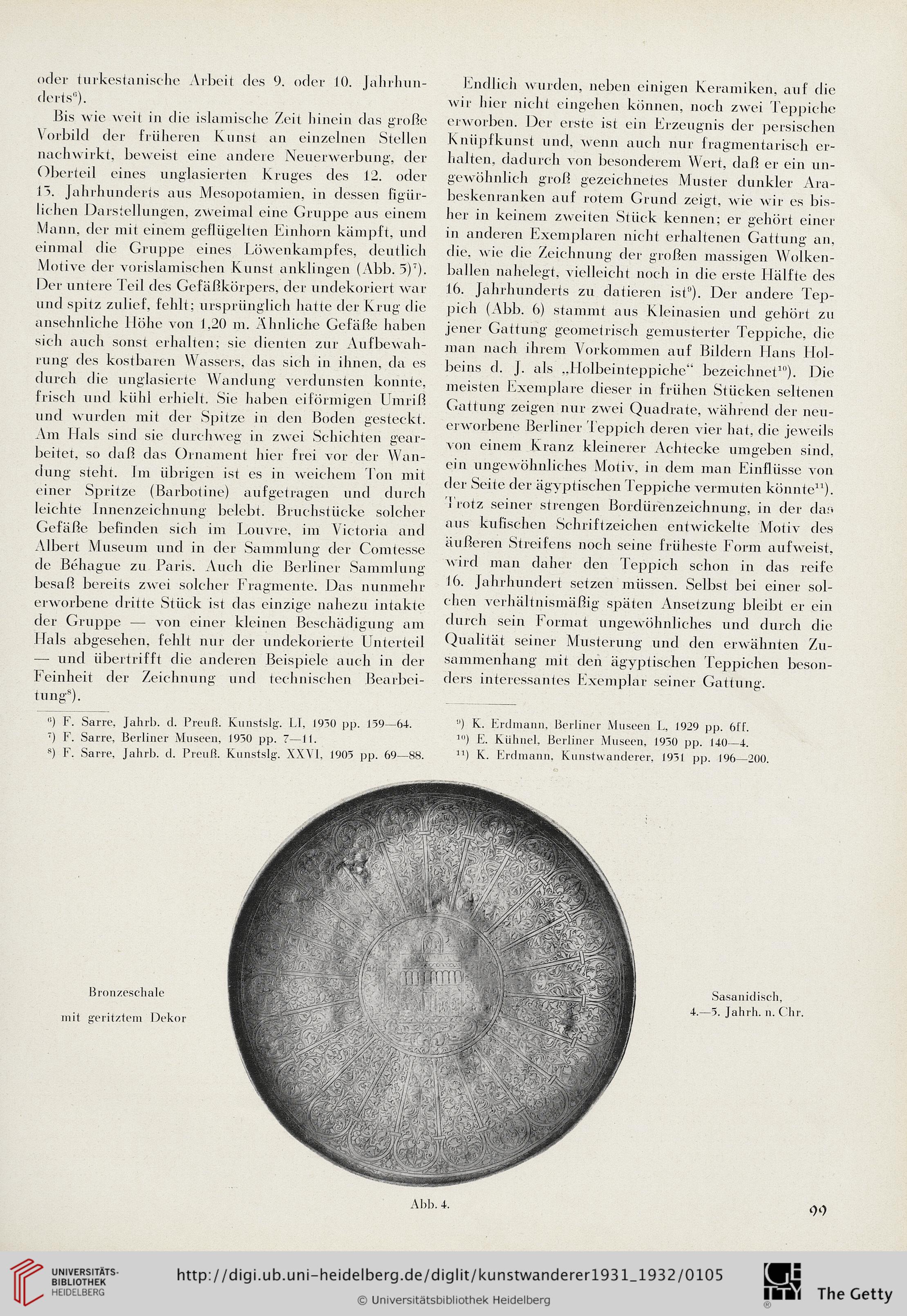oder turkestanische Arbeit des 9. oder 10. jahrhnn-
derts0).
Bis wie weit in die islamische Zeit liinein das große
Vorbild der früheren Knnst an einzelnen Stellen
nachwirkt, beweist eine andere Neuerwerbung, der
Oberteil eines unglasierten Kruges des 12. oder
15. Jahrhunderts aus Mesopotamien, in dessen figlir-
lichen Darstellungen, zweimal eine Gruppe aus einem
Mann, der mit einem gefliigelten Einhorn känipft, nnd
einmal die Gruppe eines Löwenkampfes, deutlich
Motive der vorislamischen Kunst anklingen (Abb. 5)7).
Der untere Teil des Gefäßkörpers, der undekoriert war
und spitz zulief, fehlt; urspriinglich hatte der Krug die
ansehnliche Höhe von 1,20 m. Ähnliche Gefäße haben
sicli auch sonst erhalten; sie dienten zur Aufbewah-
rung des kostbaren Wassers, das sicli in ihnen, da es
durch die unglasierte Wandung verdunsten konnte,
frisch und kiihl erhielt. Sie haben eiformigen Umriß
und wurden mit der Spitze in den Boden gesteckt.
Am Hals sind sie durchweg in zwei Schichten gear-
beitet, so daß das Ornament hier frei vor der Wan-
dung steht. Jm iibrigen ist es in weichem Ton mit
einer Spritze (Barbotine) aufgetragen und durch
leichte Innenzeichnung belebt. Bruchstücke solcher
Gefäße befinden sich im Louvre, im Victoria and
Albert Museiim und in der Sammlung der Comtesse
de Behague zu Paris. Aucli die Berliner Sammlung
besaß bereits zwei solcher Fragmente. Das nunmelir
erworbene dritte Stück ist das einzige naliezu intakte
dei* Gruppe — von einer kleinen Beschädigung am
Hals abgesehen, fehlt nur der undekorierte Unterteil
—- und iibertrifft die anderen Beispiele auch in der
Feinheit der Zeiehnung und technischen Bearbei-
tung8).
I!) F. Sarre, Jahrb. d. Preuß. Kunstslg. LI, 1950 pp. 159—64.
7) F. Sarre, Berliner Museen, 1950 pp. 7—11.
8) F. Sarre, Jahrb. d. Preuß. Kunstslg. XXVI, 1905 pp. 69—88.
Endlicii wurden, neben einigen Keramiken, auf die
wir Jiier niclrt eingelien können, noch zwei Teppiclie
erworben. Der erste ist ein Erzeugnis der persischen
Knüpfkunst und, wenn auch nur fragmentarisch er-
halten, dadurch von besonderem Wert, daß er ein un-
gewöhnlich groß gezeichnetes Muster dunkler Ara-
beskenranken auf rotem Grund zeigt, wie wir es bis-
her in keinem zweiten Stück kennen; er geliört einer
in anderen Exemplaren nicht erhaltenen Gattung an,
die, wie die Zeiehnung der großen massigen Wolken-
ballen nahelegt, vielleicht noch in die erste Hälfte des
16. Jahrliunderts zu datieren ist9). Der andere Tep-
pich (Abb. 6) stammt aus Kleinasien und gehört zu
jener Gattung geometrisch gemusterter Teppiche, die
man nacli ilirern Vorkommen auf Bildern Hans Hol-
Jieins d. J. als „Holbeinteppiche“ bezeichnet10). Die
meisten Exemplare dieser in friilien Stücken seltenen
Gattung zeigen nur zwei Quadrate, während der neu-
erworbene Berliner TeppicJi deren vier liat, die jeweils
von einem Kranz kleinerer Achtecke umgeben sind,
ein ungewöhnliehes Motiv, in dem man Einflüsse von
der Seite der ägyptischen Teppiche vermuten könnte11).
! rotz seiner strengen Bordürenzeichnung, in der dar*
aus kufischen Schriftzeichen entwickelte Motiv des
äußeren Streifens nocli seine früheste Form aufweist,
wird man daher den Teppich schon in das reif’e
16. Jahrhundert setzen müssen. Selbst bei einer sol-
chen verhältnismäßig späten Ansetzung bleibt er ein
durch sein Format iingewöhnliches und durcli die
Qualität seiner Musterung und den erwähnten Zu-
sammenhang mit den ägyptischen Teppichen beson-
ders interessantes Exemplar seiner Gattung.
!>) K. Erdmann, Berliner Museen L, 1929 pp. 6ff.
10) E. Kühnel, Berliner Museen, 1950 pp. 140—4.
]1) K. Erdmann, Kunstwanderer, 1951 pp. 196—200.
Abb. 4.
99
derts0).
Bis wie weit in die islamische Zeit liinein das große
Vorbild der früheren Knnst an einzelnen Stellen
nachwirkt, beweist eine andere Neuerwerbung, der
Oberteil eines unglasierten Kruges des 12. oder
15. Jahrhunderts aus Mesopotamien, in dessen figlir-
lichen Darstellungen, zweimal eine Gruppe aus einem
Mann, der mit einem gefliigelten Einhorn känipft, nnd
einmal die Gruppe eines Löwenkampfes, deutlich
Motive der vorislamischen Kunst anklingen (Abb. 5)7).
Der untere Teil des Gefäßkörpers, der undekoriert war
und spitz zulief, fehlt; urspriinglich hatte der Krug die
ansehnliche Höhe von 1,20 m. Ähnliche Gefäße haben
sicli auch sonst erhalten; sie dienten zur Aufbewah-
rung des kostbaren Wassers, das sicli in ihnen, da es
durch die unglasierte Wandung verdunsten konnte,
frisch und kiihl erhielt. Sie haben eiformigen Umriß
und wurden mit der Spitze in den Boden gesteckt.
Am Hals sind sie durchweg in zwei Schichten gear-
beitet, so daß das Ornament hier frei vor der Wan-
dung steht. Jm iibrigen ist es in weichem Ton mit
einer Spritze (Barbotine) aufgetragen und durch
leichte Innenzeichnung belebt. Bruchstücke solcher
Gefäße befinden sich im Louvre, im Victoria and
Albert Museiim und in der Sammlung der Comtesse
de Behague zu Paris. Aucli die Berliner Sammlung
besaß bereits zwei solcher Fragmente. Das nunmelir
erworbene dritte Stück ist das einzige naliezu intakte
dei* Gruppe — von einer kleinen Beschädigung am
Hals abgesehen, fehlt nur der undekorierte Unterteil
—- und iibertrifft die anderen Beispiele auch in der
Feinheit der Zeiehnung und technischen Bearbei-
tung8).
I!) F. Sarre, Jahrb. d. Preuß. Kunstslg. LI, 1950 pp. 159—64.
7) F. Sarre, Berliner Museen, 1950 pp. 7—11.
8) F. Sarre, Jahrb. d. Preuß. Kunstslg. XXVI, 1905 pp. 69—88.
Endlicii wurden, neben einigen Keramiken, auf die
wir Jiier niclrt eingelien können, noch zwei Teppiclie
erworben. Der erste ist ein Erzeugnis der persischen
Knüpfkunst und, wenn auch nur fragmentarisch er-
halten, dadurch von besonderem Wert, daß er ein un-
gewöhnlich groß gezeichnetes Muster dunkler Ara-
beskenranken auf rotem Grund zeigt, wie wir es bis-
her in keinem zweiten Stück kennen; er geliört einer
in anderen Exemplaren nicht erhaltenen Gattung an,
die, wie die Zeiehnung der großen massigen Wolken-
ballen nahelegt, vielleicht noch in die erste Hälfte des
16. Jahrliunderts zu datieren ist9). Der andere Tep-
pich (Abb. 6) stammt aus Kleinasien und gehört zu
jener Gattung geometrisch gemusterter Teppiche, die
man nacli ilirern Vorkommen auf Bildern Hans Hol-
Jieins d. J. als „Holbeinteppiche“ bezeichnet10). Die
meisten Exemplare dieser in friilien Stücken seltenen
Gattung zeigen nur zwei Quadrate, während der neu-
erworbene Berliner TeppicJi deren vier liat, die jeweils
von einem Kranz kleinerer Achtecke umgeben sind,
ein ungewöhnliehes Motiv, in dem man Einflüsse von
der Seite der ägyptischen Teppiche vermuten könnte11).
! rotz seiner strengen Bordürenzeichnung, in der dar*
aus kufischen Schriftzeichen entwickelte Motiv des
äußeren Streifens nocli seine früheste Form aufweist,
wird man daher den Teppich schon in das reif’e
16. Jahrhundert setzen müssen. Selbst bei einer sol-
chen verhältnismäßig späten Ansetzung bleibt er ein
durch sein Format iingewöhnliches und durcli die
Qualität seiner Musterung und den erwähnten Zu-
sammenhang mit den ägyptischen Teppichen beson-
ders interessantes Exemplar seiner Gattung.
!>) K. Erdmann, Berliner Museen L, 1929 pp. 6ff.
10) E. Kühnel, Berliner Museen, 1950 pp. 140—4.
]1) K. Erdmann, Kunstwanderer, 1951 pp. 196—200.
Abb. 4.
99