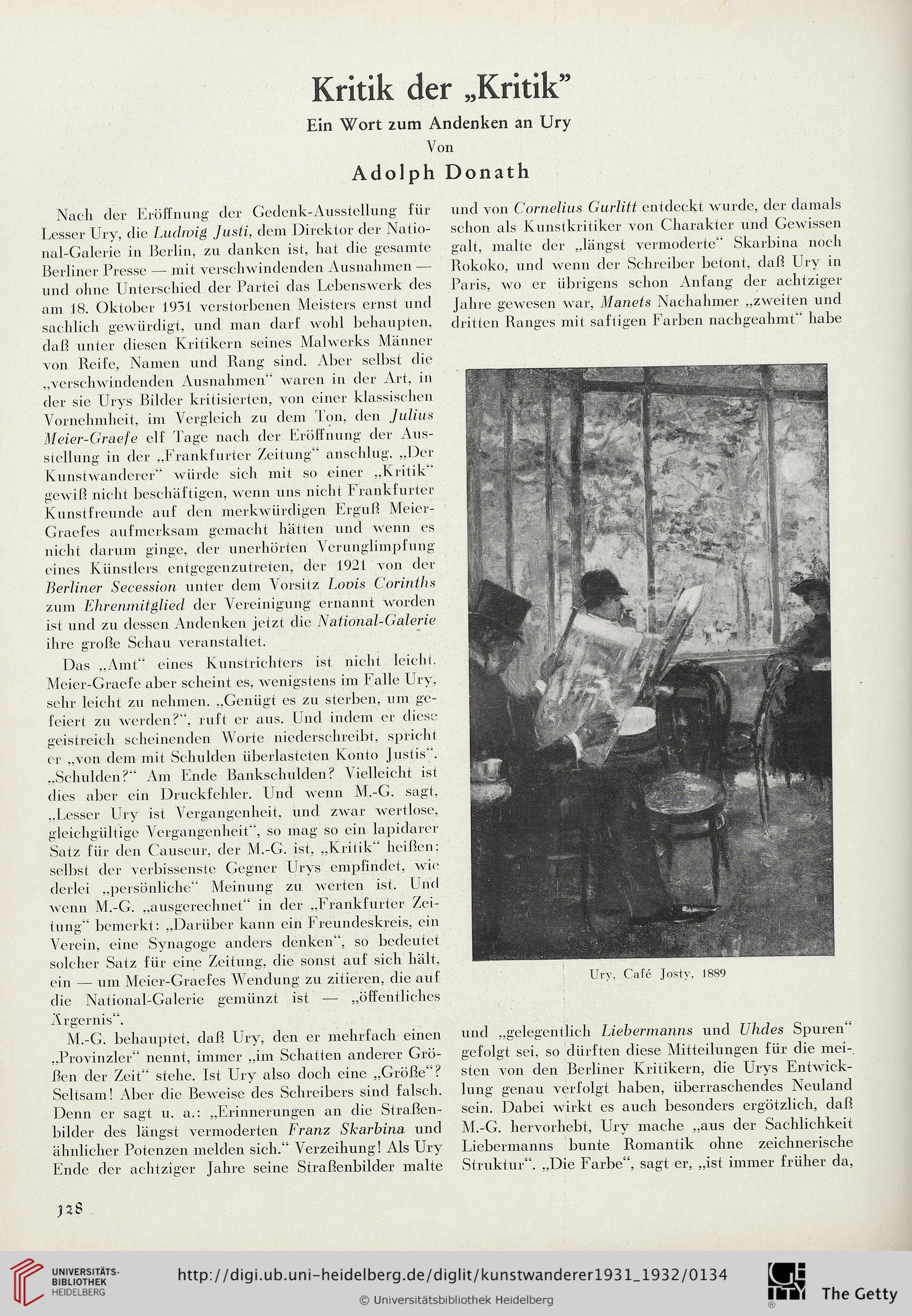Kritik der „Kritik”
Ein Wort zum Andenken an Ury
Von
Adolph Donath
Naeli der Eröffnung der Gedenk-Ausstellung für
Lesser Ury, die Luclwig Justi, denr Direktor der Natio-
nal-Galerie in Berlin, zu dankcn ist, hat die gesamte
Berliner Presse — mit verscliwindenden Ausnahmen —
und ohne Unterschied der Partei das Lebenswerk des
am 18. Oktober 1931 verstorbenen Meisters ernst und
sachlich gewürdigt, und man darf wohl behaupten,
daß unter diesen Kritikern seines Malwerks Männer
von Reife, Namen und Rang sind. Aber selbst die
„verschwindenden Ausnahmcn“ waren in der Art, in
der sie Urys Bilder kritisierten, von einer klassischen
Vornehmheit, im Vergleich zu dem Ton, den Julius
Meier-Graefe elf Tage nach der Eröffnung der Aus-
stellung in der „Frankfurter Zeitung“ anschlug. „Der
Kunstwanderer“ würde sich mit so einer „Kritik“
gewiß nicht beschäftigen, wenn uns nicht Frankfurter
Kunstfreunde auf den merkwürdigen Erguß Meier-
Graefes aufmerksam gemacht hätten und wenn es
nicht darum ginge, der unerhörten Verunglimpfung
eines Künstlers entgegenzutreten, der 1921 von der
Berliner Secession unter dem Vorsitz Lovis Corinths
zum Ehrenmitgliecl der Vereinigung ernannt worden
ist und zu dessen Andenken jetzt die National-Galerie
ihre große Scliau veranstaltet.
Das „Amt“ eines Kunstrichters ist niclit leicht.
Meier-Graefe aber scheint es, wenigstens im Falle Ury,
sehr leicht zu nehmen. „Geniigt es zu sterben, um ge-
feiert zu werden?“, ruft er aus. Und indem er diese
geistreich scheinenden Worte niederschreibt, spricht
er „von dem mit Schulden überlasteten Konto Justis“.
„Schulden?“ Am Ende Bankschulden ? Vielleicht ist
dies aber ein Druckfehler. Und wenn M.-G. sagt,
„Lesser Ury ist Vergangenheit, und zwar wertlose,
gleichgültige Vergangenheit“, so mag so ein lapidarer
Satz für den Causeur, der M.-G. ist, „Kritik“ heißen;
selbst der verbissenste Gegner Urys empfindet, wic
derlei „persönliche“ Meinung zu werten ist. Und
wenn M.-G. „ausgerechnet“ in der „Frankfurter Zei-
tung“ bemerkt: „Darüber kann ein Ereundeskreis, ein
Verein, eine Synagoge anders denken“, so bedeutet
solcher Satz für eine Zeitung, die sonst auf sicli liält,
ein — um Meier-Graefes Wendung zu zitieren, die auf
die National-Galerie gemünzt ist — „öffentliches
Argernis“.
M.-G. behaupiet, daß Ury, den er mehrfach einen
„Provinzler“ nennt, immer „irn Schatten anderer Grö-
ßen der Zeit“ stehe. Ist Ury also doch eine „Größe“?
Seltsam! Aber die Beweise des Schreibers sind falscli.
Denn er sagt u. a.: „Erinnerungen an die Straßen-
bilder des längst vermoderten Franz Skarbina und
ähnlicher Potenzen melden sich.“ Verzeihung! Als Ury
Ende der achtziger Jahre seine Straßenbilder malte
und von Cornelius Gurlitt entdeckt wurde, der damals
schon als Kunstkritiker von Charakter und Gewissen
galt, malte der „längst vermoderte“ Skarbina noeli
Rokoko, und wenn der Schreiber betont, daß Ury in
Paris, wo er übrigens schon Anfang der achtziger
Jahre gewesen war, Manets Nachahmer „zweiten und
dritten Ranges mit saftigen Farben nachgeahmt“ lmbe
Ury, Cafe Josty, 1889
und „gelegentlich Liebermanns und Uhcles Spuren“
gefolgt sei, so diirften diese Mitteilungen für die mei-
sten von den Berliner Kritikern, die Urys Entwick-
lung genau verfolgt haben, tiberraschendes Neuland
sein. Dabei wirkt es auch besonders ergötzlich, daß
M.-G. hervorhebt, Ury mache „aus der Sachlichkeit
Liebermanns bunte Romantik ohne zeichnerische
Struktur“. „Die Farbe“, sagt er, „ist immer früher da,
Ein Wort zum Andenken an Ury
Von
Adolph Donath
Naeli der Eröffnung der Gedenk-Ausstellung für
Lesser Ury, die Luclwig Justi, denr Direktor der Natio-
nal-Galerie in Berlin, zu dankcn ist, hat die gesamte
Berliner Presse — mit verscliwindenden Ausnahmen —
und ohne Unterschied der Partei das Lebenswerk des
am 18. Oktober 1931 verstorbenen Meisters ernst und
sachlich gewürdigt, und man darf wohl behaupten,
daß unter diesen Kritikern seines Malwerks Männer
von Reife, Namen und Rang sind. Aber selbst die
„verschwindenden Ausnahmcn“ waren in der Art, in
der sie Urys Bilder kritisierten, von einer klassischen
Vornehmheit, im Vergleich zu dem Ton, den Julius
Meier-Graefe elf Tage nach der Eröffnung der Aus-
stellung in der „Frankfurter Zeitung“ anschlug. „Der
Kunstwanderer“ würde sich mit so einer „Kritik“
gewiß nicht beschäftigen, wenn uns nicht Frankfurter
Kunstfreunde auf den merkwürdigen Erguß Meier-
Graefes aufmerksam gemacht hätten und wenn es
nicht darum ginge, der unerhörten Verunglimpfung
eines Künstlers entgegenzutreten, der 1921 von der
Berliner Secession unter dem Vorsitz Lovis Corinths
zum Ehrenmitgliecl der Vereinigung ernannt worden
ist und zu dessen Andenken jetzt die National-Galerie
ihre große Scliau veranstaltet.
Das „Amt“ eines Kunstrichters ist niclit leicht.
Meier-Graefe aber scheint es, wenigstens im Falle Ury,
sehr leicht zu nehmen. „Geniigt es zu sterben, um ge-
feiert zu werden?“, ruft er aus. Und indem er diese
geistreich scheinenden Worte niederschreibt, spricht
er „von dem mit Schulden überlasteten Konto Justis“.
„Schulden?“ Am Ende Bankschulden ? Vielleicht ist
dies aber ein Druckfehler. Und wenn M.-G. sagt,
„Lesser Ury ist Vergangenheit, und zwar wertlose,
gleichgültige Vergangenheit“, so mag so ein lapidarer
Satz für den Causeur, der M.-G. ist, „Kritik“ heißen;
selbst der verbissenste Gegner Urys empfindet, wic
derlei „persönliche“ Meinung zu werten ist. Und
wenn M.-G. „ausgerechnet“ in der „Frankfurter Zei-
tung“ bemerkt: „Darüber kann ein Ereundeskreis, ein
Verein, eine Synagoge anders denken“, so bedeutet
solcher Satz für eine Zeitung, die sonst auf sicli liält,
ein — um Meier-Graefes Wendung zu zitieren, die auf
die National-Galerie gemünzt ist — „öffentliches
Argernis“.
M.-G. behaupiet, daß Ury, den er mehrfach einen
„Provinzler“ nennt, immer „irn Schatten anderer Grö-
ßen der Zeit“ stehe. Ist Ury also doch eine „Größe“?
Seltsam! Aber die Beweise des Schreibers sind falscli.
Denn er sagt u. a.: „Erinnerungen an die Straßen-
bilder des längst vermoderten Franz Skarbina und
ähnlicher Potenzen melden sich.“ Verzeihung! Als Ury
Ende der achtziger Jahre seine Straßenbilder malte
und von Cornelius Gurlitt entdeckt wurde, der damals
schon als Kunstkritiker von Charakter und Gewissen
galt, malte der „längst vermoderte“ Skarbina noeli
Rokoko, und wenn der Schreiber betont, daß Ury in
Paris, wo er übrigens schon Anfang der achtziger
Jahre gewesen war, Manets Nachahmer „zweiten und
dritten Ranges mit saftigen Farben nachgeahmt“ lmbe
Ury, Cafe Josty, 1889
und „gelegentlich Liebermanns und Uhcles Spuren“
gefolgt sei, so diirften diese Mitteilungen für die mei-
sten von den Berliner Kritikern, die Urys Entwick-
lung genau verfolgt haben, tiberraschendes Neuland
sein. Dabei wirkt es auch besonders ergötzlich, daß
M.-G. hervorhebt, Ury mache „aus der Sachlichkeit
Liebermanns bunte Romantik ohne zeichnerische
Struktur“. „Die Farbe“, sagt er, „ist immer früher da,