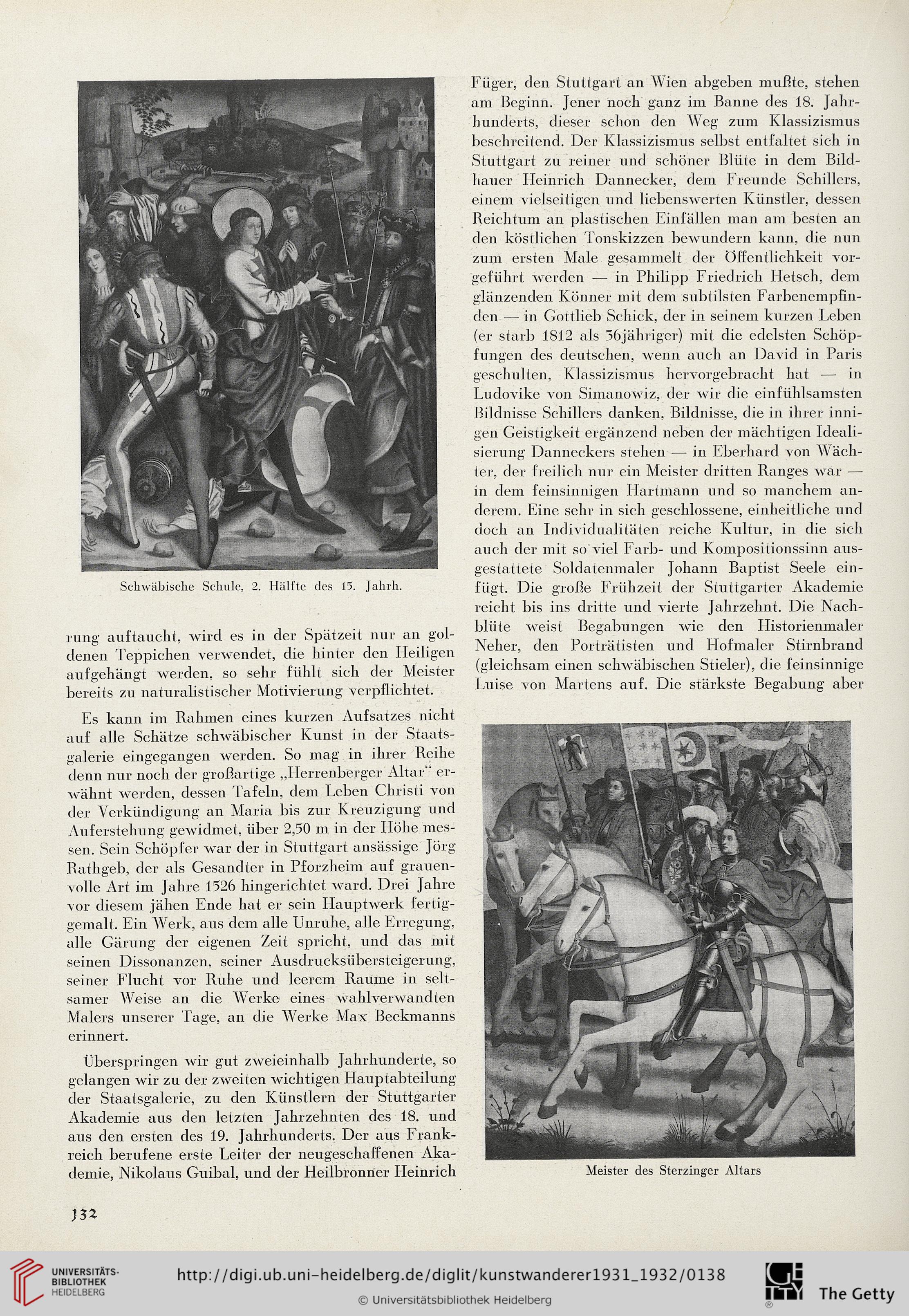Schwäbische Schule, 2. Hälfte des 15. Jalirh.
rung auftauclit, wird es in der Spätzeit nur an gol-
denen Teppichen verwendet, die hinter den Heiligen
aufgehängt werden, so sehr flihlt sich der Meister
bereits zu naturalistischer Motivierung verpflichtet.
Es kann im Rahmen eines kurzen Äufsatzes nicht
auf alle Schätze schwäbischer Kunst in der Staats-
galerie eingegangen werden. So mag in ilirer Reihe
denn nur noch der großartige „Herrenberger Alla r‘* er-
wähnt werden, dessen Tafeln, dem Leben Christi von
der Yerkündigung an Maria bis zur Kreuzigung und
Auferstehung gewidmet, iiber 2,50 m in der Höhe mes-
sen. Sein Schöpfer war der in Stuttgart ansässige Jörg
Rathgeb, der als Gesandter in Pforzheim auf grauen-
volle Art im Jahre 1526 hingerichtet ward. Drei Jahre
vor diesem jälien Ende hat er sein Hauptwerk fertig-
gemalt. Ein Werk, aus dem alle Unruhe, alle Erregung,
alle Gärung der eigenen Zeit spricht, und das mit
seinen Dissonanzen, seiner Ausdrucksübersteigerung,
seiner Flucht vor Ruhe und leerern Raume in selt-
samer Weise an die Werke eines wahlverwandten
Malers unserer lage, an die Werke Max Beckmanns
erinnert.
Überspringen wir gut zweieinhalb Jahrhunderte, so
gelangen wir zu der zweiten wichtigen Hauptabteilung
der Staatsgalerie, zu den Kiinstlern der Stuttgarter
Akademie aus den letzten Jahrzehnten des 18. und
aus den ersten des 19. Jahrhunderts. Der aus Frank-
reich berufene erste Leiter der neugeschaffenen Aka-
demie, Nikolaus Guibal, und der Heilbronner Heinrich
m
Eüger, den Stuttgart an Wien abgeben muffte, stehen
am Beginn. Jener noch ganz im Banne des 18. Jahr-
hunderts, dieser schon den Weg zum Klassizismus
beschreitend. Der Klassizismus seflist entfaltet sich in
Stuttgart zu reiner und schöner Blüte in dem Bild-
liauer Heinrich Dannecker, dem Freunde Schillers,
einem vielseitigen und liebenswerten Künstler, dessen
Reichtum an plastischen Einfällen man am besten an
den köstlichen Tonskizzen bewundern kann, die nun
zum ersten Male gesammelt der öffentlichkeit vor-
gefiihrt werden — in Philipp Friedrich Hetsch, dem
glänzenden Könner mit dem subtilsten Farbenempfin-
clen — in Gottlieb Schick, der in seinem kurzen Leben
(er starb 1812 als 36jähriger) mit die edelsten Schöp-
fungen des deutschen, wenn auch an David in Paris
geschulten, Klassizismus hervorgebracht hat — in
Ludovike von Simanowiz, der wir die einfühlsamsten
Bildnisse Schillers danken, Bildnisse, die in ihrer inni-
gen Geistigkeit ergänzend neben der mächtigen Ideali-
sierung Danneckers stehen — in Eberhard von Wäch-
ter, der freilich nur ein Meister dritten Ranges war —
in dem feinsinnigen Hartmann und so manchem an-
derem. Eine selir in sicli geschlossene, einheitliche und
doch an Individualitäten reiche Kultur, in die sich
auch der mit so viel Farb- und Kompositionssinn aus-
gestattete Soldatenmaler Johann Baptist Seele ein-
fügt. Die grofle Frühzeit der Stuttgarter Akademie
reicht bis ins dritte und vierte Jahrzehnt. Die Nach-
bliite weist Begaliungen wie den Historienmaler
Neher, den Porträtisten und llofmaler Stirnbrand
(gleichsam einen schwäbischen Stieler), die feinsinnige
Luise von Martens auf. Die stärkste Begabung aber
Meister des Sterzinger Altars
rung auftauclit, wird es in der Spätzeit nur an gol-
denen Teppichen verwendet, die hinter den Heiligen
aufgehängt werden, so sehr flihlt sich der Meister
bereits zu naturalistischer Motivierung verpflichtet.
Es kann im Rahmen eines kurzen Äufsatzes nicht
auf alle Schätze schwäbischer Kunst in der Staats-
galerie eingegangen werden. So mag in ilirer Reihe
denn nur noch der großartige „Herrenberger Alla r‘* er-
wähnt werden, dessen Tafeln, dem Leben Christi von
der Yerkündigung an Maria bis zur Kreuzigung und
Auferstehung gewidmet, iiber 2,50 m in der Höhe mes-
sen. Sein Schöpfer war der in Stuttgart ansässige Jörg
Rathgeb, der als Gesandter in Pforzheim auf grauen-
volle Art im Jahre 1526 hingerichtet ward. Drei Jahre
vor diesem jälien Ende hat er sein Hauptwerk fertig-
gemalt. Ein Werk, aus dem alle Unruhe, alle Erregung,
alle Gärung der eigenen Zeit spricht, und das mit
seinen Dissonanzen, seiner Ausdrucksübersteigerung,
seiner Flucht vor Ruhe und leerern Raume in selt-
samer Weise an die Werke eines wahlverwandten
Malers unserer lage, an die Werke Max Beckmanns
erinnert.
Überspringen wir gut zweieinhalb Jahrhunderte, so
gelangen wir zu der zweiten wichtigen Hauptabteilung
der Staatsgalerie, zu den Kiinstlern der Stuttgarter
Akademie aus den letzten Jahrzehnten des 18. und
aus den ersten des 19. Jahrhunderts. Der aus Frank-
reich berufene erste Leiter der neugeschaffenen Aka-
demie, Nikolaus Guibal, und der Heilbronner Heinrich
m
Eüger, den Stuttgart an Wien abgeben muffte, stehen
am Beginn. Jener noch ganz im Banne des 18. Jahr-
hunderts, dieser schon den Weg zum Klassizismus
beschreitend. Der Klassizismus seflist entfaltet sich in
Stuttgart zu reiner und schöner Blüte in dem Bild-
liauer Heinrich Dannecker, dem Freunde Schillers,
einem vielseitigen und liebenswerten Künstler, dessen
Reichtum an plastischen Einfällen man am besten an
den köstlichen Tonskizzen bewundern kann, die nun
zum ersten Male gesammelt der öffentlichkeit vor-
gefiihrt werden — in Philipp Friedrich Hetsch, dem
glänzenden Könner mit dem subtilsten Farbenempfin-
clen — in Gottlieb Schick, der in seinem kurzen Leben
(er starb 1812 als 36jähriger) mit die edelsten Schöp-
fungen des deutschen, wenn auch an David in Paris
geschulten, Klassizismus hervorgebracht hat — in
Ludovike von Simanowiz, der wir die einfühlsamsten
Bildnisse Schillers danken, Bildnisse, die in ihrer inni-
gen Geistigkeit ergänzend neben der mächtigen Ideali-
sierung Danneckers stehen — in Eberhard von Wäch-
ter, der freilich nur ein Meister dritten Ranges war —
in dem feinsinnigen Hartmann und so manchem an-
derem. Eine selir in sicli geschlossene, einheitliche und
doch an Individualitäten reiche Kultur, in die sich
auch der mit so viel Farb- und Kompositionssinn aus-
gestattete Soldatenmaler Johann Baptist Seele ein-
fügt. Die grofle Frühzeit der Stuttgarter Akademie
reicht bis ins dritte und vierte Jahrzehnt. Die Nach-
bliite weist Begaliungen wie den Historienmaler
Neher, den Porträtisten und llofmaler Stirnbrand
(gleichsam einen schwäbischen Stieler), die feinsinnige
Luise von Martens auf. Die stärkste Begabung aber
Meister des Sterzinger Altars