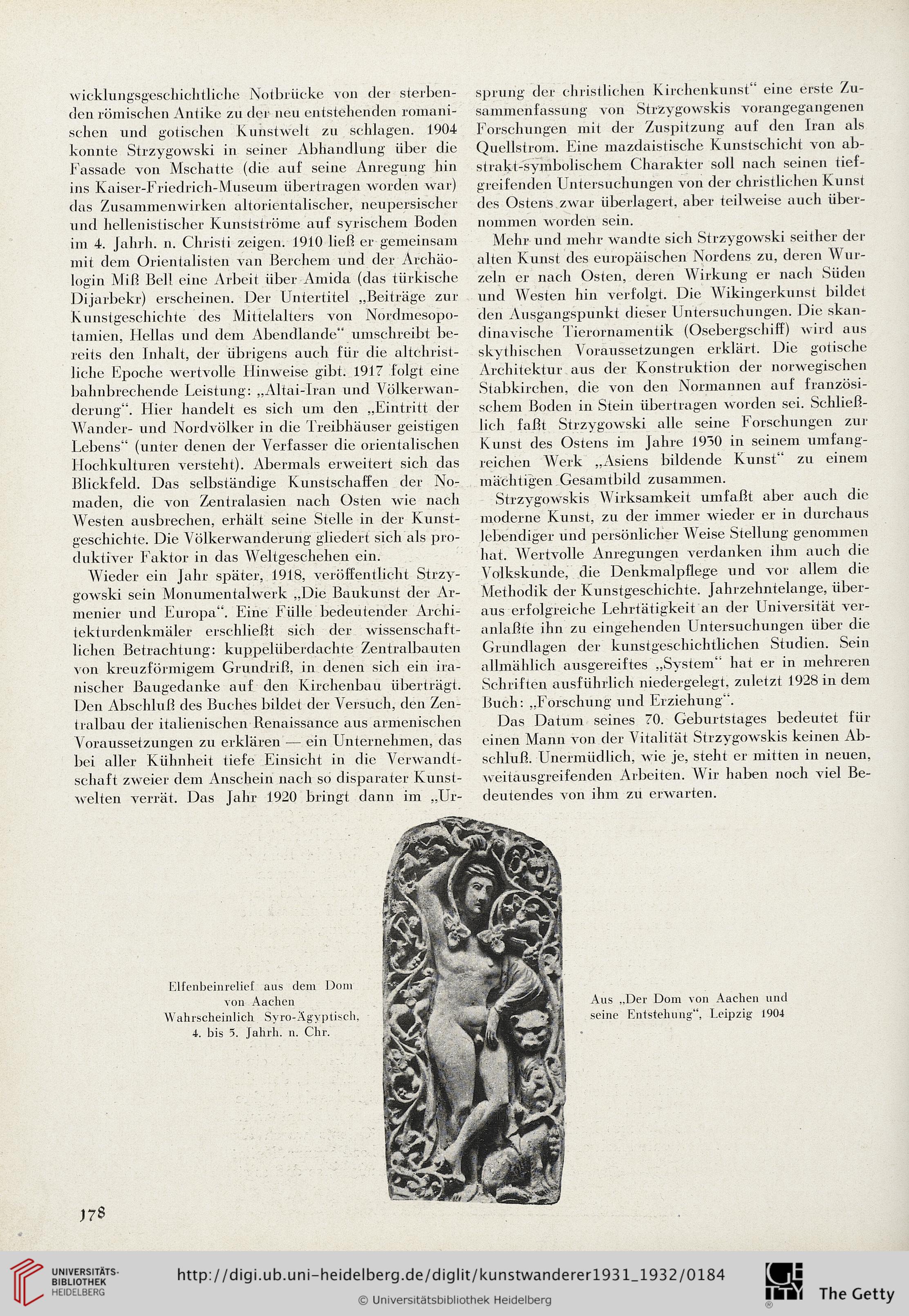wicklungsgeschichtliche Notbrlicke von der sterben-
den römischen Antike zu der neu entstehenden romani-
schen und gotischen Kunstwelt zu schlagen. 1904
konnte Strzygowski in seiner Abhandlung über die
Fassade von Mschatte (die aul seine Anregung hin
ins Kaiser-Friedrich-Museum übertragen worden war)
das Zusammenwirken altorientalischer, neupersischer
und hellenistischer Kunstströme auf syrischem Boden
im 4. Jahrh. n. Christi zeigen. 1910 ließ er gemeinsam
in.it dem Orientalisten van Berchem und der Archäo-
login Miß Bell eine Arbeit tiber Amida (das türkische
Dijarbekr) erscheinen. Der Untertitel „Beiträge zur
Kunstgeschichte des Mittelalters von Nordmesopo-
tamien, Hellas und dem Abendlande“ umschreibt be-
reits den Inhalt, der übrigens auch fiir die altchrist-
liche Epoche wertvolle Hinweise gibt. 1917 folgt eine
bahnbrechende Leistung: „Altai-Iran und Yölkerwan-
derüng“. Hier handelt es sich uni den „Eintritt der
Wander- und Nordvölker in die Treibhäuser geistigen
Lebens“ (unter denen der Yerfasser die orientalischen
Hochkulturen versteht). Abermals erweitert sich das
Blickfeld. Das selbständige Kunstschaffen der No-
maden, die von Zentralasien nacli Osten wie nach
Westen ausbrechen, erhält seine Stelle in der Kunst-
geschichte. Die Yölkerwanderung gliedert sich als pro-
duktiver Faktor in das Weltgeschehen ein.
Wieder ein Jahr später, 1918, veröffentlicht Strzy-
gowski scin Monumentalwerk „Die Baukunst der Ar-
menier und Europa“. Eine Fülle bedeutender Archi-
tekturdenkmäler erschließt sich der wissenschaft-
lichen Betrachtung: kuppelüberdachte Zentralbauten
von kreuzförmigem Grundriß, in denen sich ein ira-
nischer Baugedanke auf den Kirchenbau überträgt.
Den Abschluß des Buches bildet der Versuch, den Zen-
tralbau der italienischen Renaissance aus annenischen
Yoraussetzungen zu erklären — ein Unternehmen, das
bci aller Kühnheit tiefe Einsicht in die Verwandt-
schaft zweier dem Anschein riacli so disparater Kunst-
welten verrät. Das Jahr 1920 bringt dann im „Ur-
sprung der christlichen Kirchenkunst“ eine erste Zu-
sammenfassung von Strzygowskis vorangegangenen
Forschungen mit der Zuspitzung auf den Iran als
Quellstrom. Eine mazdaistische Kunstschicht von ab-
strakt-symbolischem Charakter soll nach seinen tief-
greifenden Untersuchungen von der christlichen Kunsi
des Ostens zwar überlagert, aber teilweise auch über-
nommen worden sein.
Mehr und mehr wandte sich Strzygowski seither der
alten Kunst des europäischen Nordens zu, deren Wur-
zeln er nach Osten, deren Wirkung er nach Süden
und Westen hin verfolgt. Die Wikingerkunst bildet
den Ausgangspunkt dieser Untersuchungen. Die skan-
dinavische Tierornamentik (Osebergschiff) wird aus
skythischen Yoraussetzungen erklärt. Die gotische
Architektur aus der Konstruktion der norwegischen
Stabkirchen, die von den Normannen auf französi-
scliem Boden in Stein übertragen worden sei. Schließ-
licli f'aßt Strzygowski alle seine Forschungen zur
Kunst des Ostens im jahre 1930 in seinem umfang-
reichen AVerk „Asiens bildende Kunst" zu einem
mächtigen Gesamtbild zusammen.
Strzygowskis Wirksamkeit umfaßt aber auch die
moderne Kunst, zu der immer wieder er in durchaus
lebendiger und persönlicher Weise Stellung genonnnen
hat. Wertvolle Anregungen verdanken ihm auch die
Volkskunde, die Denkmalpflege und vor allem die
Methodik der Kunstgeschichte. Jahrzehntelange, über-
aus erfolgreiche Lehrtätigkeit an der Universität ver-
anlaßte ihn zu eingehenden Untersuchungen über die
Grundlagen der kunstgeschichtlichen Studien. Sein
allmählich ausgereiftes „System“ hat er in mehreren
Schriften ausführlich niedergelegt, zuletzt 1928 in dem
Buch: „Forschung und Erziehung".
Das Datum seines 70. Geburtstages bedeutet für
einen Mann von der Vitalität Strzygowskis keinen Ab-
schluß. Unermüdlich, wie je, steht er mitten in neuen,
weitausgreifenden Arbeiten. Wir haben noch viel Be-
deutendes von ihm zu erwarten.
Elfenbeinrelief aus dem Dom
von Aachen
Wahrscheinlich Syro-Ägyptisch,
4. bis 5. jalirh. n. Chr.
Aus ,.Der Dom von Aachen und
seine Entsteluing“, Leipzig 1904
jrs
den römischen Antike zu der neu entstehenden romani-
schen und gotischen Kunstwelt zu schlagen. 1904
konnte Strzygowski in seiner Abhandlung über die
Fassade von Mschatte (die aul seine Anregung hin
ins Kaiser-Friedrich-Museum übertragen worden war)
das Zusammenwirken altorientalischer, neupersischer
und hellenistischer Kunstströme auf syrischem Boden
im 4. Jahrh. n. Christi zeigen. 1910 ließ er gemeinsam
in.it dem Orientalisten van Berchem und der Archäo-
login Miß Bell eine Arbeit tiber Amida (das türkische
Dijarbekr) erscheinen. Der Untertitel „Beiträge zur
Kunstgeschichte des Mittelalters von Nordmesopo-
tamien, Hellas und dem Abendlande“ umschreibt be-
reits den Inhalt, der übrigens auch fiir die altchrist-
liche Epoche wertvolle Hinweise gibt. 1917 folgt eine
bahnbrechende Leistung: „Altai-Iran und Yölkerwan-
derüng“. Hier handelt es sich uni den „Eintritt der
Wander- und Nordvölker in die Treibhäuser geistigen
Lebens“ (unter denen der Yerfasser die orientalischen
Hochkulturen versteht). Abermals erweitert sich das
Blickfeld. Das selbständige Kunstschaffen der No-
maden, die von Zentralasien nacli Osten wie nach
Westen ausbrechen, erhält seine Stelle in der Kunst-
geschichte. Die Yölkerwanderung gliedert sich als pro-
duktiver Faktor in das Weltgeschehen ein.
Wieder ein Jahr später, 1918, veröffentlicht Strzy-
gowski scin Monumentalwerk „Die Baukunst der Ar-
menier und Europa“. Eine Fülle bedeutender Archi-
tekturdenkmäler erschließt sich der wissenschaft-
lichen Betrachtung: kuppelüberdachte Zentralbauten
von kreuzförmigem Grundriß, in denen sich ein ira-
nischer Baugedanke auf den Kirchenbau überträgt.
Den Abschluß des Buches bildet der Versuch, den Zen-
tralbau der italienischen Renaissance aus annenischen
Yoraussetzungen zu erklären — ein Unternehmen, das
bci aller Kühnheit tiefe Einsicht in die Verwandt-
schaft zweier dem Anschein riacli so disparater Kunst-
welten verrät. Das Jahr 1920 bringt dann im „Ur-
sprung der christlichen Kirchenkunst“ eine erste Zu-
sammenfassung von Strzygowskis vorangegangenen
Forschungen mit der Zuspitzung auf den Iran als
Quellstrom. Eine mazdaistische Kunstschicht von ab-
strakt-symbolischem Charakter soll nach seinen tief-
greifenden Untersuchungen von der christlichen Kunsi
des Ostens zwar überlagert, aber teilweise auch über-
nommen worden sein.
Mehr und mehr wandte sich Strzygowski seither der
alten Kunst des europäischen Nordens zu, deren Wur-
zeln er nach Osten, deren Wirkung er nach Süden
und Westen hin verfolgt. Die Wikingerkunst bildet
den Ausgangspunkt dieser Untersuchungen. Die skan-
dinavische Tierornamentik (Osebergschiff) wird aus
skythischen Yoraussetzungen erklärt. Die gotische
Architektur aus der Konstruktion der norwegischen
Stabkirchen, die von den Normannen auf französi-
scliem Boden in Stein übertragen worden sei. Schließ-
licli f'aßt Strzygowski alle seine Forschungen zur
Kunst des Ostens im jahre 1930 in seinem umfang-
reichen AVerk „Asiens bildende Kunst" zu einem
mächtigen Gesamtbild zusammen.
Strzygowskis Wirksamkeit umfaßt aber auch die
moderne Kunst, zu der immer wieder er in durchaus
lebendiger und persönlicher Weise Stellung genonnnen
hat. Wertvolle Anregungen verdanken ihm auch die
Volkskunde, die Denkmalpflege und vor allem die
Methodik der Kunstgeschichte. Jahrzehntelange, über-
aus erfolgreiche Lehrtätigkeit an der Universität ver-
anlaßte ihn zu eingehenden Untersuchungen über die
Grundlagen der kunstgeschichtlichen Studien. Sein
allmählich ausgereiftes „System“ hat er in mehreren
Schriften ausführlich niedergelegt, zuletzt 1928 in dem
Buch: „Forschung und Erziehung".
Das Datum seines 70. Geburtstages bedeutet für
einen Mann von der Vitalität Strzygowskis keinen Ab-
schluß. Unermüdlich, wie je, steht er mitten in neuen,
weitausgreifenden Arbeiten. Wir haben noch viel Be-
deutendes von ihm zu erwarten.
Elfenbeinrelief aus dem Dom
von Aachen
Wahrscheinlich Syro-Ägyptisch,
4. bis 5. jalirh. n. Chr.
Aus ,.Der Dom von Aachen und
seine Entsteluing“, Leipzig 1904
jrs