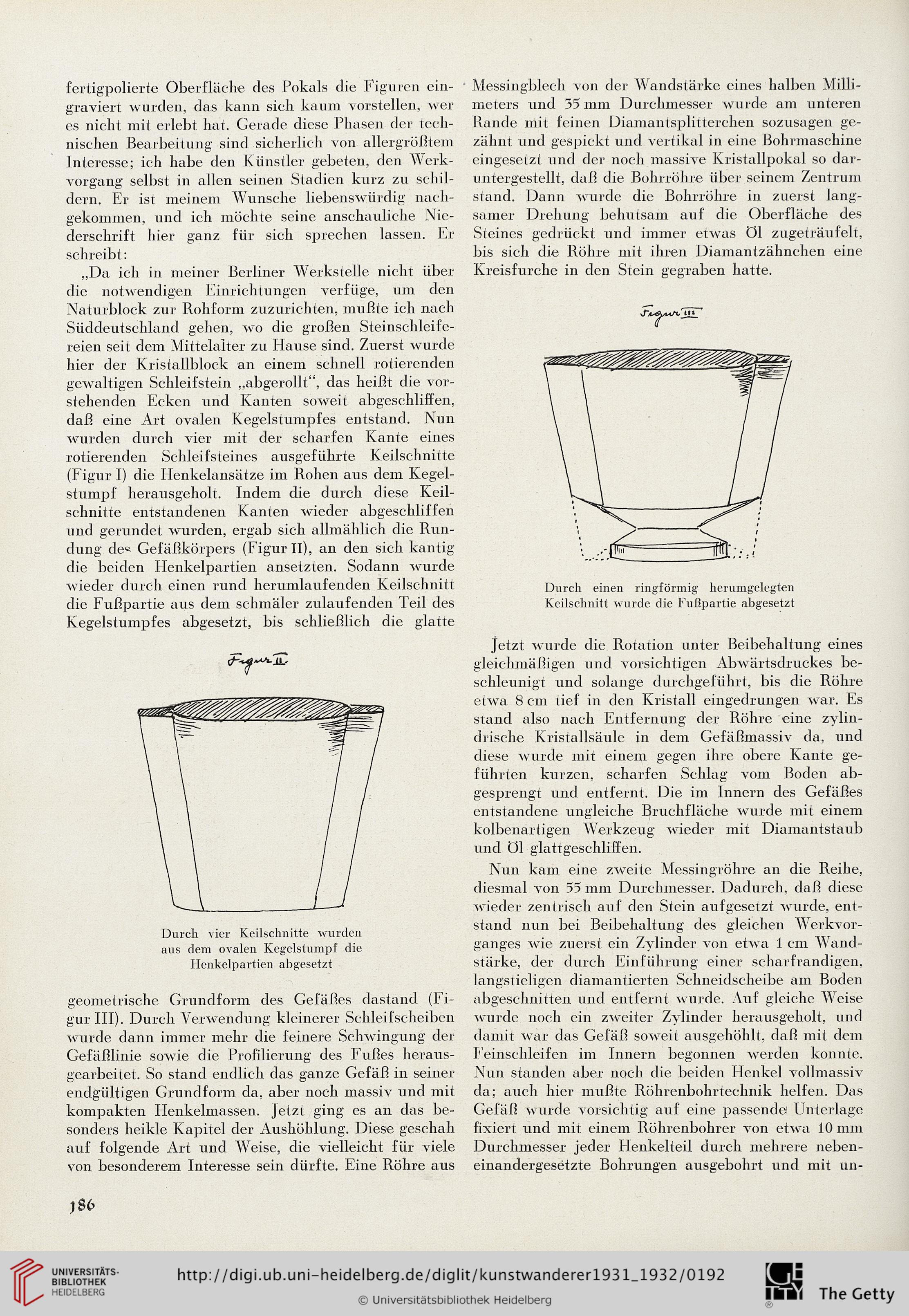fertigpolierte Oberfläche des Pokals die Figuren ein-
graviert wurden, das kann sieli kaum vorstellen, wer
es nicht mit erlebt hat. Gerade diese Phasen der tech-
nischen Bearbeitung sind sicherlich von allergrößtem
Interesse; ich habe den Künstler gebeten, den Werk-
vorgang selbst in allen seinen Stadien kurz zu schil-
dern. Er ist meinem Wunsche liebenswiirdig nach-
gekommen, und ich möchte seine anschauliche Nie-
derschrift hier ganz für sich sprechen Jassen. Er
schreibt:
„Da ich in meiner Berliner Werkstelle nicht tiber
die notwendigen Einrichtungen verfüge, um den
Naturblock zur Rohform zuzurichten, mußte ich nach
Süddeutschland gelien, wo die großen Steinschleife-
reien seit dem Mittelalter zu Idause sind. Zuerst wurde
hier der Kristallblock an einem schnell rotierenden
gewaltigen Schleifstein „abgerollt“, das heißt die vor-
stehenden Ecken und Kanten soweit abgeschliffen,
daß eine Art ovalen Kegelstumpfes entstand. Nun
wurden durch vier mit der scharfen Kante eines
rotierenden Schleifsteines ausgefiihrte Keilschnitte
(Figur 1) die Henkelansätze im Rohen aus dem Kegel-
stumpf herausgeholt. Indem die durch diese Keil-
schnitte entstandenen Kanten wieder abgeschlif’fen
u nd gerundet wurden, ergab sich allmählich die Run-
dung dec- Gefäßkörpers (Figurll), an den sich kantig
die beiden Henkelpartien ansetzten. Sodann wurde
wieder durch einen rund herumlaufenden Keilschnitt
die Fußpartie aus dem schmäler zulaufenden Teil des
Kegelstumpf'es abgesetzt, bis schließlich die glatte
Durch vier Keilschnitte wurden
aus dem ovalen Kegelstumpf die
Henkelpartien abgesetzt
geometrische Grundfonn des Gefäß.es dastand (Fi-
gurlll). Durch Yerwendung kleinerer Schleifscheiben
wurde dann imrner mehr die feinere Schwingung der
Gefäßlinie sowie die Profilierung des Fußes lieraus-
gearbeitet. So stand endlich das ganze Gefäß in seiner
endgültigen Grundfonn da, aber noch massiv und mit
kompakten Henkelmassen. jetzt ging es an das be-
sonders heikle Kapitel der Aushöhlung. Diese geschah
auf folgende Art und Weise, die vielleicht für viele
von besonderem Interesse sein dürfte. Eine Röhre aus
Messingblech von der Wandstärke eines halben Milli-
meters und 35 mm Durchmesser wurde am unteren
Rande mit feinen Diamantsplitterchen sozusagen ge-
zälint und gespickt und vertikal in eine Bohrmaschine
eingesetzt und der noch massive Kristallpokal so dar-
untergestellt, daß die Bohrröhre über seinem Zentrum
stand. Dann wurde die Bohrröhre in zuerst lang-
samer Drehung behutsam auf die Oberfläche des
Steines gedrückt und immer etwas Ö1 zugeträuf’elt,
bis sich die Röhre mit ihren Diamantzähnchen eine
Kreisfurche in den Stein gegraben hatte.
Durch einen ringförmig herumgelegten
Keilschnitt wurde die Fußpartie abgesetzt
Jetzt wurde die Rotation unter Beibehaltung eines
gleichmäßigen und vorsichtigen Abwärtsdruckes be-
schleunigt und solange durchgeführt, bis die Röhre
etwa 8 cm tief in den Kristall eingedrungen war. Es
stand also nach Entfernung der Röhre eine zylin-
drische Kristallsäule in dem Gefäßmassiv da, und
diese wurde mit eineni gegen ihre obere Kante ge-
führten kurzen, scharfen Schlag vom Boden ab-
gesprengt und entfernt. Die im Innern des Gef’äßes
entstandene ungleiche Rruchfläche wurde mit einem
kolbenartigen Werkzeug wieder mit Diamantstaub
und ÖI glattgeschliffen.
Nun kam eine zweite Messingröhre an die Reihe,
diesmal von 55 nun Durchmesser. Dadurch, däß diese
wieder zentrisch auf den Stein aufgesetzt wurde, ent-
stand nun bei Beibehaltung des gleichen Werkvor-
ganges wie zuerst ein Zylinder von etwa 1 cm Wand-
stärke, der durch Einführung einer scharfrandigen,
langstieligen diamantierten Schneidscheibe am Boden
abgeschnitten und entfernt wurde. Auf gleiche Weise
wurde noch ein zweiter Zylinder herausgeholt, und
damit war das Gef’äß soweit ausgehöhlt, daß mit dem
leinschleifen im Innern begonnen werden konnte.
Nun standen aber noch die beiden Henkel vollmassiv
da; auch hier mußte Röhrenbohrtechnik helfen. Das
Gefäß wurde vorsichtig auf eine passende Unterlage
fixiert und mit einem Röhrenbohrer von etwa 10 mm
Durchmesser jeder Flenkelteil durch mehrere neben-
einandergesetzte Bohrungen ausgebohrt und mit un-
graviert wurden, das kann sieli kaum vorstellen, wer
es nicht mit erlebt hat. Gerade diese Phasen der tech-
nischen Bearbeitung sind sicherlich von allergrößtem
Interesse; ich habe den Künstler gebeten, den Werk-
vorgang selbst in allen seinen Stadien kurz zu schil-
dern. Er ist meinem Wunsche liebenswiirdig nach-
gekommen, und ich möchte seine anschauliche Nie-
derschrift hier ganz für sich sprechen Jassen. Er
schreibt:
„Da ich in meiner Berliner Werkstelle nicht tiber
die notwendigen Einrichtungen verfüge, um den
Naturblock zur Rohform zuzurichten, mußte ich nach
Süddeutschland gelien, wo die großen Steinschleife-
reien seit dem Mittelalter zu Idause sind. Zuerst wurde
hier der Kristallblock an einem schnell rotierenden
gewaltigen Schleifstein „abgerollt“, das heißt die vor-
stehenden Ecken und Kanten soweit abgeschliffen,
daß eine Art ovalen Kegelstumpfes entstand. Nun
wurden durch vier mit der scharfen Kante eines
rotierenden Schleifsteines ausgefiihrte Keilschnitte
(Figur 1) die Henkelansätze im Rohen aus dem Kegel-
stumpf herausgeholt. Indem die durch diese Keil-
schnitte entstandenen Kanten wieder abgeschlif’fen
u nd gerundet wurden, ergab sich allmählich die Run-
dung dec- Gefäßkörpers (Figurll), an den sich kantig
die beiden Henkelpartien ansetzten. Sodann wurde
wieder durch einen rund herumlaufenden Keilschnitt
die Fußpartie aus dem schmäler zulaufenden Teil des
Kegelstumpf'es abgesetzt, bis schließlich die glatte
Durch vier Keilschnitte wurden
aus dem ovalen Kegelstumpf die
Henkelpartien abgesetzt
geometrische Grundfonn des Gefäß.es dastand (Fi-
gurlll). Durch Yerwendung kleinerer Schleifscheiben
wurde dann imrner mehr die feinere Schwingung der
Gefäßlinie sowie die Profilierung des Fußes lieraus-
gearbeitet. So stand endlich das ganze Gefäß in seiner
endgültigen Grundfonn da, aber noch massiv und mit
kompakten Henkelmassen. jetzt ging es an das be-
sonders heikle Kapitel der Aushöhlung. Diese geschah
auf folgende Art und Weise, die vielleicht für viele
von besonderem Interesse sein dürfte. Eine Röhre aus
Messingblech von der Wandstärke eines halben Milli-
meters und 35 mm Durchmesser wurde am unteren
Rande mit feinen Diamantsplitterchen sozusagen ge-
zälint und gespickt und vertikal in eine Bohrmaschine
eingesetzt und der noch massive Kristallpokal so dar-
untergestellt, daß die Bohrröhre über seinem Zentrum
stand. Dann wurde die Bohrröhre in zuerst lang-
samer Drehung behutsam auf die Oberfläche des
Steines gedrückt und immer etwas Ö1 zugeträuf’elt,
bis sich die Röhre mit ihren Diamantzähnchen eine
Kreisfurche in den Stein gegraben hatte.
Durch einen ringförmig herumgelegten
Keilschnitt wurde die Fußpartie abgesetzt
Jetzt wurde die Rotation unter Beibehaltung eines
gleichmäßigen und vorsichtigen Abwärtsdruckes be-
schleunigt und solange durchgeführt, bis die Röhre
etwa 8 cm tief in den Kristall eingedrungen war. Es
stand also nach Entfernung der Röhre eine zylin-
drische Kristallsäule in dem Gefäßmassiv da, und
diese wurde mit eineni gegen ihre obere Kante ge-
führten kurzen, scharfen Schlag vom Boden ab-
gesprengt und entfernt. Die im Innern des Gef’äßes
entstandene ungleiche Rruchfläche wurde mit einem
kolbenartigen Werkzeug wieder mit Diamantstaub
und ÖI glattgeschliffen.
Nun kam eine zweite Messingröhre an die Reihe,
diesmal von 55 nun Durchmesser. Dadurch, däß diese
wieder zentrisch auf den Stein aufgesetzt wurde, ent-
stand nun bei Beibehaltung des gleichen Werkvor-
ganges wie zuerst ein Zylinder von etwa 1 cm Wand-
stärke, der durch Einführung einer scharfrandigen,
langstieligen diamantierten Schneidscheibe am Boden
abgeschnitten und entfernt wurde. Auf gleiche Weise
wurde noch ein zweiter Zylinder herausgeholt, und
damit war das Gef’äß soweit ausgehöhlt, daß mit dem
leinschleifen im Innern begonnen werden konnte.
Nun standen aber noch die beiden Henkel vollmassiv
da; auch hier mußte Röhrenbohrtechnik helfen. Das
Gefäß wurde vorsichtig auf eine passende Unterlage
fixiert und mit einem Röhrenbohrer von etwa 10 mm
Durchmesser jeder Flenkelteil durch mehrere neben-
einandergesetzte Bohrungen ausgebohrt und mit un-