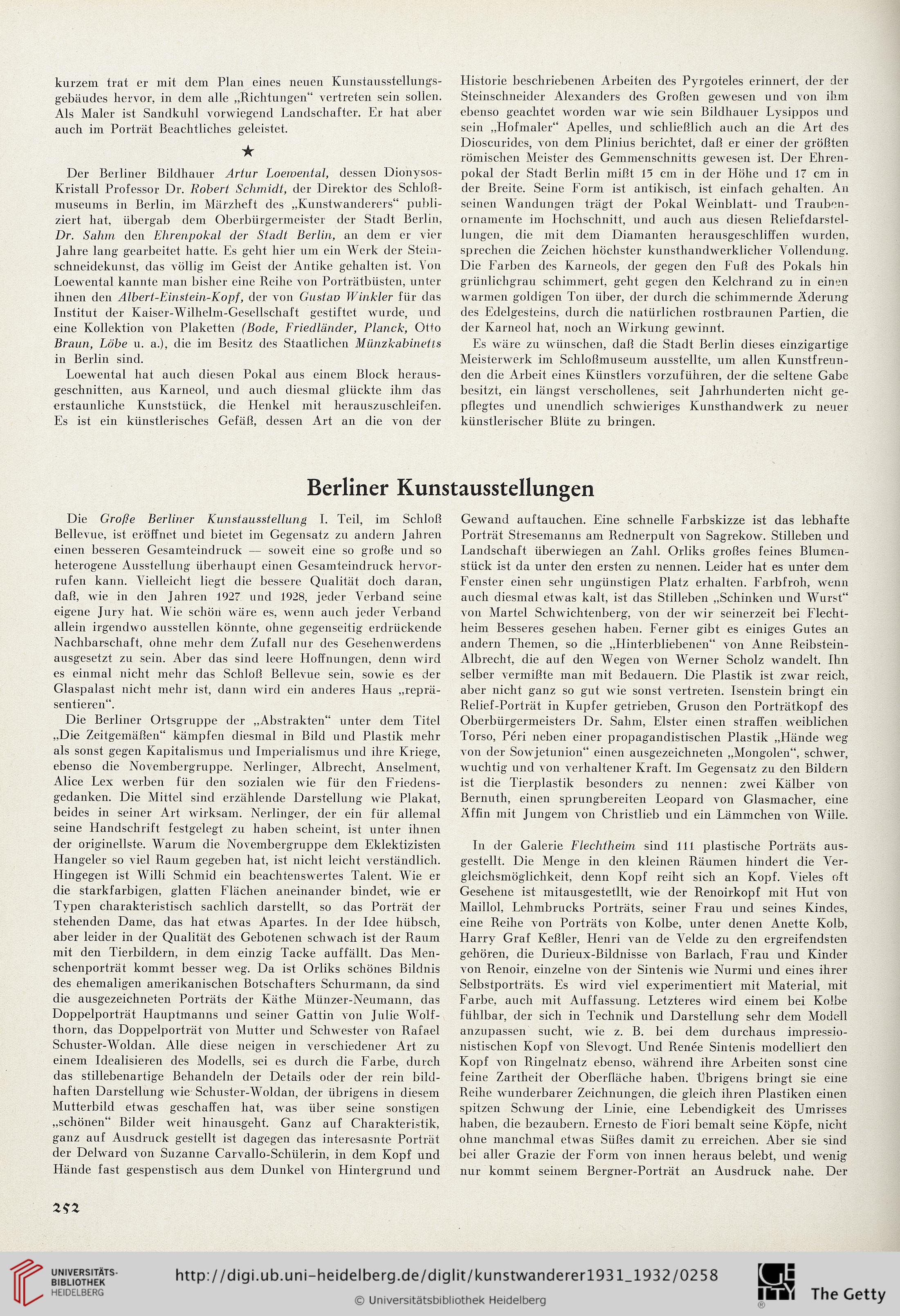kurzem trat er mit dem Plan eines neuen Kunstansstellungs-
gebäudes hervor, in dem alle „Richtungen“ vertrcten sein sollen.
Als Maler ist Sandkuhl vorwiegend Landschafter. Er hat aber
auch im Porträt Beachtliches geleistet.
★
Der Berliner Bildliauer Artur Loemental, dessen Dionysos-
Kristall Professor Dr. Robert Schmidt, der Direktor des Schloß-
museums in Berlin, im Märzheft des „Kunstwanderers“ publi-
ziert liat, übergab dem Oberbürgermeister der Stadt Berlin,
Dr. Salim den Ehrenpokal der Stadt Berlin, an dem cr vier
Jahre lang gearbeitet hatte. Es geht liier um ein Werk der Stein-
schneidekunst, das völlig im Geist der Antike gehalten ist. Von
Loewental kannte man bislicr eine Reihe von Porträtbüsten, unter
ihnen den Albert-Einstein-Kopf, der von Gustav Winkler für das
Institut der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gestiftet wurde, und
eine Kollektion von Plaketten (Bode, Friedländer, Planck, Otto
Braun, Löbe u. a.), die im Besitz des Staatlichen Miinzkabinetts
in Berlin sind.
Loewental hat auch diesen Pokal aus einem Block heraus-
geschnitten, aus Karneol, und auch diesmal glückte ihm das
erstaunliche Kunststück, die Ilenkel mit herauszuschleifen.
Es ist ein künstlerisches Gefäß, dessen Art an die von der
Historie beschriebenen Arbeiten des Pyrgoteles erinnert, der der
Steinschneider Alexanders des Großen gewesen und von ihm
ebenso geachtet worden war wie sein Bildhauer Lysippos und
sein „Ilofmaler“ Apelles, und schließlich auch an die Art des
Dioscuridcs, von dem Plinius berichtet, daß er einer der größten
römischen Meister des Gemmenschnitts gewesen ist. Der Ehren-
pokal der Stadt Berlin mifit 15 cm in der Höhe und 17 cm in
der Breite. Seine Form ist antikisch, ist einfach gehalten. An
seinen Wandungen trägt der Pokal Weinblatt- und Trauben-
ornamente im Hochschnitt, und auch aus diesen Reliefdarstel-
lungen, die mit dem Diamanten herausgeschliffen wurden,
sprechen die Zeiclien höchster kunsthandwerklicher Yollendung.
Die Farben des Karneols, der gegen den Fuß des Pokals hin
grünlichgrau schimmert, geht gegen den Kelchrand zu in einen
warmen goldigen Ton über, der durch die schimmernde Äderung
des Edelgesteins, durch die natürlichen rostbraunen Partien, die
der Karneol hat, noch an Wirkung gewinnt.
Es wäre zu wünschen, dafi die Stadt Berlin dieses einzigartige
Meisterwerk irn Schloßmuseum ausstellte, um allen Kunstfreun-
den die Arbeit eines Künstlers vorzuführen, der die seltene Gabe
besitzt, ein längst verschollenes, seit Jahrhunderten niclit ge-
pflegtes und unendlich schwieriges Kunsthandwerk zu neuer
künstlerischer Blüte zu bringen.
Berliner Kunstausstellungen
Die Große Berliner Kunstausstellung I. Teil, im Schloß
Bellevue, ist eröffnet und bietet im Gegensatz zu andern Jahren
einen besseren Gesamteindruck — soweit eine so grofie und so
heterogene Ausstellung überhaupt einen Gesamteindruck hervor-
rufen kann. Vielleicht liegt die bessere Qualität doch daran,
daß, wie in den Jahren 1927 und 1928, jeder Yerband seine
eigene Jury liat. Wie schön wäre es, wenn auch jeder Verband
allein irgendwo ausstellen könnte, ohne gegenseitig erdrückende
Nachbarschaft, oline melir dem Zufall nur des Gesehenwerdens
ausgesetzt zu sein. Aber das sind leere Hoffnungen, denn wird
es einmal nicht mehr das Schloß Bellevue sein, sowie es der
Glaspalast nicht mehr ist, dann wird ein anderes Idaus „reprä-
sentieren“.
Die Berliner Ortsgruppe der „Abstrakten“ unter dem Titel
„Die Zeitgemäßen“ kämpfen diesmal in Bild und Plastik mehr
als sonst gegen Kapitalismus und Imperialismus und ihre Kriege,
ebenso die Novembergruppe. Nerlinger, Albrecht, Anselment,
Alice Lex werben für den sozialen wie für den Friedens-
gedanken. Die Mittel sind erzählende Darstellung wie Plakat,
beides in seiner Art wirksam. Nerlinger, der ein für allemal
seine Handsclirift festgelegt zu haben scheint, ist unter ihnen
der originellste. Warum die Novembergruppe dem Eklektizisten
Plangeler so viel Raum gegeben hat, ist nicht leicht verständlich.
Ilingegen ist Willi Schmid ein beachtenswertes Talent. Wie er
die starkfarbigen, glatten Flächen aneinander bindet, wie er
Typen cliarakteristisch sachlich darstellt, so das Porträt der
stehenden Dame, das hat etwas Apartes. In der Idee liübsch,
aber leider in der Qualität des Gebotenen schwach ist der Raum
mit den Tierbildern, in dem einzig Tacke auffällt. Das Men-
schenporträt kommt besser weg. Da ist Orliks schönes Bildnis
des ehemaligen amerikanischen Botschafters Schurmann, da sind
die ausgezeichneten Porträts der Käthe Münzer-Neumann, das
Doppelporträt Hauptmanns und seiner Gattin von Julie Wolf-
thorn, das Doppelporträt von Mutter und Schwester von Rafael
Schuster-Woldan. Alle diese neigen in verschiedener Art zu
einem Idealisieren des Modells, sei es durch die Farbe, durch
das stillebenartige Behandeln der Details oder der rein bild-
haften Darstellung wie Schuster-Woldan, der übrigens in diesem
Mutterbild etwas geschaffen liat, was über seine sonstigen
„schönen“ Bilder weit liinausgeht. Ganz auf Charakteristik,
ganz auf Ausdruck gestellt ist dagegen das interesasnte Porträt
der Delward von Suzanne Carvallo-Schülerin, in dem Kopf und
Hände fast gespenstisch aus dem Dunkel von Hintergrund und
Gewand auftauchen. Eine schnelle Farbskizze ist das lebhafte
Porträt Stresemanns arn RedneriDult von Sagrekow. Stilleben und
Landscliaft überwiegen an Zahl. Orliks großes feines Blumen-
stück ist da unter den ersten zu nennen. Leider hat es unter dem
Fenster einen sehr ungünstigen Platz erhalten. Farbfroh, wenn
auch diesmal etwas kalt, ist das Stilleben „Schinken und Wurst“
von Martel Schwichtenberg, von der wir seinerzeit bei Flecht-
heirn Besseres gesehen haben. Ferner gibt es einiges Gutes an
andern Tliemen, so die „Hinterbliebenen“ von Anne Reibstein-
Albrecht, die auf den Wegen von Werner Scholz wandelt. Ihn
selber vermißte man mit Bedauern. Die Plastik ist zwar reicli,
aber niclit ganz so gut wie sonst vertreten. Isenstein bringt ein
Relief-Porträt in Kupfer getrieben, Gruson den Porträtkopf des
Oberbtirgermeisters Dr. Sahm, Elster einen straffen weiblichen
Torso, Peri neben einer propagandistischen Plastik „Hände weg
von der Sowjetunion“ einen ausgezeichneten „Mongolen“, schwer,
wuchtig und von verhaltener Kraft. Im Gegensatz zu den Bildern
ist die Tierplastik besonders zu nennen: zwei Kälber von
Bernuth, einen sprungbereiten Leopard von Glasmacher, eine
Äffin mit Jungem von Christlieb und ein Lämmchen von Wille.
In der Galerie Flechtheim sind 111 plastische Porträts aus-
gestellt. Die Menge in den kleinen Räumen hindert die Yer-
gleichsmögliclikeit, denn Kopf reiht sich an Kopf. Yieles oft
Gesehene ist mitausgestetllt, wie der Renoirkopf mit Hut von
Maillol, Lehmbrucks Porträts, seiner Frau und seines Kindes,
eine Reihe von Porträts von Kolbe, unter denen Anette Kolb,
Harry Graf Keßler, Henri van de Yelde zu den ergreifendsten
gehören, die Durieux-Bildnisse von Barlach, Frau und Kinder
von Renoir, einzelne von der Sintenis wie Nurmi und eines ihrer
Selbstporträts. Es wird viel experimentiert mit Material, mit
Farbe, auch mit Auf'fassung. Letzteres wird einem bei Kolbe
fühlbar, der sich in Technik und Darstellung sehr dem Modell
anzupassen sucht, wie z. B. bei dem durchaus impressio-
nistischen Kopf von Slevogt. Und Renee Sintenis modelliert den
Kopf von Ringelnatz ebenso, während ihre Arbeiten sonst cine
feine Zartheit der Oberfiäche haben. Übrigens bringt sie eine
Reihe wunderbarer Zeichnungen, die gleich ihren Plastiken einen
spitzen Schwung der Linie, eine Lebendigkeit des Umrisses
haben, die bezaubern. Ernesto de Fiori bemalt seine Köpfe, nicht
ohne manchmal etwas Süßes damit zu erreichen. Aber sie sind
bei aller Grazie der Form von innen heraus belebt, und wenig
nur kommt seinem Bergner-Porträt an Ausdruck nahe. Der
gebäudes hervor, in dem alle „Richtungen“ vertrcten sein sollen.
Als Maler ist Sandkuhl vorwiegend Landschafter. Er hat aber
auch im Porträt Beachtliches geleistet.
★
Der Berliner Bildliauer Artur Loemental, dessen Dionysos-
Kristall Professor Dr. Robert Schmidt, der Direktor des Schloß-
museums in Berlin, im Märzheft des „Kunstwanderers“ publi-
ziert liat, übergab dem Oberbürgermeister der Stadt Berlin,
Dr. Salim den Ehrenpokal der Stadt Berlin, an dem cr vier
Jahre lang gearbeitet hatte. Es geht liier um ein Werk der Stein-
schneidekunst, das völlig im Geist der Antike gehalten ist. Von
Loewental kannte man bislicr eine Reihe von Porträtbüsten, unter
ihnen den Albert-Einstein-Kopf, der von Gustav Winkler für das
Institut der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gestiftet wurde, und
eine Kollektion von Plaketten (Bode, Friedländer, Planck, Otto
Braun, Löbe u. a.), die im Besitz des Staatlichen Miinzkabinetts
in Berlin sind.
Loewental hat auch diesen Pokal aus einem Block heraus-
geschnitten, aus Karneol, und auch diesmal glückte ihm das
erstaunliche Kunststück, die Ilenkel mit herauszuschleifen.
Es ist ein künstlerisches Gefäß, dessen Art an die von der
Historie beschriebenen Arbeiten des Pyrgoteles erinnert, der der
Steinschneider Alexanders des Großen gewesen und von ihm
ebenso geachtet worden war wie sein Bildhauer Lysippos und
sein „Ilofmaler“ Apelles, und schließlich auch an die Art des
Dioscuridcs, von dem Plinius berichtet, daß er einer der größten
römischen Meister des Gemmenschnitts gewesen ist. Der Ehren-
pokal der Stadt Berlin mifit 15 cm in der Höhe und 17 cm in
der Breite. Seine Form ist antikisch, ist einfach gehalten. An
seinen Wandungen trägt der Pokal Weinblatt- und Trauben-
ornamente im Hochschnitt, und auch aus diesen Reliefdarstel-
lungen, die mit dem Diamanten herausgeschliffen wurden,
sprechen die Zeiclien höchster kunsthandwerklicher Yollendung.
Die Farben des Karneols, der gegen den Fuß des Pokals hin
grünlichgrau schimmert, geht gegen den Kelchrand zu in einen
warmen goldigen Ton über, der durch die schimmernde Äderung
des Edelgesteins, durch die natürlichen rostbraunen Partien, die
der Karneol hat, noch an Wirkung gewinnt.
Es wäre zu wünschen, dafi die Stadt Berlin dieses einzigartige
Meisterwerk irn Schloßmuseum ausstellte, um allen Kunstfreun-
den die Arbeit eines Künstlers vorzuführen, der die seltene Gabe
besitzt, ein längst verschollenes, seit Jahrhunderten niclit ge-
pflegtes und unendlich schwieriges Kunsthandwerk zu neuer
künstlerischer Blüte zu bringen.
Berliner Kunstausstellungen
Die Große Berliner Kunstausstellung I. Teil, im Schloß
Bellevue, ist eröffnet und bietet im Gegensatz zu andern Jahren
einen besseren Gesamteindruck — soweit eine so grofie und so
heterogene Ausstellung überhaupt einen Gesamteindruck hervor-
rufen kann. Vielleicht liegt die bessere Qualität doch daran,
daß, wie in den Jahren 1927 und 1928, jeder Yerband seine
eigene Jury liat. Wie schön wäre es, wenn auch jeder Verband
allein irgendwo ausstellen könnte, ohne gegenseitig erdrückende
Nachbarschaft, oline melir dem Zufall nur des Gesehenwerdens
ausgesetzt zu sein. Aber das sind leere Hoffnungen, denn wird
es einmal nicht mehr das Schloß Bellevue sein, sowie es der
Glaspalast nicht mehr ist, dann wird ein anderes Idaus „reprä-
sentieren“.
Die Berliner Ortsgruppe der „Abstrakten“ unter dem Titel
„Die Zeitgemäßen“ kämpfen diesmal in Bild und Plastik mehr
als sonst gegen Kapitalismus und Imperialismus und ihre Kriege,
ebenso die Novembergruppe. Nerlinger, Albrecht, Anselment,
Alice Lex werben für den sozialen wie für den Friedens-
gedanken. Die Mittel sind erzählende Darstellung wie Plakat,
beides in seiner Art wirksam. Nerlinger, der ein für allemal
seine Handsclirift festgelegt zu haben scheint, ist unter ihnen
der originellste. Warum die Novembergruppe dem Eklektizisten
Plangeler so viel Raum gegeben hat, ist nicht leicht verständlich.
Ilingegen ist Willi Schmid ein beachtenswertes Talent. Wie er
die starkfarbigen, glatten Flächen aneinander bindet, wie er
Typen cliarakteristisch sachlich darstellt, so das Porträt der
stehenden Dame, das hat etwas Apartes. In der Idee liübsch,
aber leider in der Qualität des Gebotenen schwach ist der Raum
mit den Tierbildern, in dem einzig Tacke auffällt. Das Men-
schenporträt kommt besser weg. Da ist Orliks schönes Bildnis
des ehemaligen amerikanischen Botschafters Schurmann, da sind
die ausgezeichneten Porträts der Käthe Münzer-Neumann, das
Doppelporträt Hauptmanns und seiner Gattin von Julie Wolf-
thorn, das Doppelporträt von Mutter und Schwester von Rafael
Schuster-Woldan. Alle diese neigen in verschiedener Art zu
einem Idealisieren des Modells, sei es durch die Farbe, durch
das stillebenartige Behandeln der Details oder der rein bild-
haften Darstellung wie Schuster-Woldan, der übrigens in diesem
Mutterbild etwas geschaffen liat, was über seine sonstigen
„schönen“ Bilder weit liinausgeht. Ganz auf Charakteristik,
ganz auf Ausdruck gestellt ist dagegen das interesasnte Porträt
der Delward von Suzanne Carvallo-Schülerin, in dem Kopf und
Hände fast gespenstisch aus dem Dunkel von Hintergrund und
Gewand auftauchen. Eine schnelle Farbskizze ist das lebhafte
Porträt Stresemanns arn RedneriDult von Sagrekow. Stilleben und
Landscliaft überwiegen an Zahl. Orliks großes feines Blumen-
stück ist da unter den ersten zu nennen. Leider hat es unter dem
Fenster einen sehr ungünstigen Platz erhalten. Farbfroh, wenn
auch diesmal etwas kalt, ist das Stilleben „Schinken und Wurst“
von Martel Schwichtenberg, von der wir seinerzeit bei Flecht-
heirn Besseres gesehen haben. Ferner gibt es einiges Gutes an
andern Tliemen, so die „Hinterbliebenen“ von Anne Reibstein-
Albrecht, die auf den Wegen von Werner Scholz wandelt. Ihn
selber vermißte man mit Bedauern. Die Plastik ist zwar reicli,
aber niclit ganz so gut wie sonst vertreten. Isenstein bringt ein
Relief-Porträt in Kupfer getrieben, Gruson den Porträtkopf des
Oberbtirgermeisters Dr. Sahm, Elster einen straffen weiblichen
Torso, Peri neben einer propagandistischen Plastik „Hände weg
von der Sowjetunion“ einen ausgezeichneten „Mongolen“, schwer,
wuchtig und von verhaltener Kraft. Im Gegensatz zu den Bildern
ist die Tierplastik besonders zu nennen: zwei Kälber von
Bernuth, einen sprungbereiten Leopard von Glasmacher, eine
Äffin mit Jungem von Christlieb und ein Lämmchen von Wille.
In der Galerie Flechtheim sind 111 plastische Porträts aus-
gestellt. Die Menge in den kleinen Räumen hindert die Yer-
gleichsmögliclikeit, denn Kopf reiht sich an Kopf. Yieles oft
Gesehene ist mitausgestetllt, wie der Renoirkopf mit Hut von
Maillol, Lehmbrucks Porträts, seiner Frau und seines Kindes,
eine Reihe von Porträts von Kolbe, unter denen Anette Kolb,
Harry Graf Keßler, Henri van de Yelde zu den ergreifendsten
gehören, die Durieux-Bildnisse von Barlach, Frau und Kinder
von Renoir, einzelne von der Sintenis wie Nurmi und eines ihrer
Selbstporträts. Es wird viel experimentiert mit Material, mit
Farbe, auch mit Auf'fassung. Letzteres wird einem bei Kolbe
fühlbar, der sich in Technik und Darstellung sehr dem Modell
anzupassen sucht, wie z. B. bei dem durchaus impressio-
nistischen Kopf von Slevogt. Und Renee Sintenis modelliert den
Kopf von Ringelnatz ebenso, während ihre Arbeiten sonst cine
feine Zartheit der Oberfiäche haben. Übrigens bringt sie eine
Reihe wunderbarer Zeichnungen, die gleich ihren Plastiken einen
spitzen Schwung der Linie, eine Lebendigkeit des Umrisses
haben, die bezaubern. Ernesto de Fiori bemalt seine Köpfe, nicht
ohne manchmal etwas Süßes damit zu erreichen. Aber sie sind
bei aller Grazie der Form von innen heraus belebt, und wenig
nur kommt seinem Bergner-Porträt an Ausdruck nahe. Der