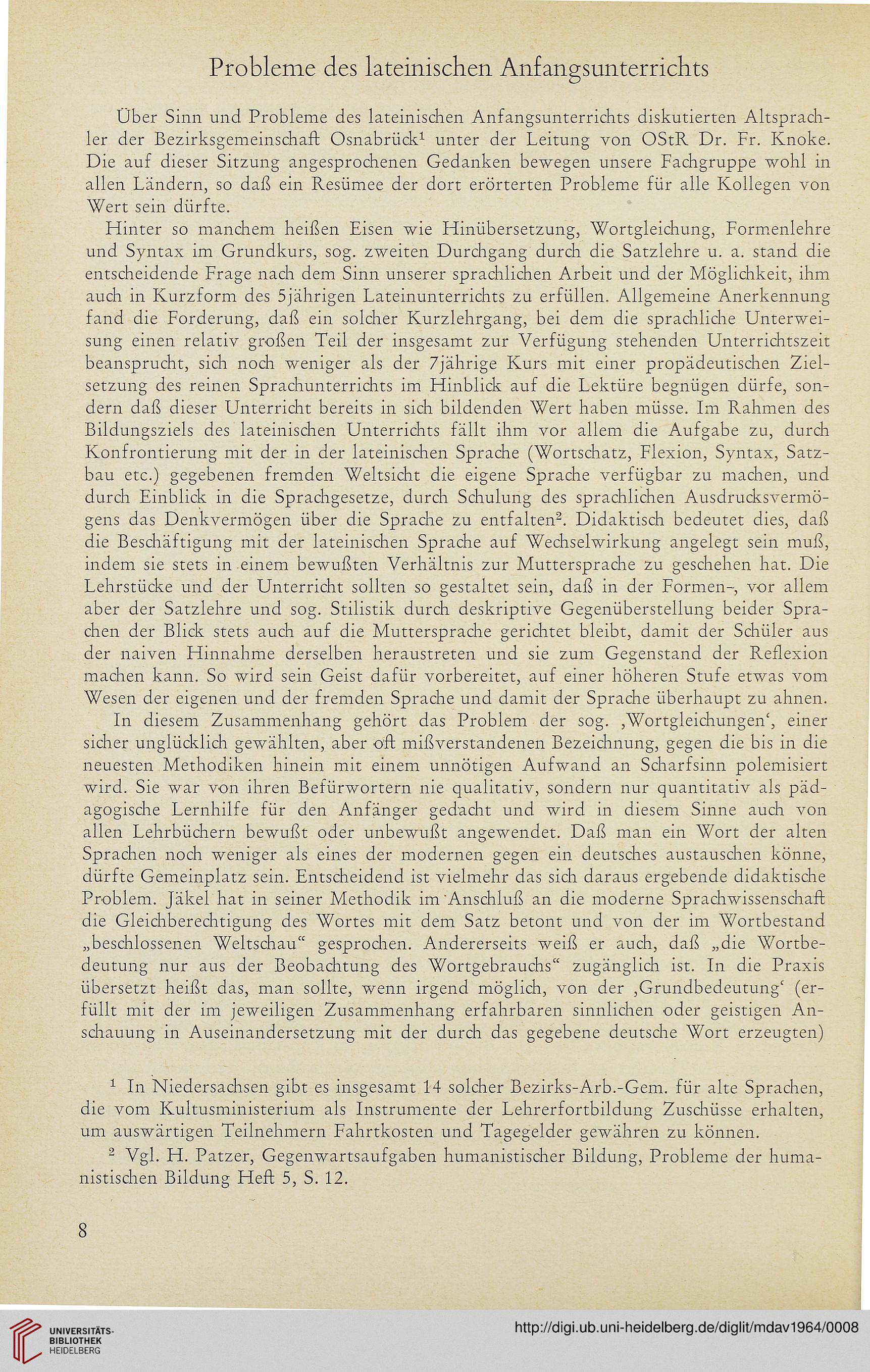Probleme des lateinischen Anfangsunterrichts
Über Sinn und Probleme des lateinischen Anfangsunterrichts diskutierten Altsprach-
ler der Bezirksgemeinschaft Osnabrück 1 unter der Leitung von OStR Dr. Fr. Knoke.
Die auf dieser Sitzung angesprochenen Gedanken bewegen unsere Fachgruppe wohl in
allen Ländern, so daß ein Resümee der dort erörterten Probleme für alle Kollegen von
Wert sein diirfte.
Fdinter so manchem heißen Eisen wie Hiniibersetzung, Wortgleichung, Formenlehre
und Syntax im Grundkurs, sog. zweiten Durchgang durch die Satzlehre u. a. stand die
entscheidende Frage nach dem Sinn unserer sprachlichen Arbeit und der Möglichkeit, ihm
auch in Kurzform des 5jährigen Lateinunterrichts zu erfüllen. Allgemeine Anerkennung
fand die Forderung, daß ein solcher Kurzlehrgang, bei dem die sprachliche Unterwei-
sung einen relativ großen Teil der insgesamt zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit
beansprucht, sich noch weniger als der 7jährige Kurs mit einer propädeutischen Ziel-
setzung des reinen Sprachunterrichts im Hinblick auf die Lektüre begnügen dürfe, son-
dern daß dieser Unterricht bereits in sich bildenden Wert haben müsse. Im Rahmen des
Bildungsziels des lateinischen Unterrichts fällt ihm vor allem die Aufgabe zu, durch
Konfrontierung mit der in der lateinischen Sprache (Wortschatz, Flexion, Syntax, Satz-
bau etc.) gegebenen fremden Weltsicht die eigene Sprache verfügbar zu machen, und
durch Einblick in die Sprachgesetze, durch Schulung des sprachlichen Ausdrucksvermö-
gens das Denkvermögen über die Sprache zu entfalten 2. Didaktisch bedeutet dies, daß
die Beschäftigung mit der lateinischen Sprache auf Wechselwirkung angelegt sein muß,
indem sie stets in einem bewußten Verhältnis zur Muttersprache zu geschehen hat. Die
Lehrstücke und der Unterricht sollten so gestaltet sein, daß in der Formen-, vor allem
aber der Satzlehre und sog. Stilistik durch deskriptive Gegenüberstellung beider Spra-
chen der Blick stets auch auf die Muttersprache gerichtet bleibt, damit der Schüler aus
der naiven Hinnahme derselben heraustreten und sie zum Gegenstand der Reflexion
machen kann. So wird sein Geist dafür vorbereitet, auf einer höheren Stufe etwas vom
Wesen der eigenen und der fremden Sprache und damit der Sprache tiberhaupt zu ahnen.
In diesem Zusammenhang gehört das Problem der sog. ,Wortgleichungen‘, einer
sicher unglücklich gewählten, aber oft mißverstandenen Bezeichnung, gegen die bis in die
neuesten Methodiken hinein mit einem unnötigen Aufwand an Scharfsinn polemisiert
wird. Sie war von ihren Befürwortern nie qualitativ, sondern nur quantitativ als päd-
agogische Lernhilfe für den Anfänger gedacht und wird in diesem Sinne auch von
allen Lehrbüchern bewußt oder unbewußt angewendet. Daß man ein Wort der alten
Sprachen noch weniger als eines der modernen gegen ein deutsches austauschen könne,
dürfte Gemeinplatz sein. Entscheidend ist vielmehr das sich daraus ergebende didaktische
Problem. Jäkel hat in seiner Methodik im 'Anschluß an die moderne Sprachwissenschaft
die Gleichberechtigung des Wortes mit dem Satz betont und von der im Wortbestand
„beschlossenen Weltschau“ gesprochen. Andererseits weiß er auch, daß „die Wortbe-
deutung nur aus der Beobachtung des Wortgebrauchs“ zugänglich ist. In die Praxis
übersetzt heißt das, man sollte, wenn irgend möglich, von der ,Grundbedeutung c (er-
füllt mit der im jeweiligen Zusammenhang erfahrbaren sinnlichen oder geistigen An-
schauung in Auseinandersetzung mit der durch das gegebene deutsche Wort erzeugten)
1 In Niedersachsen gibt es insgesamt 14 solcher Bezirks-Arb.-Gem. für alte Sprachen,
die vom Kultusministerium als Instrumente der Lehrerfortbildung Zuschüsse erhalten,
um auswärtigen Teilnehmern Fahrtkosten und Tagegelder gewähren zu können.
2 Vgl. H. Patzer, Gegenwartsaufgaben humanistischer Bildung, Probleme der huma-
nistischen Bildung Heft 5, S. 12.
Über Sinn und Probleme des lateinischen Anfangsunterrichts diskutierten Altsprach-
ler der Bezirksgemeinschaft Osnabrück 1 unter der Leitung von OStR Dr. Fr. Knoke.
Die auf dieser Sitzung angesprochenen Gedanken bewegen unsere Fachgruppe wohl in
allen Ländern, so daß ein Resümee der dort erörterten Probleme für alle Kollegen von
Wert sein diirfte.
Fdinter so manchem heißen Eisen wie Hiniibersetzung, Wortgleichung, Formenlehre
und Syntax im Grundkurs, sog. zweiten Durchgang durch die Satzlehre u. a. stand die
entscheidende Frage nach dem Sinn unserer sprachlichen Arbeit und der Möglichkeit, ihm
auch in Kurzform des 5jährigen Lateinunterrichts zu erfüllen. Allgemeine Anerkennung
fand die Forderung, daß ein solcher Kurzlehrgang, bei dem die sprachliche Unterwei-
sung einen relativ großen Teil der insgesamt zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit
beansprucht, sich noch weniger als der 7jährige Kurs mit einer propädeutischen Ziel-
setzung des reinen Sprachunterrichts im Hinblick auf die Lektüre begnügen dürfe, son-
dern daß dieser Unterricht bereits in sich bildenden Wert haben müsse. Im Rahmen des
Bildungsziels des lateinischen Unterrichts fällt ihm vor allem die Aufgabe zu, durch
Konfrontierung mit der in der lateinischen Sprache (Wortschatz, Flexion, Syntax, Satz-
bau etc.) gegebenen fremden Weltsicht die eigene Sprache verfügbar zu machen, und
durch Einblick in die Sprachgesetze, durch Schulung des sprachlichen Ausdrucksvermö-
gens das Denkvermögen über die Sprache zu entfalten 2. Didaktisch bedeutet dies, daß
die Beschäftigung mit der lateinischen Sprache auf Wechselwirkung angelegt sein muß,
indem sie stets in einem bewußten Verhältnis zur Muttersprache zu geschehen hat. Die
Lehrstücke und der Unterricht sollten so gestaltet sein, daß in der Formen-, vor allem
aber der Satzlehre und sog. Stilistik durch deskriptive Gegenüberstellung beider Spra-
chen der Blick stets auch auf die Muttersprache gerichtet bleibt, damit der Schüler aus
der naiven Hinnahme derselben heraustreten und sie zum Gegenstand der Reflexion
machen kann. So wird sein Geist dafür vorbereitet, auf einer höheren Stufe etwas vom
Wesen der eigenen und der fremden Sprache und damit der Sprache tiberhaupt zu ahnen.
In diesem Zusammenhang gehört das Problem der sog. ,Wortgleichungen‘, einer
sicher unglücklich gewählten, aber oft mißverstandenen Bezeichnung, gegen die bis in die
neuesten Methodiken hinein mit einem unnötigen Aufwand an Scharfsinn polemisiert
wird. Sie war von ihren Befürwortern nie qualitativ, sondern nur quantitativ als päd-
agogische Lernhilfe für den Anfänger gedacht und wird in diesem Sinne auch von
allen Lehrbüchern bewußt oder unbewußt angewendet. Daß man ein Wort der alten
Sprachen noch weniger als eines der modernen gegen ein deutsches austauschen könne,
dürfte Gemeinplatz sein. Entscheidend ist vielmehr das sich daraus ergebende didaktische
Problem. Jäkel hat in seiner Methodik im 'Anschluß an die moderne Sprachwissenschaft
die Gleichberechtigung des Wortes mit dem Satz betont und von der im Wortbestand
„beschlossenen Weltschau“ gesprochen. Andererseits weiß er auch, daß „die Wortbe-
deutung nur aus der Beobachtung des Wortgebrauchs“ zugänglich ist. In die Praxis
übersetzt heißt das, man sollte, wenn irgend möglich, von der ,Grundbedeutung c (er-
füllt mit der im jeweiligen Zusammenhang erfahrbaren sinnlichen oder geistigen An-
schauung in Auseinandersetzung mit der durch das gegebene deutsche Wort erzeugten)
1 In Niedersachsen gibt es insgesamt 14 solcher Bezirks-Arb.-Gem. für alte Sprachen,
die vom Kultusministerium als Instrumente der Lehrerfortbildung Zuschüsse erhalten,
um auswärtigen Teilnehmern Fahrtkosten und Tagegelder gewähren zu können.
2 Vgl. H. Patzer, Gegenwartsaufgaben humanistischer Bildung, Probleme der huma-
nistischen Bildung Heft 5, S. 12.