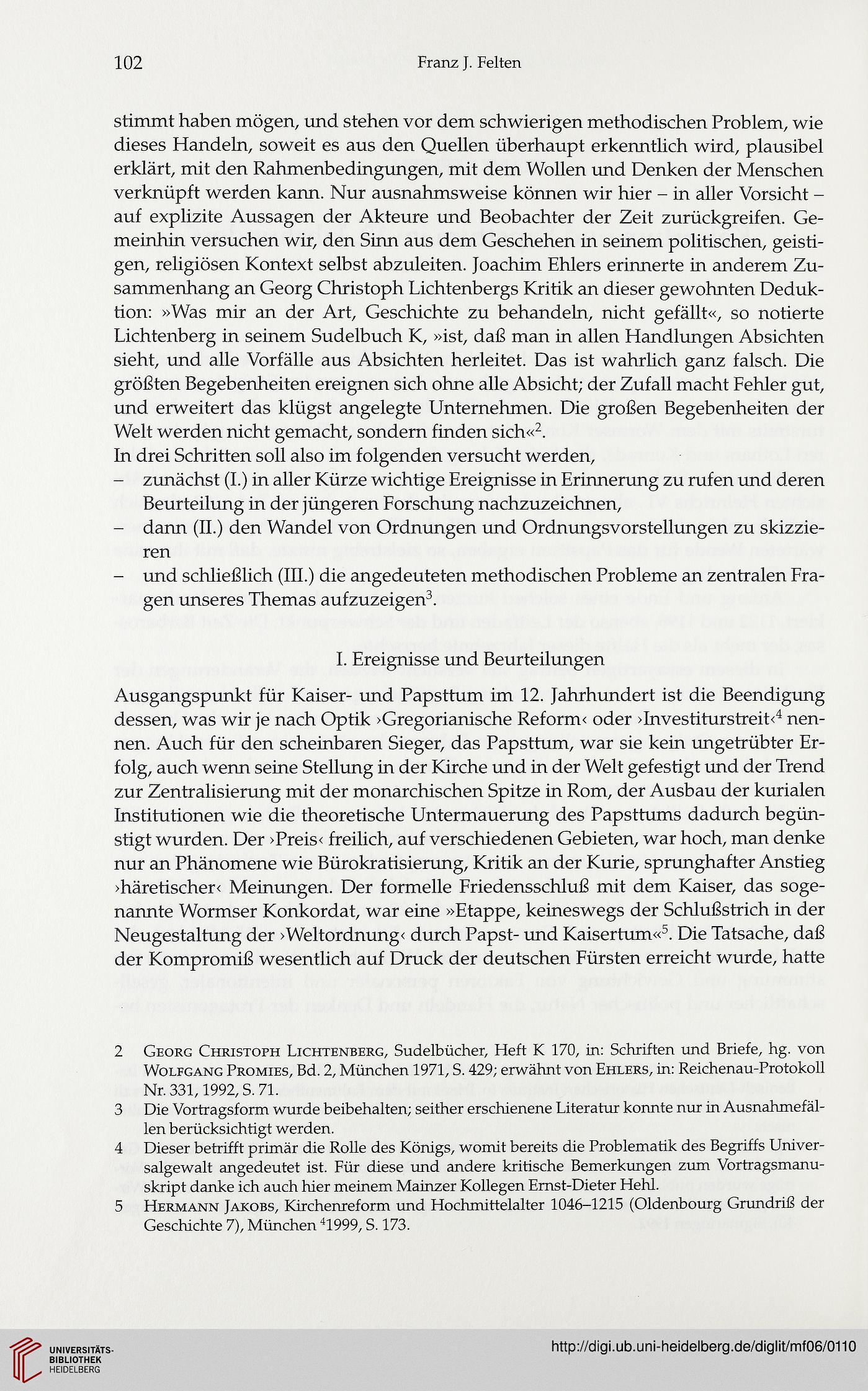102
Franz J. Felten
stimmt haben mögen, und stehen vor dem schwierigen methodischen Problem, wie
dieses Handeln, soweit es aus den Quellen überhaupt erkenntlich wird, plausibel
erklärt, mit den Rahmenbedingungen, mit dem Wollen und Denken der Menschen
verknüpft werden kann. Nur ausnahmsweise können wir hier - in aller Vorsicht -
auf explizite Aussagen der Akteure und Beobachter der Zeit zurückgreifen. Ge-
meinhin versuchen wir, den Sinn aus dem Geschehen in seinem politischen, geisti-
gen, religiösen Kontext selbst abzuleiten. Joachim Ehlers erinnerte in anderem Zu-
sammenhang an Georg Christoph Lichtenbergs Kritik an dieser gewohnten Deduk-
tion: »Was mir an der Art, Geschichte zu behandeln, nicht gefällt«, so notierte
Lichtenberg in seinem Sudelbuch K, »ist, daß man in allen Handlungen Absichten
sieht, und alle Vorfälle aus Absichten herleitet. Das ist wahrlich ganz falsch. Die
größten Begebenheiten ereignen sich ohne alle Absicht; der Zufall macht Fehler gut,
und erweitert das klügst angelegte Unternehmen. Die großen Begebenheiten der
Welt werden nicht gemacht, sondern finden sich«2.
In drei Schritten soll also im folgenden versucht werden,
- zunächst (I.) in aller Kürze wichtige Ereignisse in Erinnerung zu rufen und deren
Beurteilung in der jüngeren Forschung nachzuzeichnen,
- dann (II.) den Wandel von Ordnungen und Ordnungsvorstellungen zu skizzie-
ren
- und schließlich (III.) die angedeuteten methodischen Probleme an zentralen Fra-
gen unseres Themas aufzuzeigen3.
I. Ereignisse und Beurteilungen
Ausgangspunkt für Kaiser- und Papsttum im 12. Jahrhundert ist die Beendigung
dessen, was wir je nach Optik >Gregorianische Reform< oder >Investiturstreit<4 nen-
nen. Auch für den scheinbaren Sieger, das Papsttum, war sie kein ungetrübter Er-
folg, auch wenn seine Stellung in der Kirche und in der Welt gefestigt und der Trend
zur Zentralisierung mit der monarchischen Spitze in Rom, der Ausbau der kurialen
Institutionen wie die theoretische Untermauerung des Papsttums dadurch begün-
stigt wurden. Der >Preis< freilich, auf verschiedenen Gebieten, war hoch, man denke
nur an Phänomene wie Bürokratisierung, Kritik an der Kurie, sprunghafter Anstieg
>häretischer< Meinungen. Der formelle Friedensschluß mit dem Kaiser, das soge-
nannte Wormser Konkordat, war eine »Etappe, keineswegs der Schlußstrich in der
Neugestaltung der >Weltordnung< durch Papst- und Kaisertum«5. Die Tatsache, daß
der Kompromiß wesentlich auf Druck der deutschen Fürsten erreicht wurde, hatte
2 Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher, Heft K 170, in: Schriften und Briefe, hg. von
Wolfgang Promies, Bd. 2, München 1971, S. 429; erwähnt von Ehlers, in: Reichenau-Protokoll
Nr. 331,1992, S. 71.
3 Die Vortragsform wurde beibehalten; seither erschienene Literatur konnte nur in Ausnahmefäl-
len berücksichtigt werden.
4 Dieser betrifft primär die Rolle des Königs, womit bereits die Problematik des Begriffs Univer-
salgewalt angedeutet ist. Für diese und andere kritische Bemerkungen zum Vortragsmanu-
skript danke ich auch hier meinem Mainzer Kollegen Emst-Dieter Hehl.
5 Hermann Jakobs, Kirchenreform und Hochmittelalter 1046-1215 (Oldenbourg Grundriß der
Geschichte 7), München 41999, S. 173.
Franz J. Felten
stimmt haben mögen, und stehen vor dem schwierigen methodischen Problem, wie
dieses Handeln, soweit es aus den Quellen überhaupt erkenntlich wird, plausibel
erklärt, mit den Rahmenbedingungen, mit dem Wollen und Denken der Menschen
verknüpft werden kann. Nur ausnahmsweise können wir hier - in aller Vorsicht -
auf explizite Aussagen der Akteure und Beobachter der Zeit zurückgreifen. Ge-
meinhin versuchen wir, den Sinn aus dem Geschehen in seinem politischen, geisti-
gen, religiösen Kontext selbst abzuleiten. Joachim Ehlers erinnerte in anderem Zu-
sammenhang an Georg Christoph Lichtenbergs Kritik an dieser gewohnten Deduk-
tion: »Was mir an der Art, Geschichte zu behandeln, nicht gefällt«, so notierte
Lichtenberg in seinem Sudelbuch K, »ist, daß man in allen Handlungen Absichten
sieht, und alle Vorfälle aus Absichten herleitet. Das ist wahrlich ganz falsch. Die
größten Begebenheiten ereignen sich ohne alle Absicht; der Zufall macht Fehler gut,
und erweitert das klügst angelegte Unternehmen. Die großen Begebenheiten der
Welt werden nicht gemacht, sondern finden sich«2.
In drei Schritten soll also im folgenden versucht werden,
- zunächst (I.) in aller Kürze wichtige Ereignisse in Erinnerung zu rufen und deren
Beurteilung in der jüngeren Forschung nachzuzeichnen,
- dann (II.) den Wandel von Ordnungen und Ordnungsvorstellungen zu skizzie-
ren
- und schließlich (III.) die angedeuteten methodischen Probleme an zentralen Fra-
gen unseres Themas aufzuzeigen3.
I. Ereignisse und Beurteilungen
Ausgangspunkt für Kaiser- und Papsttum im 12. Jahrhundert ist die Beendigung
dessen, was wir je nach Optik >Gregorianische Reform< oder >Investiturstreit<4 nen-
nen. Auch für den scheinbaren Sieger, das Papsttum, war sie kein ungetrübter Er-
folg, auch wenn seine Stellung in der Kirche und in der Welt gefestigt und der Trend
zur Zentralisierung mit der monarchischen Spitze in Rom, der Ausbau der kurialen
Institutionen wie die theoretische Untermauerung des Papsttums dadurch begün-
stigt wurden. Der >Preis< freilich, auf verschiedenen Gebieten, war hoch, man denke
nur an Phänomene wie Bürokratisierung, Kritik an der Kurie, sprunghafter Anstieg
>häretischer< Meinungen. Der formelle Friedensschluß mit dem Kaiser, das soge-
nannte Wormser Konkordat, war eine »Etappe, keineswegs der Schlußstrich in der
Neugestaltung der >Weltordnung< durch Papst- und Kaisertum«5. Die Tatsache, daß
der Kompromiß wesentlich auf Druck der deutschen Fürsten erreicht wurde, hatte
2 Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher, Heft K 170, in: Schriften und Briefe, hg. von
Wolfgang Promies, Bd. 2, München 1971, S. 429; erwähnt von Ehlers, in: Reichenau-Protokoll
Nr. 331,1992, S. 71.
3 Die Vortragsform wurde beibehalten; seither erschienene Literatur konnte nur in Ausnahmefäl-
len berücksichtigt werden.
4 Dieser betrifft primär die Rolle des Königs, womit bereits die Problematik des Begriffs Univer-
salgewalt angedeutet ist. Für diese und andere kritische Bemerkungen zum Vortragsmanu-
skript danke ich auch hier meinem Mainzer Kollegen Emst-Dieter Hehl.
5 Hermann Jakobs, Kirchenreform und Hochmittelalter 1046-1215 (Oldenbourg Grundriß der
Geschichte 7), München 41999, S. 173.