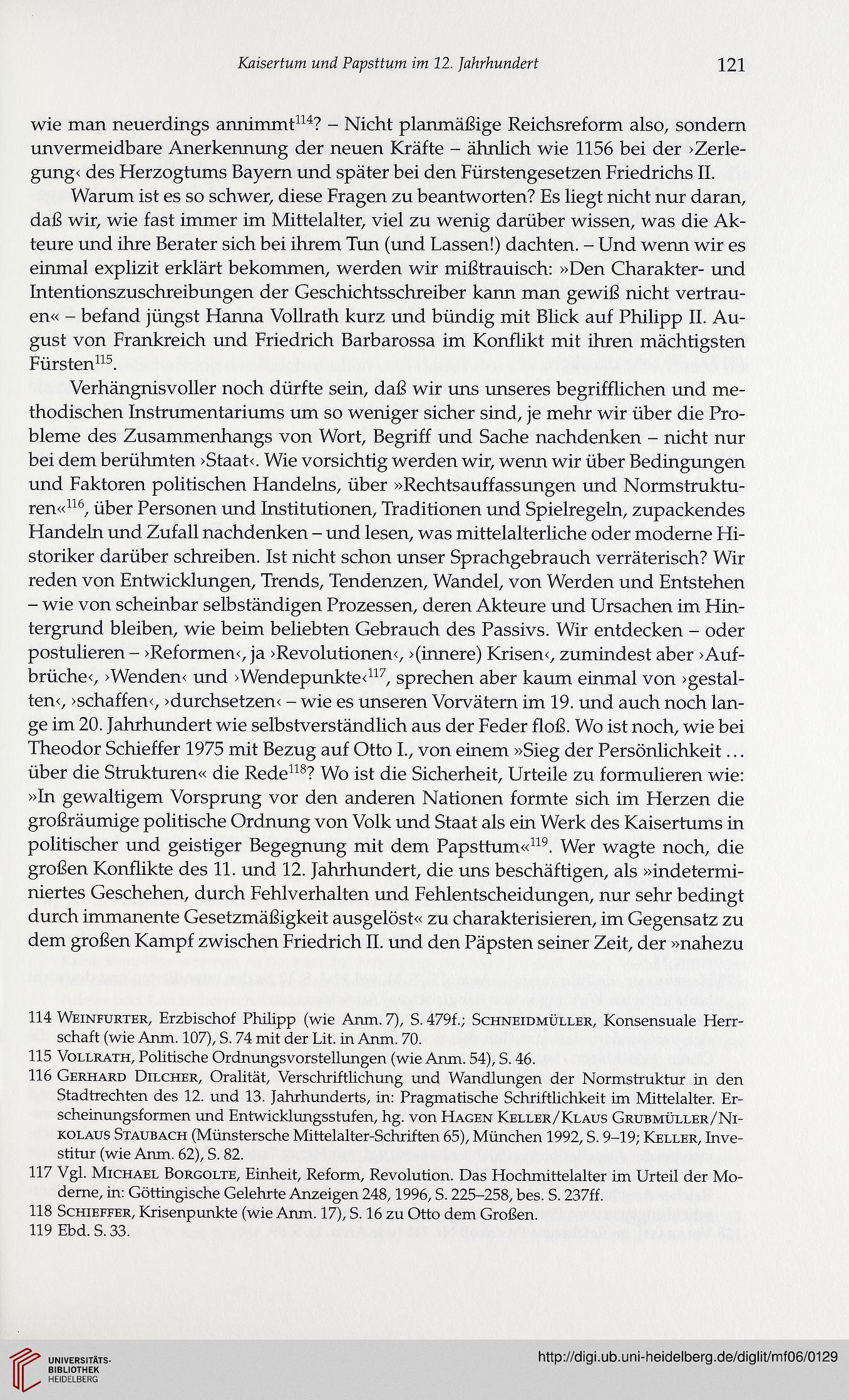Kaisertum und Papsttum im 12. Jahrhundert
121
wie man neuerdings annimmt114? - Nicht planmäßige Reichsreform also, sondern
unvermeidbare Anerkennung der neuen Kräfte - ähnlich wie 1156 bei der >Zerle-
gung< des Herzogtums Bayern und später bei den Fürstengesetzen Friedrichs II.
Warum ist es so schwer, diese Fragen zu beantworten? Es liegt nicht nur daran,
daß wir, wie fast immer im Mittelalter, viel zu wenig darüber wissen, was die Ak-
teure und ihre Berater sich bei ihrem Tun (und Lassen!) dachten. - Und wenn wir es
einmal explizit erklärt bekommen, werden wir mißtrauisch: »Den Charakter- und
Intentionszuschreibungen der Geschichtsschreiber kann man gewiß nicht vertrau-
en« - befand jüngst Hanna Vollrath kurz und bündig mit Blick auf Philipp II. Au-
gust von Frankreich und Friedrich Barbarossa im Konflikt mit ihren mächtigsten
Fürsten115.
Verhängnisvoller noch dürfte sein, daß wir uns unseres begrifflichen und me-
thodischen Instrumentariums um so weniger sicher sind, je mehr wir über die Pro-
bleme des Zusammenhangs von Wort, Begriff und Sache nachdenken - nicht nur
bei dem berühmten >Staat<. Wie vorsichtig werden wir, wenn wir über Bedingungen
und Faktoren politischen Handelns, über »Rechtsauffassungen und Normstruktu-
ren«116, über Personen und Institutionen, Traditionen und Spielregeln, zupackendes
Handeln und Zufall nachdenken - und lesen, was mittelalterliche oder moderne Hi-
storiker darüber schreiben. Ist nicht schon unser Sprachgebrauch verräterisch? Wir
reden von Entwicklungen, Trends, Tendenzen, Wandel, von Werden und Entstehen
- wie von scheinbar selbständigen Prozessen, deren Akteure und Ursachen im Hin-
tergrund bleiben, wie beim beliebten Gebrauch des Passivs. Wir entdecken - oder
postulieren - >Reformen<, ja >Revolutionen<, >(innere) Krisern, zumindest aber > Auf-
brüche^ >Wenden< und >Wendepunkte<117, sprechen aber kaum einmal von >gestal-
ten<, >schaffen<, >durchsetzen< - wie es unseren Vorvätern im 19. und auch noch lan-
ge im 20. Jahrhundert wie selbstverständlich aus der Feder floß. Wo ist noch, wie bei
Theodor Schieffer 1975 mit Bezug auf Otto I., von einem »Sieg der Persönlichkeit...
über die Strukturen« die Rede118? Wo ist die Sicherheit, Urteile zu formulieren wie:
»In gewaltigem Vorsprung vor den anderen Nationen formte sich im Herzen die
großräumige politische Ordnung von Volk und Staat als ein Werk des Kaisertums in
politischer und geistiger Begegnung mit dem Papsttum«119. Wer wagte noch, die
großen Konflikte des 11. und 12. Jahrhundert, die uns beschäftigen, als »indetermi-
niertes Geschehen, durch Fehlverhalten und Fehlentscheidungen, nur sehr bedingt
durch immanente Gesetzmäßigkeit ausgelöst« zu charakterisieren, im Gegensatz zu
dem großen Kampf zwischen Friedrich II. und den Päpsten seiner Zeit, der »nahezu
114 Weinfurter, Erzbischof Philipp (wie Anm. 7), S. 479f.; Schneidmüller, Konsensuale Herr-
schaft (wie Anm. 107), S. 74 mit der Lit. in Anm. 70.
115 Vollrath, Politische Ordnungsvorstellungen (wie Anm. 54), S. 46.
116 Gerhard Dilcher, Oralität, Verschriftlichung und Wandlungen der Normstruktur in den
Stadtrechten des 12. und 13. Jahrhunderts, in: Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Er-
scheinungsformen und Entwicklungsstufen, hg. von Hagen Keller/Klaus Grubmüller/Ni-
kolaus Staubach (Münstersche Mittelalter-Schriften 65), München 1992, S. 9-19; Keller, Inve-
stitur (wie Anm. 62), S. 82.
117 Vgl. Michael Borgolte, Einheit, Reform, Revolution. Das Hochmittelalter im Urteil der Mo-
derne, in: Göttingische Gelehrte Anzeigen 248,1996, S. 225-258, bes. S. 237ff.
118 Schieffer, Krisenpunkte (wie Anm. 17), S. 16 zu Otto dem Großen.
119 Ebd. S. 33.
121
wie man neuerdings annimmt114? - Nicht planmäßige Reichsreform also, sondern
unvermeidbare Anerkennung der neuen Kräfte - ähnlich wie 1156 bei der >Zerle-
gung< des Herzogtums Bayern und später bei den Fürstengesetzen Friedrichs II.
Warum ist es so schwer, diese Fragen zu beantworten? Es liegt nicht nur daran,
daß wir, wie fast immer im Mittelalter, viel zu wenig darüber wissen, was die Ak-
teure und ihre Berater sich bei ihrem Tun (und Lassen!) dachten. - Und wenn wir es
einmal explizit erklärt bekommen, werden wir mißtrauisch: »Den Charakter- und
Intentionszuschreibungen der Geschichtsschreiber kann man gewiß nicht vertrau-
en« - befand jüngst Hanna Vollrath kurz und bündig mit Blick auf Philipp II. Au-
gust von Frankreich und Friedrich Barbarossa im Konflikt mit ihren mächtigsten
Fürsten115.
Verhängnisvoller noch dürfte sein, daß wir uns unseres begrifflichen und me-
thodischen Instrumentariums um so weniger sicher sind, je mehr wir über die Pro-
bleme des Zusammenhangs von Wort, Begriff und Sache nachdenken - nicht nur
bei dem berühmten >Staat<. Wie vorsichtig werden wir, wenn wir über Bedingungen
und Faktoren politischen Handelns, über »Rechtsauffassungen und Normstruktu-
ren«116, über Personen und Institutionen, Traditionen und Spielregeln, zupackendes
Handeln und Zufall nachdenken - und lesen, was mittelalterliche oder moderne Hi-
storiker darüber schreiben. Ist nicht schon unser Sprachgebrauch verräterisch? Wir
reden von Entwicklungen, Trends, Tendenzen, Wandel, von Werden und Entstehen
- wie von scheinbar selbständigen Prozessen, deren Akteure und Ursachen im Hin-
tergrund bleiben, wie beim beliebten Gebrauch des Passivs. Wir entdecken - oder
postulieren - >Reformen<, ja >Revolutionen<, >(innere) Krisern, zumindest aber > Auf-
brüche^ >Wenden< und >Wendepunkte<117, sprechen aber kaum einmal von >gestal-
ten<, >schaffen<, >durchsetzen< - wie es unseren Vorvätern im 19. und auch noch lan-
ge im 20. Jahrhundert wie selbstverständlich aus der Feder floß. Wo ist noch, wie bei
Theodor Schieffer 1975 mit Bezug auf Otto I., von einem »Sieg der Persönlichkeit...
über die Strukturen« die Rede118? Wo ist die Sicherheit, Urteile zu formulieren wie:
»In gewaltigem Vorsprung vor den anderen Nationen formte sich im Herzen die
großräumige politische Ordnung von Volk und Staat als ein Werk des Kaisertums in
politischer und geistiger Begegnung mit dem Papsttum«119. Wer wagte noch, die
großen Konflikte des 11. und 12. Jahrhundert, die uns beschäftigen, als »indetermi-
niertes Geschehen, durch Fehlverhalten und Fehlentscheidungen, nur sehr bedingt
durch immanente Gesetzmäßigkeit ausgelöst« zu charakterisieren, im Gegensatz zu
dem großen Kampf zwischen Friedrich II. und den Päpsten seiner Zeit, der »nahezu
114 Weinfurter, Erzbischof Philipp (wie Anm. 7), S. 479f.; Schneidmüller, Konsensuale Herr-
schaft (wie Anm. 107), S. 74 mit der Lit. in Anm. 70.
115 Vollrath, Politische Ordnungsvorstellungen (wie Anm. 54), S. 46.
116 Gerhard Dilcher, Oralität, Verschriftlichung und Wandlungen der Normstruktur in den
Stadtrechten des 12. und 13. Jahrhunderts, in: Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Er-
scheinungsformen und Entwicklungsstufen, hg. von Hagen Keller/Klaus Grubmüller/Ni-
kolaus Staubach (Münstersche Mittelalter-Schriften 65), München 1992, S. 9-19; Keller, Inve-
stitur (wie Anm. 62), S. 82.
117 Vgl. Michael Borgolte, Einheit, Reform, Revolution. Das Hochmittelalter im Urteil der Mo-
derne, in: Göttingische Gelehrte Anzeigen 248,1996, S. 225-258, bes. S. 237ff.
118 Schieffer, Krisenpunkte (wie Anm. 17), S. 16 zu Otto dem Großen.
119 Ebd. S. 33.