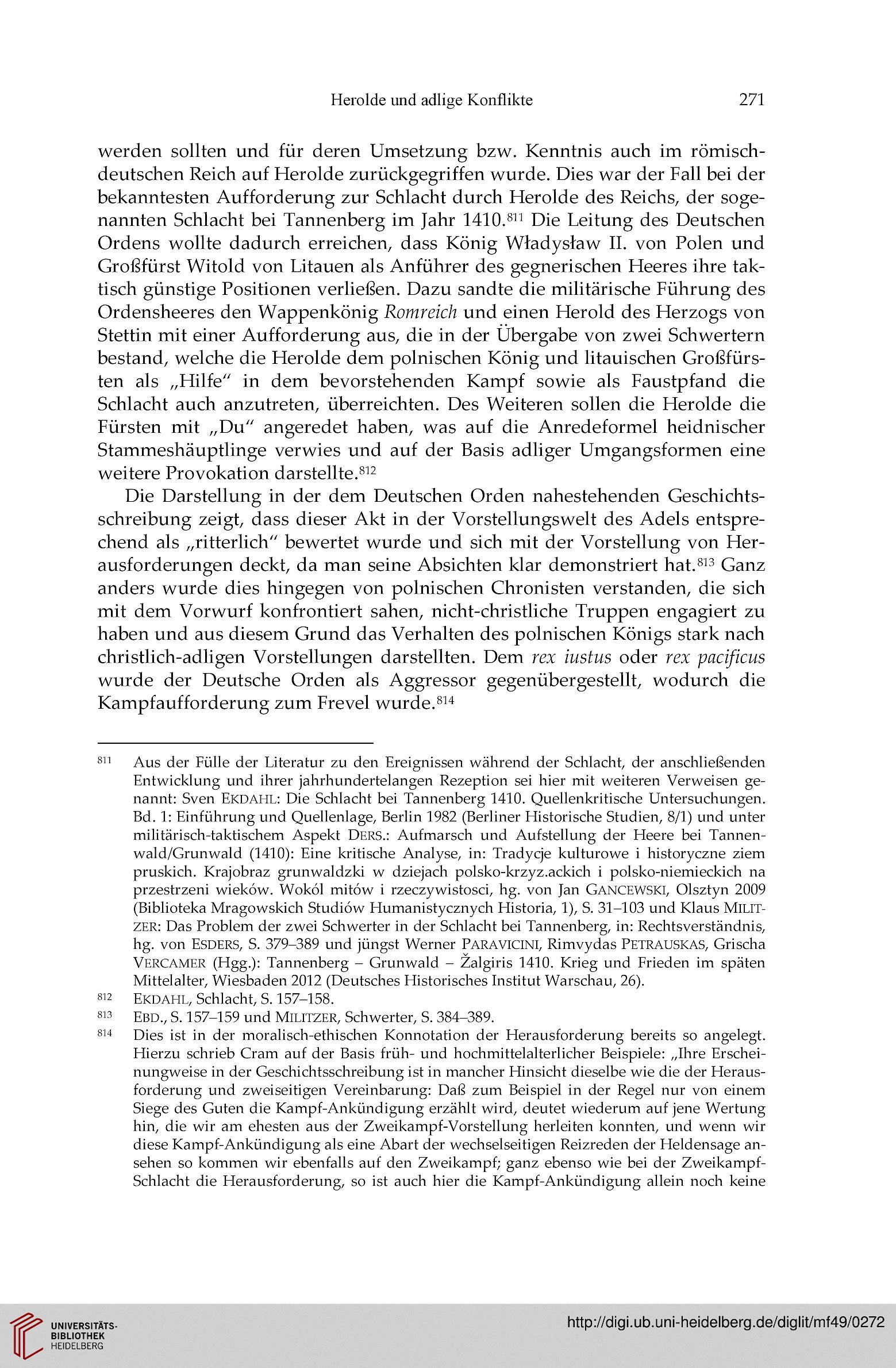Herolde und adlige Konflikte
271
werden sollten und für deren Umsetzung bzw. Kenntnis auch im römisch-
deutschen Reich auf Herolde zurückgegriffen wurde. Dies war der Fall bei der
bekanntesten Aufforderung zur Schlacht durch Herolde des Reichs, der soge-
nannten Schlacht bei Tannenberg im Jahr 1410.811 Die Leitung des Deutschen
Ordens wollte dadurch erreichen, dass König Władysław II. von Polen und
Großfürst Witold von Litauen als Anführer des gegnerischen Heeres ihre tak-
tisch günstige Positionen verließen. Dazu sandte die militärische Führung des
Ordensheeres den Wappenkönig Romreich und einen Herold des Herzogs von
Stettin mit einer Aufforderung aus, die in der Übergabe von zwei Schwertern
bestand, welche die Herolde dem polnischen König und litauischen Großfürs-
ten als „Hilfe" in dem bevorstehenden Kampf sowie als Faustpfand die
Schlacht auch anzutreten, überreichten. Des Weiteren sollen die Herolde die
Fürsten mit „Du" angeredet haben, was auf die Anredeformel heidnischer
Stammeshäuptlinge verwies und auf der Basis adliger Umgangsformen eine
weitere Provokation dar stellte.812
Die Darstellung in der dem Deutschen Orden nahestehenden Geschichts-
schreibung zeigt, dass dieser Akt in der Vorstellungsweit des Adels entspre-
chend als „ritterlich" bewertet wurde und sich mit der Vorstellung von Her-
ausforderungen deckt, da man seine Absichten klar demonstriert hat.813 Ganz
anders wurde dies hingegen von polnischen Chronisten verstanden, die sich
mit dem Vorwurf konfrontiert sahen, nicht-christliche Truppen engagiert zu
haben und aus diesem Grund das Verhalten des polnischen Königs stark nach
christlich-adligen Vorstellungen darstellten. Dem rex iustus oder rex pacificus
wurde der Deutsche Orden als Aggressor gegenübergestellt, wodurch die
Kampf auf f or derung zum Frevel wurde.814
811 Aus der Fülle der Literatur zu den Ereignissen während der Schlacht, der anschließenden
Entwicklung und ihrer jahrhundertelangen Rezeption sei hier mit weiteren Verweisen ge-
nannt: Sven Ekdahl: Die Schlacht bei Tannenberg 1410. Quellenkritische Untersuchungen.
Bd. 1: Einführung und Quellenlage, Berlin 1982 (Berliner Historische Studien, 8/1) und unter
militärisch-taktischem Aspekt Ders.: Aufmarsch und Aufstellung der Heere bei Tannen-
wald/Grunwald (1410): Eine kritische Analyse, in: Tradycje kulturowe i historyczne ziem
pruskich. Krajobraz grunwaldzki w dziejach polsko-krzyz.ackich i polsko-niemieckich na
przestrzeni wieków. Wokół mitów i rzeczywistości, hg. von Jan Gancewski, Olsztyn 2009
(Biblioteka Mragowskich Studiów Humanistycznych Historia, 1), S. 31-103 und Klaus Milit-
ZER: Das Problem der zwei Schwerter in der Schlacht bei Tannenberg, in: Rechtsverständnis,
hg. von Esders, S. 379-389 und jüngst Werner PARA VICINI, Rimvydas PETRAUSKAS, Grischa
Vercamer (Hgg.): Tannenberg - Grunwald - Zalgiris 1410. Krieg und Frieden im späten
Mittelalter, Wiesbaden 2012 (Deutsches Historisches Institut Warschau, 26).
812 Ekdahl, Schlacht, S. 157-158.
813 Ebd., S. 157-159 und Militzer, Schwerter, S. 384-389.
814 Dies ist in der moralisch-ethischen Konnotation der Herausforderung bereits so angelegt.
Hierzu schrieb Cram auf der Basis früh- und hochmittelalterlicher Beispiele: „Ihre Erschei-
nungweise in der Geschichtsschreibung ist in mancher Hinsicht dieselbe wie die der Heraus-
forderung und zweiseitigen Vereinbarung: Daß zum Beispiel in der Regel nur von einem
Siege des Guten die Kampf-Ankündigung erzählt wird, deutet wiederum auf jene Wertung
hin, die wir am ehesten aus der Zweikampf-Vor Stellung herleiten konnten, und wenn wir
diese Kampf-Ankündigung als eine Abart der wechselseitigen Reizreden der Heldensage an-
sehen so kommen wir ebenfalls auf den Zweikampf; ganz ebenso wie bei der Zweikampf-
Schlacht die Herausforderung, so ist auch hier die Kampf-Ankündigung allein noch keine
271
werden sollten und für deren Umsetzung bzw. Kenntnis auch im römisch-
deutschen Reich auf Herolde zurückgegriffen wurde. Dies war der Fall bei der
bekanntesten Aufforderung zur Schlacht durch Herolde des Reichs, der soge-
nannten Schlacht bei Tannenberg im Jahr 1410.811 Die Leitung des Deutschen
Ordens wollte dadurch erreichen, dass König Władysław II. von Polen und
Großfürst Witold von Litauen als Anführer des gegnerischen Heeres ihre tak-
tisch günstige Positionen verließen. Dazu sandte die militärische Führung des
Ordensheeres den Wappenkönig Romreich und einen Herold des Herzogs von
Stettin mit einer Aufforderung aus, die in der Übergabe von zwei Schwertern
bestand, welche die Herolde dem polnischen König und litauischen Großfürs-
ten als „Hilfe" in dem bevorstehenden Kampf sowie als Faustpfand die
Schlacht auch anzutreten, überreichten. Des Weiteren sollen die Herolde die
Fürsten mit „Du" angeredet haben, was auf die Anredeformel heidnischer
Stammeshäuptlinge verwies und auf der Basis adliger Umgangsformen eine
weitere Provokation dar stellte.812
Die Darstellung in der dem Deutschen Orden nahestehenden Geschichts-
schreibung zeigt, dass dieser Akt in der Vorstellungsweit des Adels entspre-
chend als „ritterlich" bewertet wurde und sich mit der Vorstellung von Her-
ausforderungen deckt, da man seine Absichten klar demonstriert hat.813 Ganz
anders wurde dies hingegen von polnischen Chronisten verstanden, die sich
mit dem Vorwurf konfrontiert sahen, nicht-christliche Truppen engagiert zu
haben und aus diesem Grund das Verhalten des polnischen Königs stark nach
christlich-adligen Vorstellungen darstellten. Dem rex iustus oder rex pacificus
wurde der Deutsche Orden als Aggressor gegenübergestellt, wodurch die
Kampf auf f or derung zum Frevel wurde.814
811 Aus der Fülle der Literatur zu den Ereignissen während der Schlacht, der anschließenden
Entwicklung und ihrer jahrhundertelangen Rezeption sei hier mit weiteren Verweisen ge-
nannt: Sven Ekdahl: Die Schlacht bei Tannenberg 1410. Quellenkritische Untersuchungen.
Bd. 1: Einführung und Quellenlage, Berlin 1982 (Berliner Historische Studien, 8/1) und unter
militärisch-taktischem Aspekt Ders.: Aufmarsch und Aufstellung der Heere bei Tannen-
wald/Grunwald (1410): Eine kritische Analyse, in: Tradycje kulturowe i historyczne ziem
pruskich. Krajobraz grunwaldzki w dziejach polsko-krzyz.ackich i polsko-niemieckich na
przestrzeni wieków. Wokół mitów i rzeczywistości, hg. von Jan Gancewski, Olsztyn 2009
(Biblioteka Mragowskich Studiów Humanistycznych Historia, 1), S. 31-103 und Klaus Milit-
ZER: Das Problem der zwei Schwerter in der Schlacht bei Tannenberg, in: Rechtsverständnis,
hg. von Esders, S. 379-389 und jüngst Werner PARA VICINI, Rimvydas PETRAUSKAS, Grischa
Vercamer (Hgg.): Tannenberg - Grunwald - Zalgiris 1410. Krieg und Frieden im späten
Mittelalter, Wiesbaden 2012 (Deutsches Historisches Institut Warschau, 26).
812 Ekdahl, Schlacht, S. 157-158.
813 Ebd., S. 157-159 und Militzer, Schwerter, S. 384-389.
814 Dies ist in der moralisch-ethischen Konnotation der Herausforderung bereits so angelegt.
Hierzu schrieb Cram auf der Basis früh- und hochmittelalterlicher Beispiele: „Ihre Erschei-
nungweise in der Geschichtsschreibung ist in mancher Hinsicht dieselbe wie die der Heraus-
forderung und zweiseitigen Vereinbarung: Daß zum Beispiel in der Regel nur von einem
Siege des Guten die Kampf-Ankündigung erzählt wird, deutet wiederum auf jene Wertung
hin, die wir am ehesten aus der Zweikampf-Vor Stellung herleiten konnten, und wenn wir
diese Kampf-Ankündigung als eine Abart der wechselseitigen Reizreden der Heldensage an-
sehen so kommen wir ebenfalls auf den Zweikampf; ganz ebenso wie bei der Zweikampf-
Schlacht die Herausforderung, so ist auch hier die Kampf-Ankündigung allein noch keine