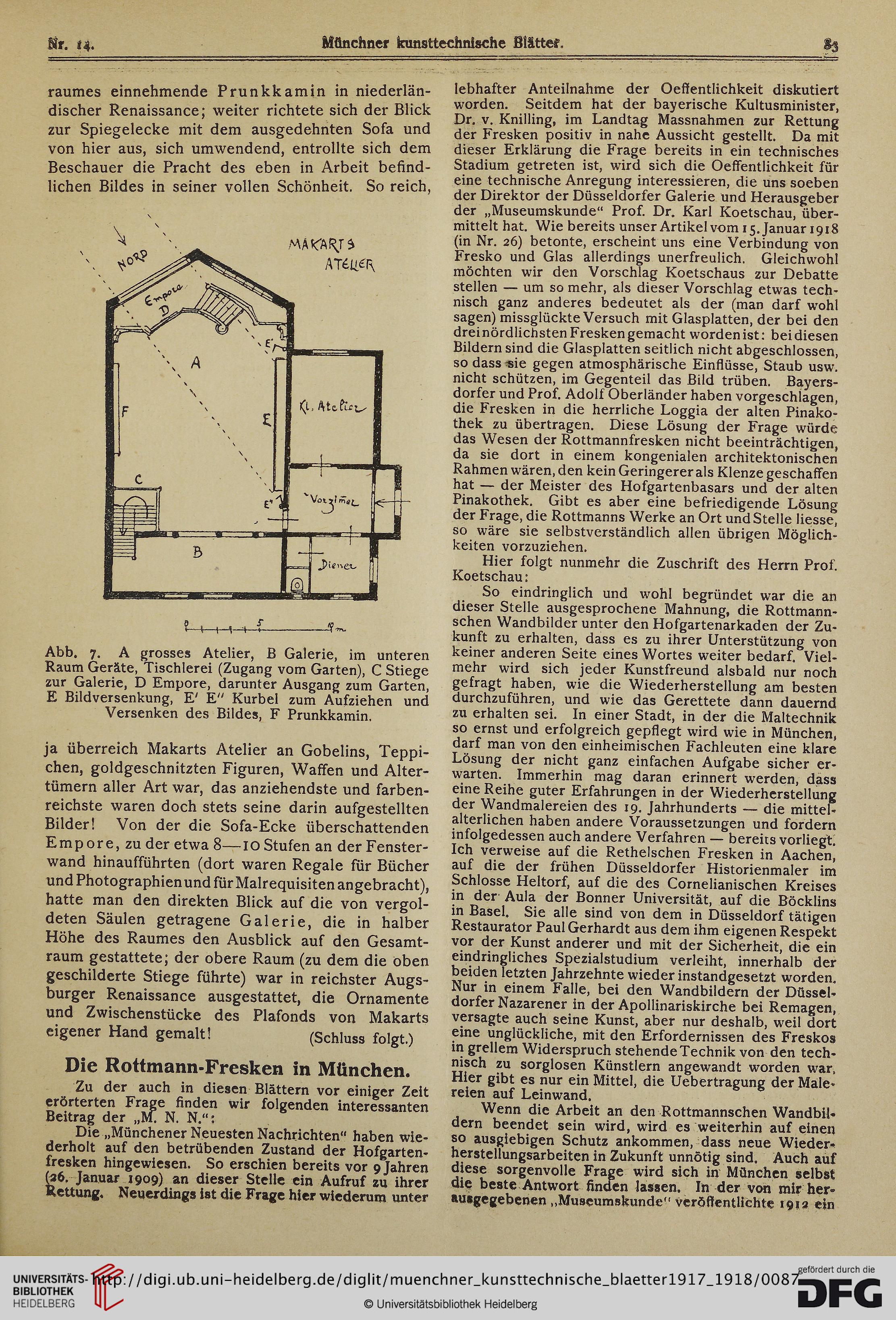Rf. *4.
Münchner kunsttechnische Biättef.
raumes einnehmende Prunkkamin in niederlän-
discher Renaissance; weiter richtete sich der Blick
zur Spiegeiecke mit dem ausgedehnten Sofa und
von hier aus, sich umwendend, entrolite sich dem
Beschauer die Pracht des eben in Arbeit befind-
lichen Bildes in seiner vollen Schönheit. So reich,
Abb. 7. A grosses Atelier, B Galerie, im unteren
Raum Geräte, Tischlerei (Zugang vom Garten), C Stiege
zur Galerie, D Empore, darunter Ausgang zum Garten,
E Bildversenkung, E' E" Kurbel zum Aufziehen und
Versenken des Bildes, F Prunkkamin.
ja überreich Makarts Atelier an Gobelins, Teppi-
chen, goldgeschnitzten Figuren, Waffen und Alter-
tümern aller Art war, das anziehendste und farben-
reichste waren doch stets seine darin aufgestellten
Bilder! Von der die Sofa-Ecke überschattenden
Empore, zu der etwa 8—IO Stufen an der Fenster-
wand hinaufführten (dort waren Regale für Bücher
und Photographienund für Malrequisiten angebracht),
hatte man den direkten Blick auf die von vergol-
deten Säulen getragene Galerie, die in halber
Höhe des Raumes den Ausblick auf den Gesamt-
raum gestattete; der obere Raum (zu dem die oben
geschilderte Stiege führte) war in reichster Augs-
burger Renaissance ausgestattet, die Ornamente
und Zwischenstücke des Plafonds von Makarts
eigener Hand gemalt! (Schluss folgt.)
Die Rottmann-Fresken in München.
Zu der auch in diesen Blättern vor einiger Zeit
erörterten Frage finden wir folgenden interessanten
Beitrag der „M. N. N.":
Die „Münchener Neuesten Nachrichten" haben wie-
derholt auf den betrübenden Zustand der Hofgarten-
fresken hingewiesen. So erschien bereits vor 9 Jahren
(36. Januar 1909) an dieser Stelle ein Aufruf zu ihrer
Rettung. Neuerdings ist die Frage hier wiederum unter
lebhafter Anteilnahme der OeHentlichkeit diskutiert
worden. Seitdem hat der bayerische Kultusminister,
Dr. v. Knilling, im Landtag Massnahmen zur Rettung
der Fresken positiv in nahe Aussicht gestellt. Da mit
dieser Erklärung die Frage bereits in ein technisches
Stadium getreten ist, wird sich die Oeffentlichkeit für
eine technische Anregung interessieren, die uns soeben
der Direktor der Düsseldorfer Galerie und Herausgeber
der „Museumskunde" Prof. Dr. Karl Koetschau, über-
mittelt hat. Wie bereits unser Artikel vom Januar 19:8
(in Nr. 26) betonte, erscheint uns eine Verbindung von
Fresko und Glas allerdings unerfreulich. Gleichwohl
möchten wir den Vorschlag Koetschaus zur Debatte
stellen — um so mehr, als dieser Vorschlag etwas tech-
nisch ganz anderes bedeutet als der (man darf wohl
sagen) missglückte Versuch mit Glasplatten, der bei den
dreinördlichsten Freskengemacht wordenist: bei diesen
Bildern sind die Glasplatten seitlich nicht abgeschlossen,
so dass sie gegen atmosphärische Einflüsse, Staub usw.
nicht schützen, im Gegenteil das Bild trüben. Bayers-
dorfer und Prof. Adolf Oberländer haben vorgeschlagen,
die Fresken in die herrliche Loggia der alten Pinako-
thek zu übertragen. Diese Lösung der Frage würde
das Wesen der Rottmannfresken nicht beeinträchtigen,
da sie dort in einem kongenialen architektonischen
Rahmen wären, den kein Geringerer als Klenze geschaffen
hat — der Meister des Hofgartenbasars und der alten
Pinakothek. Gibt es aber eine befriedigende Lösung
der Frage, die Rottmanns Werke an Ort und Stelle Hesse,
so wäre sie selbstverständlich allen übrigen Möglich-
keiten vorzuziehen.
Hier folgt nunmehr die Zuschrift des Herrn Prof.
Koetschau:
So eindringlich und wohl begründet war die an
dieser Stelle ausgesprochene Mahnung, die Rottmann-
schen Wandbilder unter den Hofgartenarkaden der Zu-
kunft zu erhalten, dass es zu ihrer Unterstützung von
keiner anderen Seite eines Wortes weiter bedarf. Viel-
mehr wird sich jeder Kunstfreund alsbald nur noch
gefragt haben, wie die Wiederherstellung am besten
durchzuführen, und wie das Gerettete dann dauernd
zu erhalten sei. In einer Stadt, in der die Maltechnik
so ernst und erfolgreich gepflegt wird wie in München,
darf man von den einheimischen Fachleuten eine klare
Lösung der nicht ganz einfachen Aufgabe sicher er-
warten. Immerhin mag daran erinnert werden, dass
eine Reihe guter Erfahrungen in der Wiederherstellung
der Wandmalereien des 19. Jahrhunderts — die mittel-
alterlichen haben andere Voraussetzungen und fordern
infolgedessen auch andere Verfahren — bereits vorliegt.
Ich verweise auf die Rethelschen Fresken in Aachen,
auf die der frühen Düsseldorfer Historienmaler im
Schlosse Heltorf, auf die des Cornelianischen Kreises
in der Aula der Bonner Universität, auf die Böcklins
in Basel. Sie alle sind von dem in Düsseldorf tätigen
Restaurator Paul Gerhardt aus dem ihm eigenen Respekt
vor der Kunst anderer und mit der Sicherheit, die ein
eindringliches Spezialstudium verleiht, innerhalb der
beiden letzten Jahrzehnte wieder instandgesetzt worden.
Nur in einem Falle, bei den Wandbildern der Düssel-
dorfer Nazarener in der Apollinariskirche bei Remagen,
versagte auch seine Kunst, aber nur deshalb, weil dort
eine unglückliche, mit den Erfordernissen des Freskos
in grellem Widerspruch stehendeTechnik von den tech-
nisch zu sorglosen Künstlern angewandt worden war.
Hier gibt es nur ein Mittel, die Uebertragung der Male-
reien auf Leinwand.
Wenn die Arbeit an den Rottmannschen Wandbil-
dern beendet sein wird, wird es weiterhin auf einen
so ausgiebigen Schutz ankommen, dass neue Wieder-
herstellungsarbeiten in Zukunft unnötig sind. Auch auf
diese sorgenvolle Frage wird sich in München selbst
die beste Antwort finden lassen. In der von mir her-
ausgegebenen „Museumskunde" veröffentlichte :9ta ein
Münchner kunsttechnische Biättef.
raumes einnehmende Prunkkamin in niederlän-
discher Renaissance; weiter richtete sich der Blick
zur Spiegeiecke mit dem ausgedehnten Sofa und
von hier aus, sich umwendend, entrolite sich dem
Beschauer die Pracht des eben in Arbeit befind-
lichen Bildes in seiner vollen Schönheit. So reich,
Abb. 7. A grosses Atelier, B Galerie, im unteren
Raum Geräte, Tischlerei (Zugang vom Garten), C Stiege
zur Galerie, D Empore, darunter Ausgang zum Garten,
E Bildversenkung, E' E" Kurbel zum Aufziehen und
Versenken des Bildes, F Prunkkamin.
ja überreich Makarts Atelier an Gobelins, Teppi-
chen, goldgeschnitzten Figuren, Waffen und Alter-
tümern aller Art war, das anziehendste und farben-
reichste waren doch stets seine darin aufgestellten
Bilder! Von der die Sofa-Ecke überschattenden
Empore, zu der etwa 8—IO Stufen an der Fenster-
wand hinaufführten (dort waren Regale für Bücher
und Photographienund für Malrequisiten angebracht),
hatte man den direkten Blick auf die von vergol-
deten Säulen getragene Galerie, die in halber
Höhe des Raumes den Ausblick auf den Gesamt-
raum gestattete; der obere Raum (zu dem die oben
geschilderte Stiege führte) war in reichster Augs-
burger Renaissance ausgestattet, die Ornamente
und Zwischenstücke des Plafonds von Makarts
eigener Hand gemalt! (Schluss folgt.)
Die Rottmann-Fresken in München.
Zu der auch in diesen Blättern vor einiger Zeit
erörterten Frage finden wir folgenden interessanten
Beitrag der „M. N. N.":
Die „Münchener Neuesten Nachrichten" haben wie-
derholt auf den betrübenden Zustand der Hofgarten-
fresken hingewiesen. So erschien bereits vor 9 Jahren
(36. Januar 1909) an dieser Stelle ein Aufruf zu ihrer
Rettung. Neuerdings ist die Frage hier wiederum unter
lebhafter Anteilnahme der OeHentlichkeit diskutiert
worden. Seitdem hat der bayerische Kultusminister,
Dr. v. Knilling, im Landtag Massnahmen zur Rettung
der Fresken positiv in nahe Aussicht gestellt. Da mit
dieser Erklärung die Frage bereits in ein technisches
Stadium getreten ist, wird sich die Oeffentlichkeit für
eine technische Anregung interessieren, die uns soeben
der Direktor der Düsseldorfer Galerie und Herausgeber
der „Museumskunde" Prof. Dr. Karl Koetschau, über-
mittelt hat. Wie bereits unser Artikel vom Januar 19:8
(in Nr. 26) betonte, erscheint uns eine Verbindung von
Fresko und Glas allerdings unerfreulich. Gleichwohl
möchten wir den Vorschlag Koetschaus zur Debatte
stellen — um so mehr, als dieser Vorschlag etwas tech-
nisch ganz anderes bedeutet als der (man darf wohl
sagen) missglückte Versuch mit Glasplatten, der bei den
dreinördlichsten Freskengemacht wordenist: bei diesen
Bildern sind die Glasplatten seitlich nicht abgeschlossen,
so dass sie gegen atmosphärische Einflüsse, Staub usw.
nicht schützen, im Gegenteil das Bild trüben. Bayers-
dorfer und Prof. Adolf Oberländer haben vorgeschlagen,
die Fresken in die herrliche Loggia der alten Pinako-
thek zu übertragen. Diese Lösung der Frage würde
das Wesen der Rottmannfresken nicht beeinträchtigen,
da sie dort in einem kongenialen architektonischen
Rahmen wären, den kein Geringerer als Klenze geschaffen
hat — der Meister des Hofgartenbasars und der alten
Pinakothek. Gibt es aber eine befriedigende Lösung
der Frage, die Rottmanns Werke an Ort und Stelle Hesse,
so wäre sie selbstverständlich allen übrigen Möglich-
keiten vorzuziehen.
Hier folgt nunmehr die Zuschrift des Herrn Prof.
Koetschau:
So eindringlich und wohl begründet war die an
dieser Stelle ausgesprochene Mahnung, die Rottmann-
schen Wandbilder unter den Hofgartenarkaden der Zu-
kunft zu erhalten, dass es zu ihrer Unterstützung von
keiner anderen Seite eines Wortes weiter bedarf. Viel-
mehr wird sich jeder Kunstfreund alsbald nur noch
gefragt haben, wie die Wiederherstellung am besten
durchzuführen, und wie das Gerettete dann dauernd
zu erhalten sei. In einer Stadt, in der die Maltechnik
so ernst und erfolgreich gepflegt wird wie in München,
darf man von den einheimischen Fachleuten eine klare
Lösung der nicht ganz einfachen Aufgabe sicher er-
warten. Immerhin mag daran erinnert werden, dass
eine Reihe guter Erfahrungen in der Wiederherstellung
der Wandmalereien des 19. Jahrhunderts — die mittel-
alterlichen haben andere Voraussetzungen und fordern
infolgedessen auch andere Verfahren — bereits vorliegt.
Ich verweise auf die Rethelschen Fresken in Aachen,
auf die der frühen Düsseldorfer Historienmaler im
Schlosse Heltorf, auf die des Cornelianischen Kreises
in der Aula der Bonner Universität, auf die Böcklins
in Basel. Sie alle sind von dem in Düsseldorf tätigen
Restaurator Paul Gerhardt aus dem ihm eigenen Respekt
vor der Kunst anderer und mit der Sicherheit, die ein
eindringliches Spezialstudium verleiht, innerhalb der
beiden letzten Jahrzehnte wieder instandgesetzt worden.
Nur in einem Falle, bei den Wandbildern der Düssel-
dorfer Nazarener in der Apollinariskirche bei Remagen,
versagte auch seine Kunst, aber nur deshalb, weil dort
eine unglückliche, mit den Erfordernissen des Freskos
in grellem Widerspruch stehendeTechnik von den tech-
nisch zu sorglosen Künstlern angewandt worden war.
Hier gibt es nur ein Mittel, die Uebertragung der Male-
reien auf Leinwand.
Wenn die Arbeit an den Rottmannschen Wandbil-
dern beendet sein wird, wird es weiterhin auf einen
so ausgiebigen Schutz ankommen, dass neue Wieder-
herstellungsarbeiten in Zukunft unnötig sind. Auch auf
diese sorgenvolle Frage wird sich in München selbst
die beste Antwort finden lassen. In der von mir her-
ausgegebenen „Museumskunde" veröffentlichte :9ta ein