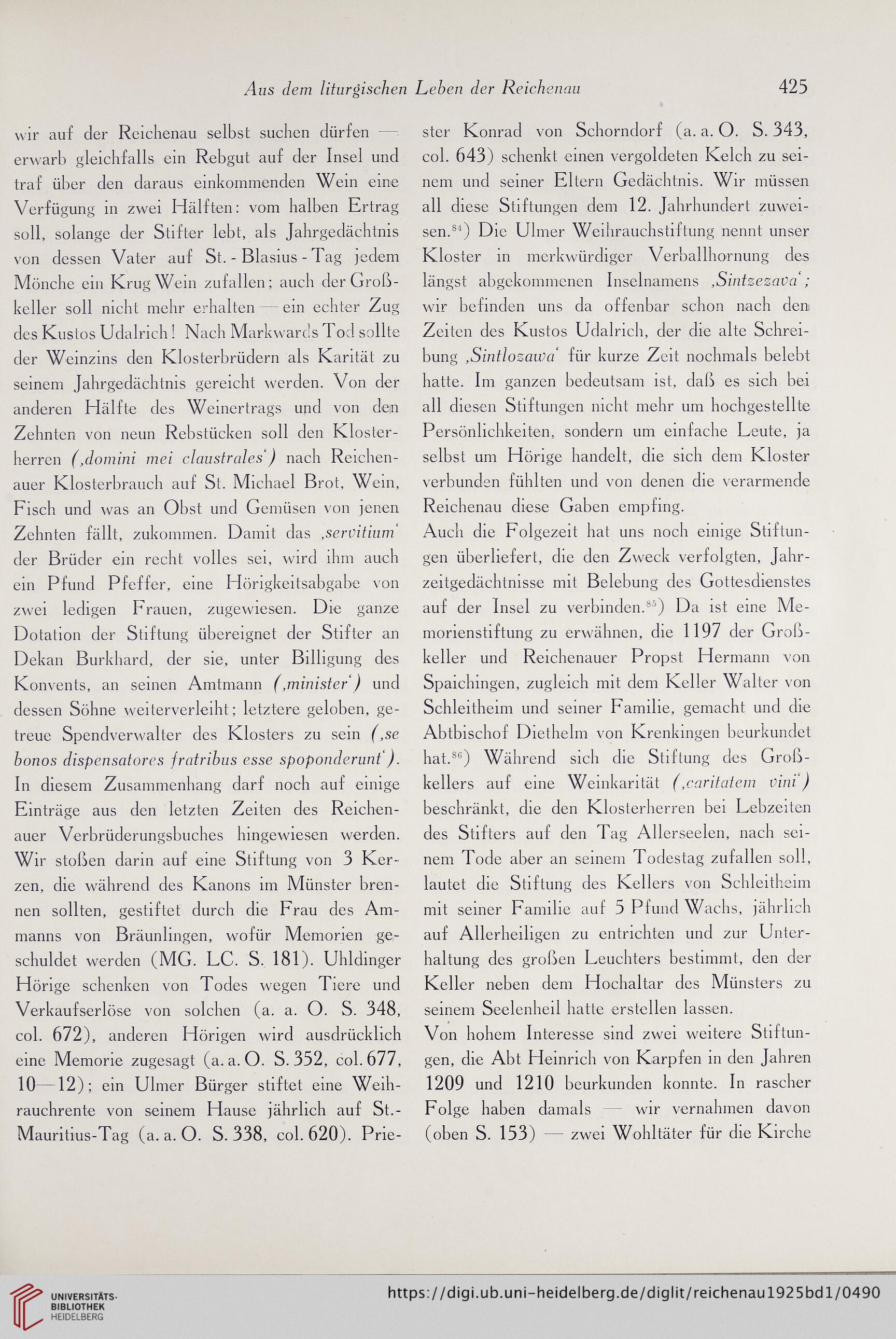Aus dem liturgischen Leben der Reichenau
425
wir auf der Reichenau selbst suchen dürfen —
erwarb gleichfalls ein Rebgut auf der Insel und
traf über den daraus einkommenden Wem eine
Verfügung in zwei Hälften: vom halben Ertrag
soll, solange der Stifter lebt, als Jahrgedächtnis
von dessen Vater auf St. - Blasius - Tag jedem
Mönche ein Krug Wem zufallen; auch der Groß -
heiler soll nicht mehr erhalten — em echter Zug
des Kustos Udalrich ! Nach Markwards Tod sollte
der Weinzins den Klosterbrüdern als Kantät zu
seinem Jahrgedächtnis gereicht werden. Von der
anderen Hälfte des Weinertrags und von den
Zehnten von neun Rebstücken soll den Kloster-
herren (,domini mei claustrales ) nach Reichen-
auer Klosterbrauch auf St. Michael Brot, Wem,
Fisch und was an Obst und Gemüsen von jenen
Zehnten fällt, zukommen. Damit das ,serüitium
der Brüder ein recht volles sei, wird ihm auch
ein Pfund Pfeffer, eine Hörigkeitsabgabe von
zwei ledigen Frauen, zugewiesen. Die ganze
Dotation der Stiftung übereignet der Stifter an
Dekan Burkhard, der sie, unter Billigung des
Konvents, an seinen Amtmann (,minister‘) und
dessen Söhne weiterverleiht; letztere geloben, ge-
treue Spendverwalter des Klosters zu sein (,se
bonos dispensatores fratribus esse spoponderunt ).
In diesem Zusammenhang darf noch auf einige
Einträge aus den letzten Zeiten des Reichen-
auer Verbrüderungsbuches hingewiesen werden.
Wir stoßen darin auf eine Stiftung von 3 Ker-
zen, die während des Kanons im Münster bren-
nen sollten, gestiftet durch die Frau des Am-
manns von Bräunlingen, wofür Memorien ge-
schuldet werden (MG. LC. S. 181). Uhldinger
Hörige schenken von Todes wegen Tiere und
Verkaufserlöse von solchen (a. a. O. S. 348,
col. 672), anderen Hörigen wird ausdrücklich
eine Memone zugesagt (a. a. O. S. 352, col. 677,
10 12) ; em Ulmer Bürger stiftet eine Weih-
rauchrente von seinem Hause jährlich auf St.-
Mauritius-Tag (a. a. O. S. 338, col. 620). Prie-
ster Konrad von Schorndorf (a. a. O. S. 343,
col. 643) schenkt einen vergoldeten Kelch zu sei-
nem und seiner Eltern Gedächtnis. Wir müssen
all diese Stiftungen dem 12. Jahrhundert zuwei-
sen.8'1) Die Ul mer Weihrauchstiftung nennt unser
Kloster in merkwürdiger Verballhornung des
längst abgekommenen Inselnamens ,SintzezaVa‘ ;
wir befinden uns da offenbar schon nach dem
Zeiten des Kustos Udalrich, der die alte Schrei-
bung ,Sintlozawa für kurze Zeit nochmals belebt
hatte. Im ganzen bedeutsam ist, daß es sich bei
all diesen Stiftungen nicht mehr um hochgestellte
Persönlichkeiten, sondern um einfache Leute, ja
selbst um Hörige handelt, die sich dem Kloster
verbunden fühlten und von denen die verarmende
Reichenau diese Gaben empfing.
Auch die Folgezeit hat uns noch einige Stiftun-
gen überliefert, die den Zweck verfolgten, Jahr-
zeitgedächtnisse mit Belebung des Gottesdienstes
auf der Insel zu verbinden.85) Da ist eine Me-
morienstiftung zu erwähnen, die 1197 der Groß-
keller und Reichenauer Propst Hermann von
Spaichingen, zugleich mit dem Keller Walter von
Schleitheim und seiner Familie, gemacht und die
Abtbischof Diethelm von Krenkingen beurkundet
hat.86) Während sich die Stiftung des Groß-
kellers auf eine Weinkarität (,caritatem vini )
beschränkt, die den Klosterherren bei Lebzeiten
des Stifters auf den Tag Allerseelen, nach sei-
nem Tode aber an seinem Todestag zufallen soll,
lautet die Stiftung des Kellers von Schleitheim
mit seiner Familie auf 5 Pfund Wachs, jährlich
auf Allerheiligen zu entrichten und zur Unter-
haltung des großen Leuchters bestimmt, den der
Keller neben dem Hochaltar des Münsters zu
seinem Seelenheil hatte erstellen lassen.
Von hohem Interesse sind zwei weitere Stiftun-
gen, die Abt Heinrich von Karpfen in den Jahren
1209 und 1210 beurkunden konnte. In rascher
Folge haben damals — wir vernahmen davon
(oben S. 153) — zwei Wohltäter für die Kirche
425
wir auf der Reichenau selbst suchen dürfen —
erwarb gleichfalls ein Rebgut auf der Insel und
traf über den daraus einkommenden Wem eine
Verfügung in zwei Hälften: vom halben Ertrag
soll, solange der Stifter lebt, als Jahrgedächtnis
von dessen Vater auf St. - Blasius - Tag jedem
Mönche ein Krug Wem zufallen; auch der Groß -
heiler soll nicht mehr erhalten — em echter Zug
des Kustos Udalrich ! Nach Markwards Tod sollte
der Weinzins den Klosterbrüdern als Kantät zu
seinem Jahrgedächtnis gereicht werden. Von der
anderen Hälfte des Weinertrags und von den
Zehnten von neun Rebstücken soll den Kloster-
herren (,domini mei claustrales ) nach Reichen-
auer Klosterbrauch auf St. Michael Brot, Wem,
Fisch und was an Obst und Gemüsen von jenen
Zehnten fällt, zukommen. Damit das ,serüitium
der Brüder ein recht volles sei, wird ihm auch
ein Pfund Pfeffer, eine Hörigkeitsabgabe von
zwei ledigen Frauen, zugewiesen. Die ganze
Dotation der Stiftung übereignet der Stifter an
Dekan Burkhard, der sie, unter Billigung des
Konvents, an seinen Amtmann (,minister‘) und
dessen Söhne weiterverleiht; letztere geloben, ge-
treue Spendverwalter des Klosters zu sein (,se
bonos dispensatores fratribus esse spoponderunt ).
In diesem Zusammenhang darf noch auf einige
Einträge aus den letzten Zeiten des Reichen-
auer Verbrüderungsbuches hingewiesen werden.
Wir stoßen darin auf eine Stiftung von 3 Ker-
zen, die während des Kanons im Münster bren-
nen sollten, gestiftet durch die Frau des Am-
manns von Bräunlingen, wofür Memorien ge-
schuldet werden (MG. LC. S. 181). Uhldinger
Hörige schenken von Todes wegen Tiere und
Verkaufserlöse von solchen (a. a. O. S. 348,
col. 672), anderen Hörigen wird ausdrücklich
eine Memone zugesagt (a. a. O. S. 352, col. 677,
10 12) ; em Ulmer Bürger stiftet eine Weih-
rauchrente von seinem Hause jährlich auf St.-
Mauritius-Tag (a. a. O. S. 338, col. 620). Prie-
ster Konrad von Schorndorf (a. a. O. S. 343,
col. 643) schenkt einen vergoldeten Kelch zu sei-
nem und seiner Eltern Gedächtnis. Wir müssen
all diese Stiftungen dem 12. Jahrhundert zuwei-
sen.8'1) Die Ul mer Weihrauchstiftung nennt unser
Kloster in merkwürdiger Verballhornung des
längst abgekommenen Inselnamens ,SintzezaVa‘ ;
wir befinden uns da offenbar schon nach dem
Zeiten des Kustos Udalrich, der die alte Schrei-
bung ,Sintlozawa für kurze Zeit nochmals belebt
hatte. Im ganzen bedeutsam ist, daß es sich bei
all diesen Stiftungen nicht mehr um hochgestellte
Persönlichkeiten, sondern um einfache Leute, ja
selbst um Hörige handelt, die sich dem Kloster
verbunden fühlten und von denen die verarmende
Reichenau diese Gaben empfing.
Auch die Folgezeit hat uns noch einige Stiftun-
gen überliefert, die den Zweck verfolgten, Jahr-
zeitgedächtnisse mit Belebung des Gottesdienstes
auf der Insel zu verbinden.85) Da ist eine Me-
morienstiftung zu erwähnen, die 1197 der Groß-
keller und Reichenauer Propst Hermann von
Spaichingen, zugleich mit dem Keller Walter von
Schleitheim und seiner Familie, gemacht und die
Abtbischof Diethelm von Krenkingen beurkundet
hat.86) Während sich die Stiftung des Groß-
kellers auf eine Weinkarität (,caritatem vini )
beschränkt, die den Klosterherren bei Lebzeiten
des Stifters auf den Tag Allerseelen, nach sei-
nem Tode aber an seinem Todestag zufallen soll,
lautet die Stiftung des Kellers von Schleitheim
mit seiner Familie auf 5 Pfund Wachs, jährlich
auf Allerheiligen zu entrichten und zur Unter-
haltung des großen Leuchters bestimmt, den der
Keller neben dem Hochaltar des Münsters zu
seinem Seelenheil hatte erstellen lassen.
Von hohem Interesse sind zwei weitere Stiftun-
gen, die Abt Heinrich von Karpfen in den Jahren
1209 und 1210 beurkunden konnte. In rascher
Folge haben damals — wir vernahmen davon
(oben S. 153) — zwei Wohltäter für die Kirche