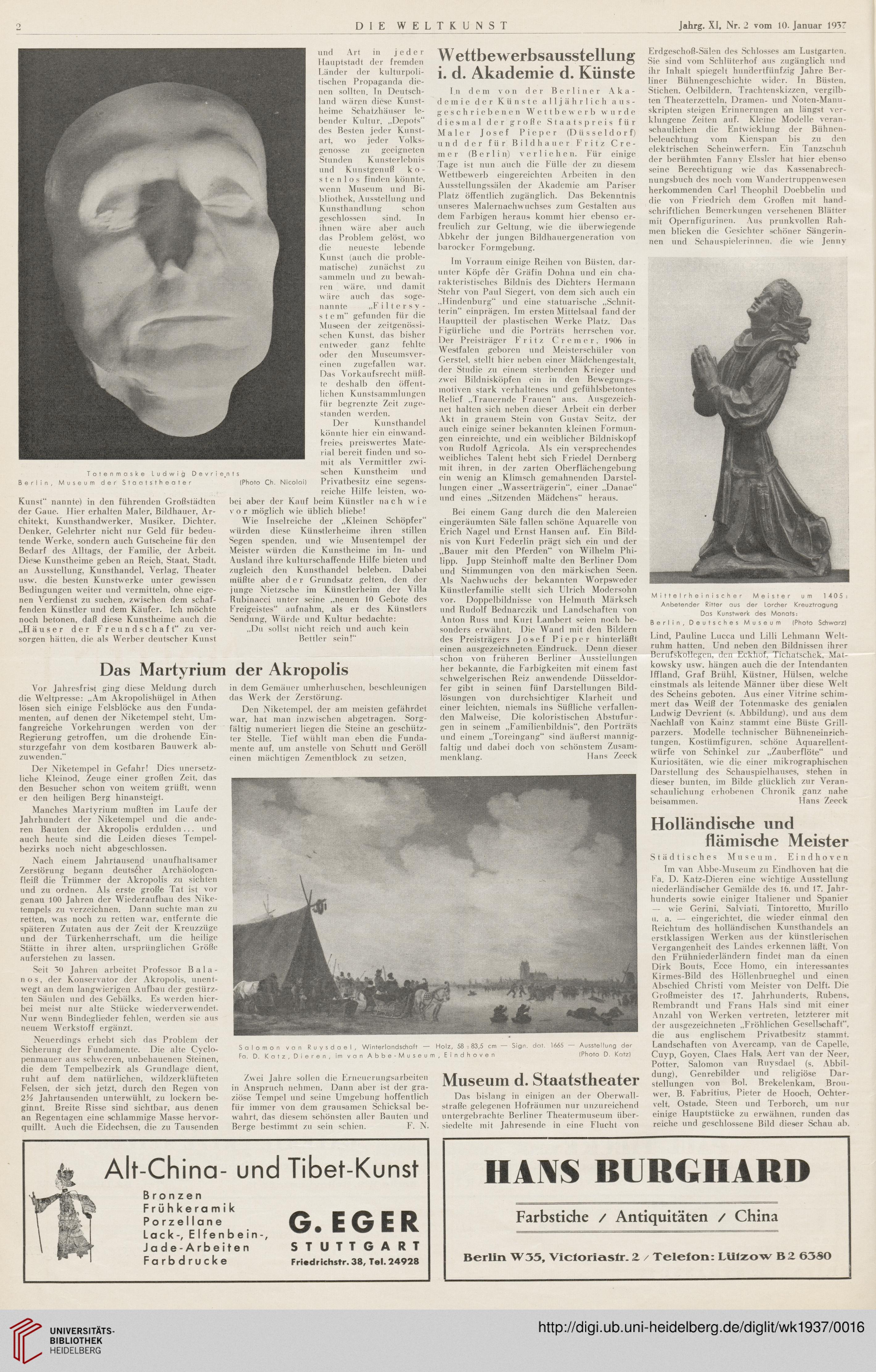DIE WELTKUNST
Jahrg. XI, Nr. 2 vom 10. Januar 1937
Berlin,
M
Totenmaske Ludwig Devri etn t s
useum der Staatstheater (Photo
Ch. Nicolai)
Kunst“ nannte) in den führenden Großstädten
der Gaue. Hier erhalten Maler, Bildhauer, Ar-
chitekt, Kunsthandwerker, Musiker, Dichter,
Denker, Gelehrter nicht nur Geld für bedeu-
tende Werke, sondern auch Gutscheine für den
Bedarf des Alltags, der Familie, der Arbeit.
Diese Kunstheime geben an Reich, Staat, Stadt,
an Ausstellung, Kunsthandel, Verlag, Theater
usw. die besten Kunstwerke unter gewissen
Bedingungen weiter und vermitteln, ohne eige-
nen Verdienst zu suchen, zwischen dem schaf-
fenden Künstler und dem Käufer. Ich möchte
noch betonen, daß diese Kunstheime auch die
„Häuser der Freundschaft“ zu ver-
sorgen hätten, die als Werber deutscher Kunst
und Art in jeder
Hauptstadt der fremden
Länder der kulturpoli-
tischen Propaganda die-
nen sollten. In Deutsch-
land wären diese Kunst-
heime Schatzhäuser le-
bender Kultur, „Depots“
des Besten jeder Kunst-
art, wo jeder Volks-
genosse zu geeigneten
Stunden Kunsterlebnis
und Kunstgenuß ko-
stenlos finden könnte,
wenn Museum und Bi-
bliothek, Ausstellung und
Kunsthandlung schon
geschlossen sind. In
ihnen wäre aber auch
das Problem gelöst, wo
die neueste lebende
Kunst (auch die proble-
matische) zunächst zu
sammeln und zu bewah-
ren wäre, und damit
wäre auch das soge-
nannte „F i 11 e r s y -
st em“ gefunden für die
Museen der zeitgenössi-
schen Kunst, das bisher
entweder ganz fehlte
oder den Museumsver-
einen zugefallen war.
Das Vorkaufsrecht müß-
te deshalb den öffent-
lichen Kunstsammlungen
für begrenzte Zeit zuge-
standen werden.
Der Kunsthandel
könnte hier ein einwand-
freies preiswertes Mate-
rial bereit finden und so-
mit als Vermittler zwi-
schen Kunstheim und
Privatbesitz eine segens-
reiche Hilfe leisten, wo-
bei aber der Kauf beim Künstler nach wie
vor möglich wie üblich bliebe!
Wie Inselreiche der „Kleinen Schöpfer"
würden diese Künstlerheime ihren stillen
Segen spenden, und wie Musentempel der
Meister würden die Kunstheime im In- und
Ausland ihre kulturschaffende Hilfe bieten und
zugleich den Kunsthandel beleben. Dabei
müßte aber d e r Grundsatz gelten, den der
junge Nietzsche im Künstlerlieim der Villa
Rubinacci unter seine „neuen 10 Gebote des
Freigeistes“ aufnahm, als er des Künstlers
Sendung, Würde und Kultur bedachte:
„Du sollst nicht reich und auch kein
Bettler sein!“
Das Martyrium der Akropolis
Vor Jahresfrist ging diese Meldung durch
die Weltpresse: „Am Akropolishügel in Athen
lösen sich einige Felsblöcke aus den Funda-
menten, auf denen der Niketempel steht. Um-
fangreiche Vorkehrungen werden von der
Regierung getroffen, um die drohende Ein-
sturzgefahr von dem kostbaren Bauwerk ab-
zuwenden.“
in dem Gemäuer umherhuschen, beschleunigen
das Werk der Zerstörung.
Den Niketempel, der am meisten gefährdet
war, hat man inzwischen abgetragen. Sorg-
fältig numeriert liegen die Steine an geschütz-
ter Stelle. Tief wühlt man eben die Funda-
mente auf. um anstelle von Schutt und Geröll
einen mächtigen Zementblock zu setzen.
W eftbewerbsausstellung
i. d. Akademie d. Künste
In dem von der Berliner Aka-
demie der Künste alljährlich aus-
geschriebenen Wettbewerb wurde
diesmal der große Staatspreis für
Maler Josef Pieper (Düsseldorf)
und der für Bildhauer Fritz Cre-
mer (Berlin) verliehen. Für einige
Tage ist nun auch die Fülle der zu diesem
Wettbewerb eingereichten Arbeiten in den
Ausstellungssälen der Akademie am Pariser
Platz öffentlich zugänglich. Das Bekenntnis
unseres Malernachwuchses zum Gestalten aus
dem Farbigen heraus kommt hier ebenso er-
freulich zur Geltung, wie die überwiegende
Abkehr der jungen Bildhauergeneration von
barocker Formgebung.
Im Vorraum einige Reihen von Büsten, dar-
unter Köpfe der Gräfin Dohna und ein cha-
rakteristisches Bildnis des Dichters Hermann
Stehr von Paul Siegert, von dem sich auch ein
..Hindenburg“ und eine statuarische „Schnit-
terin“ einprägen. Im ersten Mittelsaal fand der
Hauptteil der plastischen Werke Platz. Das
Figürliche und die Porträts herrschen vor.
Der Preisträger Fritz Cremer, 1906 in
Westfalen geboren und Meisterschüler von
Gerstel, stellt hier neben einer Mädchengestalt,
der Studie zu einem sterbenden Krieger und
zwei Bildnisköpfen ein in den Bewegungs-
motiven stark verhaltenes und gefühlsbetontes
Relief ..Trauernde Frauen" aus. Ausgezeich-
net halten sich neben dieser Arbeit ein derber
Akt in grauem Stein von Gustav Seitz, der
auch einige seiner bekannten kleinen Formun-
gen einreichte, und ein weiblicher Bildniskopf
von Rudolf Agricola. Als ein versprechendes
weibliches Talent hebt sich Friedel Dernberg
mit ihren, in der zarten Oberflächengebung
ein wenig an Klimsch gemahnenden Darstel-
lungen einer „Wasserträgerin“, einer ..Danae“
und eines „Sitzenden Mädchens“ heraus.
Bei einem Gang durch die den Malereien
eingeräumten Säle fallen schöne Aquarelle von
Erich Nagel und Ernst Hansen auf. Ein Bild-
nis von Kurt Federlin prägt sich ein und der
„Bauer mit den Pferden“ von Wilhelm Phi-
lipp. Jupp Steinhoff malte den Berliner Dom
und Stimmungen von den märkischen Seen.
Als Nachwuchs der bekannten Worpsweder
Künstlerfamilie stellt sich Ulrich Modersohn
vor. Doppelbildnisse von Helmuth Märksch
und Rudolf Bednarczik und Landschaften von
Anton Russ und Kurt Lambert seien noch be-
sonders erwähnt. Die Wand mit den Bildern
des Preisträgers Josef Pieper hinterläßt
einen ausgezeichneten Eindruck. Denn dieser
schon von früheren Berliner Ausstellungen
her bekannte, die Farbigkeiten mit einem fast
schwelgerischen Reiz anwendende Düsseldor-
fer gibt in seinen fünf Darstellungen Bild-
lösungen von durchsichtiger Klarheit und
einer leichten, niemals ins Süßliche verfallen-
den Malweise. Die koloristischen Abstufur-
gen in seinem „Familienbildnis“, den Porträts
und einem „Toreingang“ sind äußerst mannig-
faltig und dabei doch von schönstem Zusam-
menklang. Hans Zeeck
Der Niketempel in Gefahr! Dies unersetz-
liche Kleinod, Zeuge einer großen Zeit, das
den Besucher schon von weitem grüßt, wenn
er den heiligen Berg hinansteigt.
Manches Martyrium mußten im Laufe der
Jahrhundert der Niketempel und die ande-
ren Bauten der Akropolis erdulden ... und
auch heute sind die Leiden dieses Tempel-
bezirks noch nicht abgeschlossen.
Nach einem Jahrtausend unaufhaltsamer
Zerstörung begann deutscher Archäologen-
fleiß die Trümmer der Akropolis zu sichten
und zu ordnen. Als erste große Tat ist vor
genau 100 Jahren der Wiederaufbau des Nike-
tempels zu verzeichnen. Dann suchte man zu
retten, was noch zu retten war, entfernte die
späteren Zutaten aus der Zeit der Kreuzzüge
und der Türkenherrschaft, um die heilige
Stätte in ihrer alten, ursprünglichen Größe
auferstehen zu lassen.
Seit 50 Jahren arbeitet Professor Bala-
n o s, der Konservator der Akropolis, unent-
wegt an dem langwierigen Aufbau der gestürz-
ten Säulen und des Gebälks. Es werden hier-
bei meist nur alte Stücke wiederverwendet.
Nur wenn Bindeglieder fehlen, werden sie aus
neuem Werkstoff ergänzt.
Neuerdings erhebt sich das Problem der
Sicherung der Fundamente. Die alte Cyclo-
penmauer aus schweren, unbehauenen Steinen,
die dem Tempelbezirk als Grundlage dient,
ruht auf dem natürlichen, wildzerklüfteten
Felsen, der sich jetzt, durch den Regen von
2% Jahrtausenden unterwühlt, zu lockern be-
ginnt. Breite Risse sind sichtbar, aus denen
an Regentagen eine schlammige Masse hervor-
quillt. Auch die Eidechsen, die zu Tausenden
Salomon van Ruysdael, Winterlandschaft — Holz, 58 : 83,5 cm — Sign. dat. 1665 Ausstellung der
Fa. D. Katz, Pieren, im van Abbe-Museum, Eindhoven (Photo D. Katz}
Zwei Jahre sollen die Erneuerungsarbeiten
in Anspruch nehmen. Dann aber ist der gra-
ziöse Tempel und seine Umgebung hoffentlich
für immer von dem grausamen Schicksal be-
wahrt, das diesem schönsten aller Bauten und
Berge bestimmt zu sein schien. F. N.
Museum d. Staatstheater
Das bislang in einigen an der Oberwall-
straße gelegenen Hofräumen nur unzureichend
untergebrachte Berliner Theatermuseum über-
siedelte mit Jahresende in eine Flucht von
Erdgeschoß-Sälen des Schlosses am Lustgarten.
Sie sind vom Schlüterhof aus zugänglich und
ihr Inhalt spiegelt hundertfünfzig Jahre Ber-
liner Bühnengeschichte wider. In Büsten,
Stichen. Oelbildern, Trachtenskizzen, vergilb-
ten Theaterzetteln, Dramen- und Noten-Manu-
skripten steigen Erinnerungen an längst ver-
klungene Zeiten auf. Kleine Modelle veran-
schaulichen die Entwicklung der Bühnen-
beleuchtung vom Kienspan bis zu den
elektrischen Scheinwerfern. Ein Tanzschuh
der berühmten Fanny Elssler hat hier ebenso
seine Berechtigung wie das Kassenabrech-
nungsbuch des noch vom Wandertruppenwesen
herkommenden Carl Theophil Doebbelin und
die von Friedrich dem Großen mit hand-
schriftlichen Bemerkungen versehenen Blätter
mit Opernfigurinen. Aus prunkvollen Rah-
men blicken die Gesichter schöner Sängerin-
nen und Schauspielerinnen, die wie Jenny
Mittelrheinischer Meister um 1405:
Anbetender Ritter aus der Lorcher Kreuztragung
Das Kunstwerk des Monats:
Berlin, Deutsches Museum (Photo Schwarz)
Lind, Pauline Lucca und Lilli Lehmann Welt-
ruhm hatten. Und neben den Bildnissen ihrer
Berufskollegen, den Eckhof, Tichatschek. Mat-
kowsky usw. hängen auch die der Intendanten
Iffland, Graf Brühl, Küstner, Hülsen, welche
einstmals als leitende Männer über diese Welt
des Scheins geboten. Aus einer Vitrine schim-
mert das Weiß der Totenmaske des genialen
Ludwig Devrient (s. Abbildung), und aus dem
Nachlaß von Kainz stammt eine Büste Grill-
parzers. Modelle technischer Bühneneinrich-
tungen, Kostümfiguren, schöne Aquarellent-
würfe von Schinkel zur „Zauberflöte“ und
Kuriositäten, wie die einer mikrographischen
Darstellung des Schauspielhauses, stehen in
dieser bunten, im Bilde glücklich zur Veran-
schaulichung erhobenen Chronik ganz nahe
beisammen. Hans Zeeck
Holländische und
flämische Meister
Städtisches Museum, Eindhoven
Im van Abbe-Museum zu Eindhoven hat die
Fa. D. Katz-Dieren eine wichtige Ausstellung
niederländischer Gemälde des 16. und 17. Jahr-
hunderts sowie einiger Italiener und Spanier
— wie Gerini, Salviati, Tintoretto, Murillo
u. a. — eingerichtet, die wieder einmal den
Reichtum des holländischen Kunsthandels an
erstklassigen Werken aus der künstlerischen
Vergangenheit des Landes erkennen läßt. Von
den Frühniederländern findet man da einen
Dirk Bouts, Ecce Homo, ein interessantes
Kirmes-Bild des Höllenbrueghel und einen
Abschied Christi vom Meister von Delft. Die
Großmeister des 17. Jahrhunderts, Rubens,
Rembrandt und Frans Hals sind mit einer
Anzahl von Werken vertreten, letzterer mit
der ausgezeichneten „Fröhlichen Gesellschaft",
die aus englischem Privatbesitz stammt.
Landschaften von Avercamp, van de Capelle,
Cuyp, Goyen, Claes Hals, Aert van der Neer,
Potter, Salomon van Ruysdael (s. Abbil-
dung), Genrebilder und religiöse Dar-
stellungen von Boi, Brekelenkam, Brou-
wer, B. Fabritius, Pieter de Hooch, Ochter-
velt, Ostade, Steen und Terborch, um nur
einige Hauptstücke zu erwähnen, runden das
reiche und geschlossene Bild dieser Schau ab.
HANS BlIRGHARD
Farbstiche / Antiquitäten / China
Berlin W35, Victorlastr. 2 / Telefon: Lülzow B2 6380