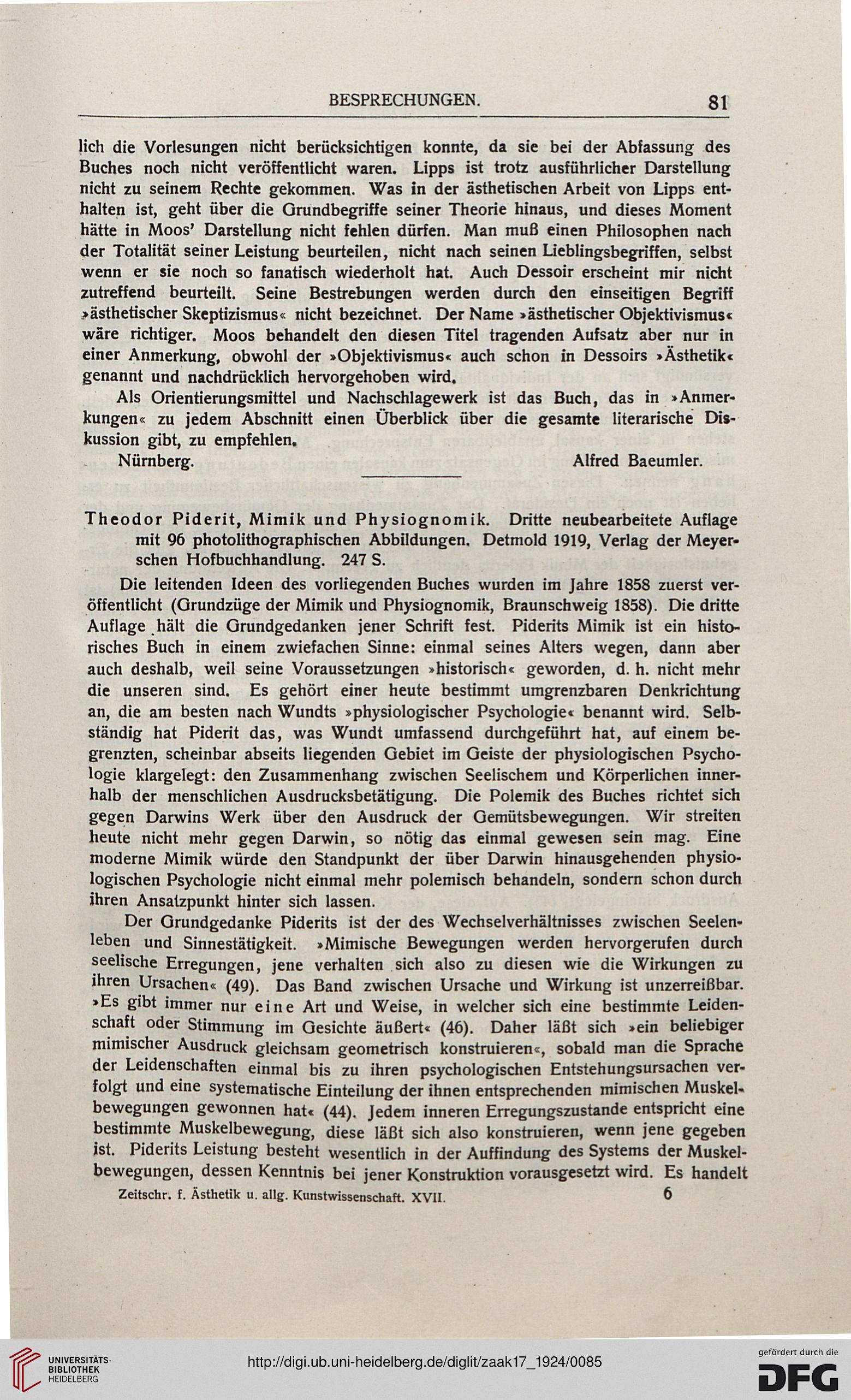BESPRECHUNGEN. 81
lieh die Vorlesungen nicht berücksichtigen konnte, da sie bei der Abfassung des
Buches noch nicht veröffentlicht waren. Lipps ist trotz ausführlicher Darstellung
nicht zu seinem Rechte gekommen. Was in der ästhetischen Arbeit von Lipps ent-
halten ist, geht über die Grundbegriffe seiner Theorie hinaus, und dieses Moment
hätte in Moos' Darstellung nicht fehlen dürfen. Man muß einen Philosophen nach
der Totalität seiner Leistung beurteilen, nicht nach seinen Lieblingsbegriffen, selbst
wenn er sie noch so fanatisch wiederholt hat. Auch Dessoir erscheint mir nicht
zutreffend beurteilt. Seine Bestrebungen werden durch den einseitigen Begriff
;► ästhetischer Skeptizismus« nicht bezeichnet. Der Name »ästhetischer Objektivismusc
wäre richtiger. Moos behandelt den diesen Titel tragenden Aufsatz aber nur in
einer Anmerkung, obwohl der »Objektivismus« auch schon in Dessoirs »Ästhetik«
genannt und nachdrücklich hervorgehoben wird.
Als Orientierungsmittel und Nachschlagewerk ist das Buch, das in »Anmer-
kungen« zu jedem Abschnitt einen Überblick über die gesamte literarische Dis-
kussion gibt, zu empfehlen.
Nürnberg. Alfred Baeumler.
Theodor Piderit, Mimik und Physiognomik. Dritte neubearbeitete Auflage
mit 96 photolithographischen Abbildungen. Detmold 1919, Verlag der Meyer-
schen Hofbuchhandlung. 247 S.
Die leitenden Ideen des vorliegenden Buches wurden im Jahre 1858 zuerst ver-
öffentlicht (Grundzüge der Mimik und Physiognomik, Braunschweig 1858). Die dritte
Auflage hält die Grundgedanken jener Schrift fest. Piderits Mimik ist ein histo-
risches Buch in einem zwiefachen Sinne: einmal seines Alters wegen, dann aber
auch deshalb, weil seine Voraussetzungen »historisch« geworden, d. h. nicht mehr
die unseren sind. Es gehört einer heute bestimmt umgrenzbaren Denkrichtung
an, die am besten nach Wundts »physiologischer Psychologie« benannt wird. Selb-
ständig hat Piderit das, was Wundt umfassend durchgeführt hat, auf einem be-
grenzten, scheinbar abseits liegenden Gebiet im Geiste der physiologischen Psycho-
logie klargelegt: den Zusammenhang zwischen Seelischem und Körperlichen inner-
halb der menschlichen Ausdrucksbetätigung. Die Polemik des Buches richtet sich
gegen Darwins Werk über den Ausdruck der Gemütsbewegungen. Wir streiten
heute nicht mehr gegen Darwin, so nötig das einmal gewesen sein mag. Eine
moderne Mimik würde den Standpunkt der über Darwin hinausgehenden physio-
logischen Psychologie nicht einmal mehr polemisch behandeln, sondern schon durch
ihren Ansatzpunkt hinter sich lassen.
Der Grundgedanke Piderits ist der des Wechselverhältnisses zwischen Seelen-
leben und Sinnestätigkeit. »Mimische Bewegungen werden hervorgerufen durch
seelische Erregungen, jene verhalten sich also zu diesen wie die Wirkungen zu
ihren Ursachen« (49). Das Band zwischen Ursache und Wirkung ist unzerreißbar.
»Es gibt immer nur eine Art und Weise, in welcher sich eine bestimmte Leiden-
schaft oder Stimmung im Gesichte äußert« (46). Daher läßt sich »ein beliebiger
mimischer Ausdruck gleichsam geometrisch konstruieren«, sobald man die Sprache
der Leidenschaften einmal bis zu ihren psychologischen Entstehungsursachen ver-
folgt und eine systematische Einteilung der ihnen entsprechenden mimischen Muskel-
bewegungen gewonnen hat« (44). Jedem inneren Erregungszustande entspricht eine
bestimmte Muskelbewegung, diese läßt sich also konstruieren, wenn jene gegeben
ist. Piderits Leistung besteht wesentlich in der Auffindung des Systems der Muskel-
bewegungen, dessen Kenntnis bei jener Konstruktion vorausgesetzt wird. Es handelt
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. XVII. 6
lieh die Vorlesungen nicht berücksichtigen konnte, da sie bei der Abfassung des
Buches noch nicht veröffentlicht waren. Lipps ist trotz ausführlicher Darstellung
nicht zu seinem Rechte gekommen. Was in der ästhetischen Arbeit von Lipps ent-
halten ist, geht über die Grundbegriffe seiner Theorie hinaus, und dieses Moment
hätte in Moos' Darstellung nicht fehlen dürfen. Man muß einen Philosophen nach
der Totalität seiner Leistung beurteilen, nicht nach seinen Lieblingsbegriffen, selbst
wenn er sie noch so fanatisch wiederholt hat. Auch Dessoir erscheint mir nicht
zutreffend beurteilt. Seine Bestrebungen werden durch den einseitigen Begriff
;► ästhetischer Skeptizismus« nicht bezeichnet. Der Name »ästhetischer Objektivismusc
wäre richtiger. Moos behandelt den diesen Titel tragenden Aufsatz aber nur in
einer Anmerkung, obwohl der »Objektivismus« auch schon in Dessoirs »Ästhetik«
genannt und nachdrücklich hervorgehoben wird.
Als Orientierungsmittel und Nachschlagewerk ist das Buch, das in »Anmer-
kungen« zu jedem Abschnitt einen Überblick über die gesamte literarische Dis-
kussion gibt, zu empfehlen.
Nürnberg. Alfred Baeumler.
Theodor Piderit, Mimik und Physiognomik. Dritte neubearbeitete Auflage
mit 96 photolithographischen Abbildungen. Detmold 1919, Verlag der Meyer-
schen Hofbuchhandlung. 247 S.
Die leitenden Ideen des vorliegenden Buches wurden im Jahre 1858 zuerst ver-
öffentlicht (Grundzüge der Mimik und Physiognomik, Braunschweig 1858). Die dritte
Auflage hält die Grundgedanken jener Schrift fest. Piderits Mimik ist ein histo-
risches Buch in einem zwiefachen Sinne: einmal seines Alters wegen, dann aber
auch deshalb, weil seine Voraussetzungen »historisch« geworden, d. h. nicht mehr
die unseren sind. Es gehört einer heute bestimmt umgrenzbaren Denkrichtung
an, die am besten nach Wundts »physiologischer Psychologie« benannt wird. Selb-
ständig hat Piderit das, was Wundt umfassend durchgeführt hat, auf einem be-
grenzten, scheinbar abseits liegenden Gebiet im Geiste der physiologischen Psycho-
logie klargelegt: den Zusammenhang zwischen Seelischem und Körperlichen inner-
halb der menschlichen Ausdrucksbetätigung. Die Polemik des Buches richtet sich
gegen Darwins Werk über den Ausdruck der Gemütsbewegungen. Wir streiten
heute nicht mehr gegen Darwin, so nötig das einmal gewesen sein mag. Eine
moderne Mimik würde den Standpunkt der über Darwin hinausgehenden physio-
logischen Psychologie nicht einmal mehr polemisch behandeln, sondern schon durch
ihren Ansatzpunkt hinter sich lassen.
Der Grundgedanke Piderits ist der des Wechselverhältnisses zwischen Seelen-
leben und Sinnestätigkeit. »Mimische Bewegungen werden hervorgerufen durch
seelische Erregungen, jene verhalten sich also zu diesen wie die Wirkungen zu
ihren Ursachen« (49). Das Band zwischen Ursache und Wirkung ist unzerreißbar.
»Es gibt immer nur eine Art und Weise, in welcher sich eine bestimmte Leiden-
schaft oder Stimmung im Gesichte äußert« (46). Daher läßt sich »ein beliebiger
mimischer Ausdruck gleichsam geometrisch konstruieren«, sobald man die Sprache
der Leidenschaften einmal bis zu ihren psychologischen Entstehungsursachen ver-
folgt und eine systematische Einteilung der ihnen entsprechenden mimischen Muskel-
bewegungen gewonnen hat« (44). Jedem inneren Erregungszustande entspricht eine
bestimmte Muskelbewegung, diese läßt sich also konstruieren, wenn jene gegeben
ist. Piderits Leistung besteht wesentlich in der Auffindung des Systems der Muskel-
bewegungen, dessen Kenntnis bei jener Konstruktion vorausgesetzt wird. Es handelt
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. XVII. 6