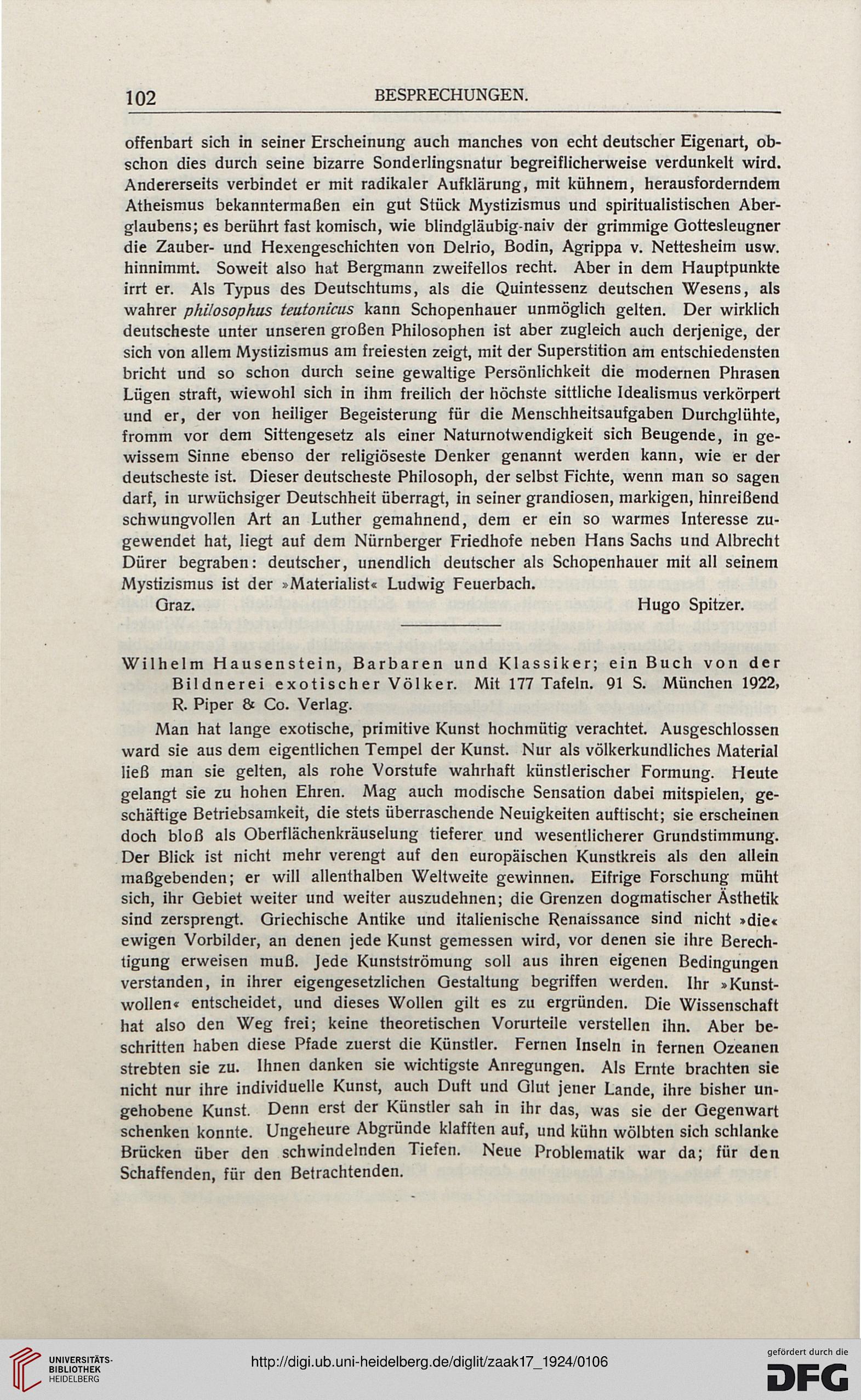102 BESPRECHUNGEN.
offenbart sich in seiner Erscheinung auch manches von echt deutscher Eigenart, ob-
schon dies durch seine bizarre Sonderlingsnatur begreiflicherweise verdunkelt wird.
Andererseits verbindet er mit radikaler Aufklärung, mit kühnem, herausforderndem
Atheismus bekanntermaßen ein gut Stück Mystizismus und spiritualistischen Aber-
glaubens; es berührt fast komisch, wie blindgläubig-naiv der grimmige Gottesleugner
die Zauber- und Hexengeschichten von Delrio, Bodin, Agrippa v. Nettesheim usw.
hinnimmt. Soweit also hat Bergmann zweifellos recht. Aber in dem Hauptpunkte
irrt er. Als Typus des Deutschtums, als die Quintessenz deutschen Wesens, als
wahrer philosophus teutonicus kann Schopenhauer unmöglich gelten. Der wirklich
deutscheste unter unseren großen Philosophen ist aber zugleich auch derjenige, der
sich von allem Mystizismus am freiesten zeigt, mit der Superstition am entschiedensten
bricht und so schon durch seine gewaltige Persönlichkeit die modernen Phrasen
Lügen straft, wiewohl sich in ihm freilich der höchste sittliche Idealismus verkörpert
und er, der von heiliger Begeisterung für die Menschheitsaufgaben Durchglühte,
fromm vor dem Sittengesetz als einer Naturnotwendigkeit sich Beugende, in ge-
wissem Sinne ebenso der religiöseste Denker genannt werden kann, wie er der
deutscheste ist. Dieser deutscheste Philosoph, der selbst Fichte, wenn man so sagen
darf, in urwüchsiger Deutschheit überragt, in seiner grandiosen, markigen, hinreißend
schwungvollen Art an Luther gemahnend, dem er ein so warmes Interesse zu-
gewendet hat, liegt auf dem Nürnberger Friedhofe neben Hans Sachs und Albrecht
Dürer begraben: deutscher, unendlich deutscher als Schopenhauer mit all seinem
Mystizismus ist der »Materialist« Ludwig Feuerbach.
Graz. Hugo Spitzer.
Wilhelm Hausenstein, Barbaren und Klassiker; ein Buch von der
Bildnerei exotischer Völker. Mit 177 Tafeln. 91 S. München 1922,
R. Piper & Co. Verlag.
Man hat lange exotische, primitive Kunst hochmütig verachtet. Ausgeschlossen
ward sie aus dem eigentlichen Tempel der Kunst. Nur als völkerkundliches Material
ließ man sie gelten, als rohe Vorstufe wahrhaft künstlerischer Formung. Heute
gelangt sie zu hohen Ehren. Mag auch modische Sensation dabei mitspielen, ge-
schäftige Betriebsamkeit, die stets überraschende Neuigkeiten auftischt; sie erscheinen
doch bloß als Oberflächenkräuselung tieferer und wesentlicherer Grundstimmung.
Der Blick ist nicht mehr verengt auf den europäischen Kunstkreis als den allein
maßgebenden; er will allenthalben Weltweite gewinnen. Eifrige Forschung müht
sich, ihr Gebiet weiter und weiter auszudehnen; die Grenzen dogmatischer Ästhetik
sind zersprengt. Griechische Antike und italienische Renaissance sind nicht »die«
ewigen Vorbilder, an denen jede Kunst gemessen wird, vor denen sie ihre Berech-
tigung erweisen muß. Jede Kunstströmung soll aus ihren eigenen Bedingungen
verstanden, in ihrer eigengesetzlichen Gestaltung begriffen werden. Ihr »Kunst-
wollen« entscheidet, und dieses Wollen gilt es zu ergründen. Die Wissenschaft
hat also den Weg frei; keine theoretischen Vorurteile verstellen ihn. Aber be-
schritten haben diese Pfade zuerst die Künstler. Fernen Inseln in fernen Ozeanen
strebten sie zu. Ihnen danken sie wichtigste Anregungen. Als Ernte brachten sie
nicht nur ihre individuelle Kunst, auch Duft und Glut jener Lande, ihre bisher un-
gehobene Kunst. Denn erst der Künstler sah in ihr das, was sie der Gegenwart
schenken konnte. Ungeheure Abgründe klafften auf, und kühn wölbten sich schlanke
Brücken über den schwindelnden Tiefen. Neue Problematik war da; für den
Schaffenden, für den Betrachtenden.
offenbart sich in seiner Erscheinung auch manches von echt deutscher Eigenart, ob-
schon dies durch seine bizarre Sonderlingsnatur begreiflicherweise verdunkelt wird.
Andererseits verbindet er mit radikaler Aufklärung, mit kühnem, herausforderndem
Atheismus bekanntermaßen ein gut Stück Mystizismus und spiritualistischen Aber-
glaubens; es berührt fast komisch, wie blindgläubig-naiv der grimmige Gottesleugner
die Zauber- und Hexengeschichten von Delrio, Bodin, Agrippa v. Nettesheim usw.
hinnimmt. Soweit also hat Bergmann zweifellos recht. Aber in dem Hauptpunkte
irrt er. Als Typus des Deutschtums, als die Quintessenz deutschen Wesens, als
wahrer philosophus teutonicus kann Schopenhauer unmöglich gelten. Der wirklich
deutscheste unter unseren großen Philosophen ist aber zugleich auch derjenige, der
sich von allem Mystizismus am freiesten zeigt, mit der Superstition am entschiedensten
bricht und so schon durch seine gewaltige Persönlichkeit die modernen Phrasen
Lügen straft, wiewohl sich in ihm freilich der höchste sittliche Idealismus verkörpert
und er, der von heiliger Begeisterung für die Menschheitsaufgaben Durchglühte,
fromm vor dem Sittengesetz als einer Naturnotwendigkeit sich Beugende, in ge-
wissem Sinne ebenso der religiöseste Denker genannt werden kann, wie er der
deutscheste ist. Dieser deutscheste Philosoph, der selbst Fichte, wenn man so sagen
darf, in urwüchsiger Deutschheit überragt, in seiner grandiosen, markigen, hinreißend
schwungvollen Art an Luther gemahnend, dem er ein so warmes Interesse zu-
gewendet hat, liegt auf dem Nürnberger Friedhofe neben Hans Sachs und Albrecht
Dürer begraben: deutscher, unendlich deutscher als Schopenhauer mit all seinem
Mystizismus ist der »Materialist« Ludwig Feuerbach.
Graz. Hugo Spitzer.
Wilhelm Hausenstein, Barbaren und Klassiker; ein Buch von der
Bildnerei exotischer Völker. Mit 177 Tafeln. 91 S. München 1922,
R. Piper & Co. Verlag.
Man hat lange exotische, primitive Kunst hochmütig verachtet. Ausgeschlossen
ward sie aus dem eigentlichen Tempel der Kunst. Nur als völkerkundliches Material
ließ man sie gelten, als rohe Vorstufe wahrhaft künstlerischer Formung. Heute
gelangt sie zu hohen Ehren. Mag auch modische Sensation dabei mitspielen, ge-
schäftige Betriebsamkeit, die stets überraschende Neuigkeiten auftischt; sie erscheinen
doch bloß als Oberflächenkräuselung tieferer und wesentlicherer Grundstimmung.
Der Blick ist nicht mehr verengt auf den europäischen Kunstkreis als den allein
maßgebenden; er will allenthalben Weltweite gewinnen. Eifrige Forschung müht
sich, ihr Gebiet weiter und weiter auszudehnen; die Grenzen dogmatischer Ästhetik
sind zersprengt. Griechische Antike und italienische Renaissance sind nicht »die«
ewigen Vorbilder, an denen jede Kunst gemessen wird, vor denen sie ihre Berech-
tigung erweisen muß. Jede Kunstströmung soll aus ihren eigenen Bedingungen
verstanden, in ihrer eigengesetzlichen Gestaltung begriffen werden. Ihr »Kunst-
wollen« entscheidet, und dieses Wollen gilt es zu ergründen. Die Wissenschaft
hat also den Weg frei; keine theoretischen Vorurteile verstellen ihn. Aber be-
schritten haben diese Pfade zuerst die Künstler. Fernen Inseln in fernen Ozeanen
strebten sie zu. Ihnen danken sie wichtigste Anregungen. Als Ernte brachten sie
nicht nur ihre individuelle Kunst, auch Duft und Glut jener Lande, ihre bisher un-
gehobene Kunst. Denn erst der Künstler sah in ihr das, was sie der Gegenwart
schenken konnte. Ungeheure Abgründe klafften auf, und kühn wölbten sich schlanke
Brücken über den schwindelnden Tiefen. Neue Problematik war da; für den
Schaffenden, für den Betrachtenden.