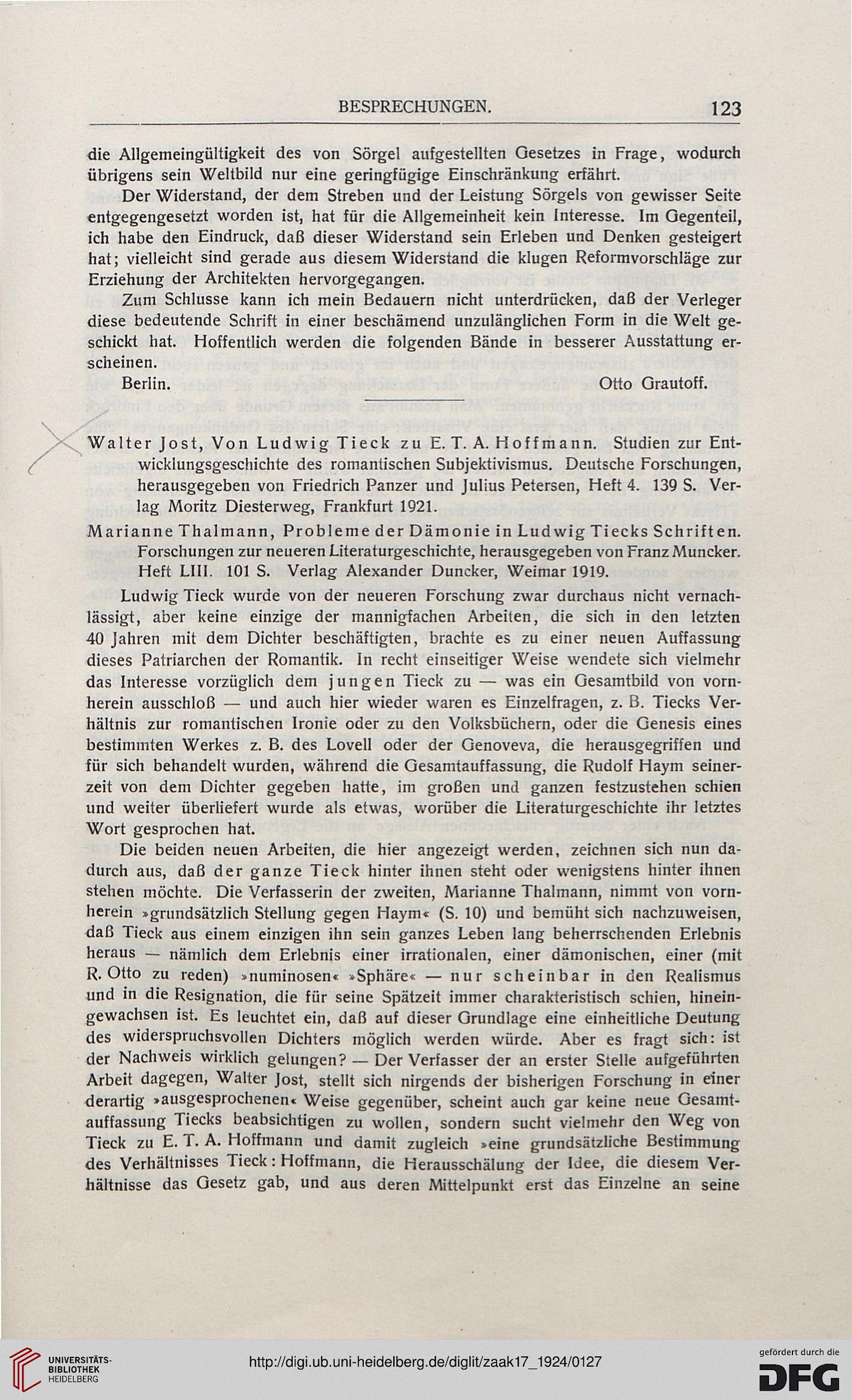BESPRECHUNGEN. 123
die Allgemeingültigkeit des von Sörgel aufgestellten Gesetzes in Frage, wodurch
übrigens sein Weltbild nur eine geringfügige Einschränkung erfährt.
Der Widerstand, der dem Streben und der Leistung Sörgels von gewisser Seite
entgegengesetzt worden ist, hat für die Allgemeinheit kein Interesse. Im Gegenteil,
ich habe den Eindruck, daß dieser Widerstand sein Erleben und Denken gesteigert
hat; vielleicht sind gerade aus diesem Widerstand die klugen Reformvorschläge zur
Erziehung der Architekten hervorgegangen.
Zum Schlüsse kann ich mein Bedauern nicht unterdrücken, daß der Verleger
diese bedeutende Schrift in einer beschämend unzulänglichen Form in die Welt ge-
schickt hat. Hoffentlich werden die folgenden Bände in besserer Ausstattung er-
scheinen.
Berlin. Otto Grautoff.
Walter Jost, Von Ludwig Tieck zu E. T. A. Hoff mann. Studien zur Ent-
wicklungsgeschichte des romantischen Subjektivismus. Deutsche Forschungen,
herausgegeben von Friedrich Panzer und Julius Petersen, Heft 4. 139 S. Ver-
lag Moritz Diesterweg, Frankfurt 1921.
Marianne Thalmann, Probleme der Dämonie in Ludwig Tiecks Schriften.
Forschungen zur neueren Literaturgeschichte, herausgegeben von Franz Muncker.
Heft Uli. 101 S. Verlag Alexander Duncker, Weimar 1919.
Ludwig Tieck wurde von der neueren Forschung zwar durchaus nicht vernach-
lässigt, aber keine einzige der mannigfachen Arbeiten, die sich in den letzten
40 Jahren mit dem Dichter beschäftigten, brachte es zu einer neuen Auffassung
dieses Patriarchen der Romantik. In recht einseitiger Weise wendete sich vielmehr
das Interesse vorzüglich dem jungen Tieck zu — was ein Gesamtbild von vorn-
herein ausschloß — und auch hier wieder waren es Einzelfragen, z. B. Tiecks Ver-
hältnis zur romantischen Ironie oder zu den Volksbüchern, oder die Genesis eines
bestimmten Werkes z. B. des Lovell oder der Genoveva, die herausgegriffen und
für sich behandelt wurden, während die Gesamtauffassung, die Rudolf Haym seiner-
zeit von dem Dichter gegeben hatte, im großen und ganzen festzustehen schien
und weiter überliefert wurde als etwas, worüber die Literaturgeschichte ihr letztes
Wort gesprochen hat.
Die beiden neuen Arbeiten, die hier angezeigt werden, zeichnen sich nun da-
durch aus, daß der ganze Tieck hinter ihnen steht oder wenigstens hinter ihnen
stehen möchte. Die Verfasserin der zweiten, Marianne Thalmann, nimmt von vorn-
herein »grundsätzlich Stellung gegen Haym« (S. 10) und bemüht sich nachzuweisen,
daß Tieck aus einem einzigen ihn sein ganzes Leben lang beherrschenden Erlebnis
heraus — nämlich dem Erlebnis einer irrationalen, einer dämonischen, einer (mit
R.Otto zu reden) »numinosen« »Sphäre« — nur scheinbar in den Realismus
und in die Resignation, die für seine Spätzeit immer charakteristisch schien, hinein-
gewachsen ist. Es leuchtet ein, daß auf dieser Grundlage eine einheitliche Deutung
des widerspruchsvollen Dichters möglich werden würde. Aber es fragt sich: ist
der Nachweis wirklich gelungen? — Der Verfasser der an erster Stelle aufgeführten
Arbeit dagegen, Walter Jost, stellt sich nirgends der bisherigen Forschung in einer
derartig »ausgesprochenen« Weise gegenüber, scheint auch gar keine neue Gesamt-
auffassung Tiecks beabsichtigen zu wollen, sondern sucht vielmehr den Weg von
Tieck zu E. T. A. Hoffmann und damit zugleich »eine grundsätzliche Bestimmung
des Verhältnisses Tieck: Hoffmann, die Herausschälung der Idee, die diesem Ver-
hältnisse das Gesetz gab, und aus deren Mittelpunkt erst das Einzelne an seine
die Allgemeingültigkeit des von Sörgel aufgestellten Gesetzes in Frage, wodurch
übrigens sein Weltbild nur eine geringfügige Einschränkung erfährt.
Der Widerstand, der dem Streben und der Leistung Sörgels von gewisser Seite
entgegengesetzt worden ist, hat für die Allgemeinheit kein Interesse. Im Gegenteil,
ich habe den Eindruck, daß dieser Widerstand sein Erleben und Denken gesteigert
hat; vielleicht sind gerade aus diesem Widerstand die klugen Reformvorschläge zur
Erziehung der Architekten hervorgegangen.
Zum Schlüsse kann ich mein Bedauern nicht unterdrücken, daß der Verleger
diese bedeutende Schrift in einer beschämend unzulänglichen Form in die Welt ge-
schickt hat. Hoffentlich werden die folgenden Bände in besserer Ausstattung er-
scheinen.
Berlin. Otto Grautoff.
Walter Jost, Von Ludwig Tieck zu E. T. A. Hoff mann. Studien zur Ent-
wicklungsgeschichte des romantischen Subjektivismus. Deutsche Forschungen,
herausgegeben von Friedrich Panzer und Julius Petersen, Heft 4. 139 S. Ver-
lag Moritz Diesterweg, Frankfurt 1921.
Marianne Thalmann, Probleme der Dämonie in Ludwig Tiecks Schriften.
Forschungen zur neueren Literaturgeschichte, herausgegeben von Franz Muncker.
Heft Uli. 101 S. Verlag Alexander Duncker, Weimar 1919.
Ludwig Tieck wurde von der neueren Forschung zwar durchaus nicht vernach-
lässigt, aber keine einzige der mannigfachen Arbeiten, die sich in den letzten
40 Jahren mit dem Dichter beschäftigten, brachte es zu einer neuen Auffassung
dieses Patriarchen der Romantik. In recht einseitiger Weise wendete sich vielmehr
das Interesse vorzüglich dem jungen Tieck zu — was ein Gesamtbild von vorn-
herein ausschloß — und auch hier wieder waren es Einzelfragen, z. B. Tiecks Ver-
hältnis zur romantischen Ironie oder zu den Volksbüchern, oder die Genesis eines
bestimmten Werkes z. B. des Lovell oder der Genoveva, die herausgegriffen und
für sich behandelt wurden, während die Gesamtauffassung, die Rudolf Haym seiner-
zeit von dem Dichter gegeben hatte, im großen und ganzen festzustehen schien
und weiter überliefert wurde als etwas, worüber die Literaturgeschichte ihr letztes
Wort gesprochen hat.
Die beiden neuen Arbeiten, die hier angezeigt werden, zeichnen sich nun da-
durch aus, daß der ganze Tieck hinter ihnen steht oder wenigstens hinter ihnen
stehen möchte. Die Verfasserin der zweiten, Marianne Thalmann, nimmt von vorn-
herein »grundsätzlich Stellung gegen Haym« (S. 10) und bemüht sich nachzuweisen,
daß Tieck aus einem einzigen ihn sein ganzes Leben lang beherrschenden Erlebnis
heraus — nämlich dem Erlebnis einer irrationalen, einer dämonischen, einer (mit
R.Otto zu reden) »numinosen« »Sphäre« — nur scheinbar in den Realismus
und in die Resignation, die für seine Spätzeit immer charakteristisch schien, hinein-
gewachsen ist. Es leuchtet ein, daß auf dieser Grundlage eine einheitliche Deutung
des widerspruchsvollen Dichters möglich werden würde. Aber es fragt sich: ist
der Nachweis wirklich gelungen? — Der Verfasser der an erster Stelle aufgeführten
Arbeit dagegen, Walter Jost, stellt sich nirgends der bisherigen Forschung in einer
derartig »ausgesprochenen« Weise gegenüber, scheint auch gar keine neue Gesamt-
auffassung Tiecks beabsichtigen zu wollen, sondern sucht vielmehr den Weg von
Tieck zu E. T. A. Hoffmann und damit zugleich »eine grundsätzliche Bestimmung
des Verhältnisses Tieck: Hoffmann, die Herausschälung der Idee, die diesem Ver-
hältnisse das Gesetz gab, und aus deren Mittelpunkt erst das Einzelne an seine