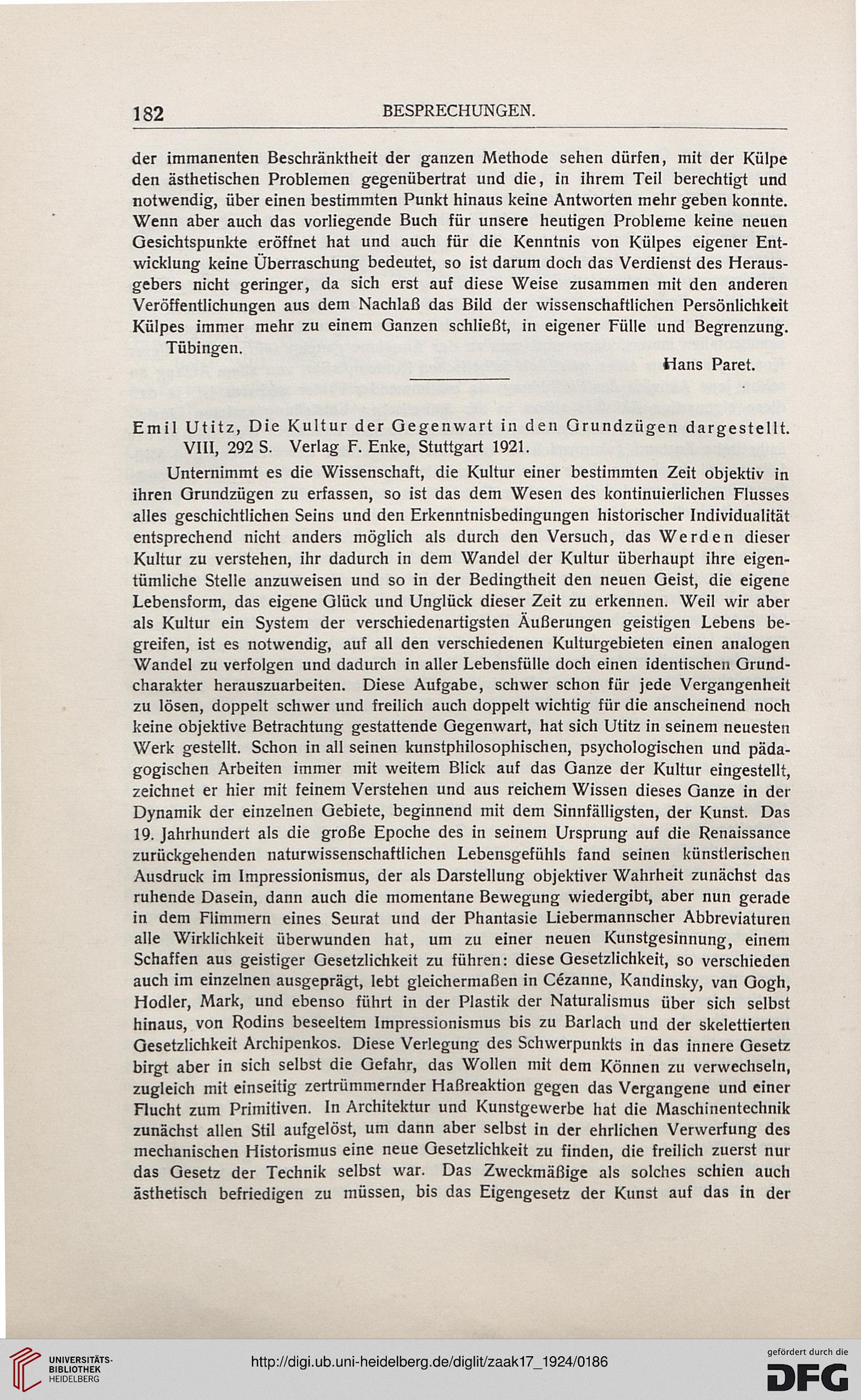182 BESPRECHUNGEN.
der immanenten Beschränktheit der ganzen Methode sehen dürfen, mit der Külpe
den ästhetischen Problemen gegenübertrat und die, in ihrem Teil berechtigt und
notwendig, über einen bestimmten Punkt hinaus keine Antworten mehr geben konnte.
Wenn aber auch das vorliegende Buch für unsere heutigen Probleme keine neuen
Gesichtspunkte eröffnet hat und auch für die Kenntnis von Külpes eigener Ent-
wicklung keine Überraschung bedeutet, so ist darum doch das Verdienst des Heraus-
gebers nicht geringer, da sich erst auf diese Weise zusammen mit den anderen
Veröffentlichungen aus dem Nachlaß das Bild der wissenschaftlichen Persönlichkeit
Külpes immer mehr zu einem Ganzen schließt, in eigener Fülle und Begrenzung.
Tübingen.
Hans Paret.
Emil Utitz, Die Kultur der Gegenwart in den Grundzügen dargestellt.
VIII, 292 S. Verlag F. Enke, Stuttgart 1921.
Unternimmt es die Wissenschaft, die Kultur einer bestimmten Zeit objektiv in
ihren Grundzügen zu erfassen, so ist das dem Wesen des kontinuierlichen Flusses
alles geschichtlichen Seins und den Erkenntnisbedingungen historischer Individualität
entsprechend nicht anders möglich als durch den Versuch, das Werden dieser
Kultur zu verstehen, ihr dadurch in dem Wandel der Kultur überhaupt ihre eigen-
tümliche Stelle anzuweisen und so in der Bedingtheit den neuen Geist, die eigene
Lebensform, das eigene Glück und Unglück dieser Zeit zu erkennen. Weil wir aber
als Kultur ein System der verschiedenartigsten Äußerungen geistigen Lebens be-
greifen, ist es notwendig, auf all den verschiedenen Kulturgebieten einen analogen
Wandel zu verfolgen und dadurch in aller Lebensfülle doch einen identischen Grund-
charakter herauszuarbeiten. Diese Aufgabe, schwer schon für jede Vergangenheit
zu lösen, doppelt schwer und freilich auch doppelt wichtig für die anscheinend noch
keine objektive Betrachtung gestattende Gegenwart, hat sich Utitz in seinem neuesten
Werk gestellt. Schon in all seinen kunstphilosophischen, psychologischen und päda-
gogischen Arbeiten immer mit weitem Blick auf das Ganze der Kultur eingestellt,
zeichnet er hier mit feinem Verstehen und aus reichem Wissen dieses Ganze in der
Dynamik der einzelnen Gebiete, beginnend mit dem Sinnfälligsten, der Kunst. Das
19. Jahrhundert als die große Epoche des in seinem Ursprung auf die Renaissance
zurückgehenden naturwissenschaftlichen Lebensgefühls fand seinen künstlerischen
Ausdruck im Impressionismus, der als Darstellung objektiver Wahrheit zunächst das
ruhende Dasein, dann auch die momentane Bewegung wiedergibt, aber nun gerade
in dem Flimmern eines Seurat und der Phantasie Liebermannscher Abbreviaturen
alle Wirklichkeit überwunden hat, um zu einer neuen Kunstgesinnung, einem
Schaffen aus geistiger Gesetzlichkeit zu führen: diese Gesetzlichkeit, so verschieden
auch im einzelnen ausgeprägt, lebt gleichermaßen in Cezanne, Kandinsky, van Gogh,
Hodler, Mark, und ebenso führt in der Plastik der Naturalismus über sich selbst
hinaus, von Rodins beseeltem Impressionismus bis zu Barlach und der skelettierten
Gesetzlichkeit Archipenkos. Diese Verlegung des Schwerpunkts in das innere Gesetz
birgt aber in sich selbst die Gefahr, das Wollen mit dem Können zu verwechseln,
zugleich mit einseitig zertrümmernder Haßreaktion gegen das Vergangene und einer
Flucht zum Primitiven. In Architektur und Kunstgewerbe hat die Maschinentechnik
zunächst allen Stil aufgelöst, um dann aber selbst in der ehrlichen Verwerfung des
mechanischen Historismus eine neue Gesetzlichkeit zu finden, die freilich zuerst nur
das Gesetz der Technik selbst war. Das Zweckmäßige als solches schien auch
ästhetisch befriedigen zu müssen, bis das Eigengesetz der Kunst auf das in der
der immanenten Beschränktheit der ganzen Methode sehen dürfen, mit der Külpe
den ästhetischen Problemen gegenübertrat und die, in ihrem Teil berechtigt und
notwendig, über einen bestimmten Punkt hinaus keine Antworten mehr geben konnte.
Wenn aber auch das vorliegende Buch für unsere heutigen Probleme keine neuen
Gesichtspunkte eröffnet hat und auch für die Kenntnis von Külpes eigener Ent-
wicklung keine Überraschung bedeutet, so ist darum doch das Verdienst des Heraus-
gebers nicht geringer, da sich erst auf diese Weise zusammen mit den anderen
Veröffentlichungen aus dem Nachlaß das Bild der wissenschaftlichen Persönlichkeit
Külpes immer mehr zu einem Ganzen schließt, in eigener Fülle und Begrenzung.
Tübingen.
Hans Paret.
Emil Utitz, Die Kultur der Gegenwart in den Grundzügen dargestellt.
VIII, 292 S. Verlag F. Enke, Stuttgart 1921.
Unternimmt es die Wissenschaft, die Kultur einer bestimmten Zeit objektiv in
ihren Grundzügen zu erfassen, so ist das dem Wesen des kontinuierlichen Flusses
alles geschichtlichen Seins und den Erkenntnisbedingungen historischer Individualität
entsprechend nicht anders möglich als durch den Versuch, das Werden dieser
Kultur zu verstehen, ihr dadurch in dem Wandel der Kultur überhaupt ihre eigen-
tümliche Stelle anzuweisen und so in der Bedingtheit den neuen Geist, die eigene
Lebensform, das eigene Glück und Unglück dieser Zeit zu erkennen. Weil wir aber
als Kultur ein System der verschiedenartigsten Äußerungen geistigen Lebens be-
greifen, ist es notwendig, auf all den verschiedenen Kulturgebieten einen analogen
Wandel zu verfolgen und dadurch in aller Lebensfülle doch einen identischen Grund-
charakter herauszuarbeiten. Diese Aufgabe, schwer schon für jede Vergangenheit
zu lösen, doppelt schwer und freilich auch doppelt wichtig für die anscheinend noch
keine objektive Betrachtung gestattende Gegenwart, hat sich Utitz in seinem neuesten
Werk gestellt. Schon in all seinen kunstphilosophischen, psychologischen und päda-
gogischen Arbeiten immer mit weitem Blick auf das Ganze der Kultur eingestellt,
zeichnet er hier mit feinem Verstehen und aus reichem Wissen dieses Ganze in der
Dynamik der einzelnen Gebiete, beginnend mit dem Sinnfälligsten, der Kunst. Das
19. Jahrhundert als die große Epoche des in seinem Ursprung auf die Renaissance
zurückgehenden naturwissenschaftlichen Lebensgefühls fand seinen künstlerischen
Ausdruck im Impressionismus, der als Darstellung objektiver Wahrheit zunächst das
ruhende Dasein, dann auch die momentane Bewegung wiedergibt, aber nun gerade
in dem Flimmern eines Seurat und der Phantasie Liebermannscher Abbreviaturen
alle Wirklichkeit überwunden hat, um zu einer neuen Kunstgesinnung, einem
Schaffen aus geistiger Gesetzlichkeit zu führen: diese Gesetzlichkeit, so verschieden
auch im einzelnen ausgeprägt, lebt gleichermaßen in Cezanne, Kandinsky, van Gogh,
Hodler, Mark, und ebenso führt in der Plastik der Naturalismus über sich selbst
hinaus, von Rodins beseeltem Impressionismus bis zu Barlach und der skelettierten
Gesetzlichkeit Archipenkos. Diese Verlegung des Schwerpunkts in das innere Gesetz
birgt aber in sich selbst die Gefahr, das Wollen mit dem Können zu verwechseln,
zugleich mit einseitig zertrümmernder Haßreaktion gegen das Vergangene und einer
Flucht zum Primitiven. In Architektur und Kunstgewerbe hat die Maschinentechnik
zunächst allen Stil aufgelöst, um dann aber selbst in der ehrlichen Verwerfung des
mechanischen Historismus eine neue Gesetzlichkeit zu finden, die freilich zuerst nur
das Gesetz der Technik selbst war. Das Zweckmäßige als solches schien auch
ästhetisch befriedigen zu müssen, bis das Eigengesetz der Kunst auf das in der