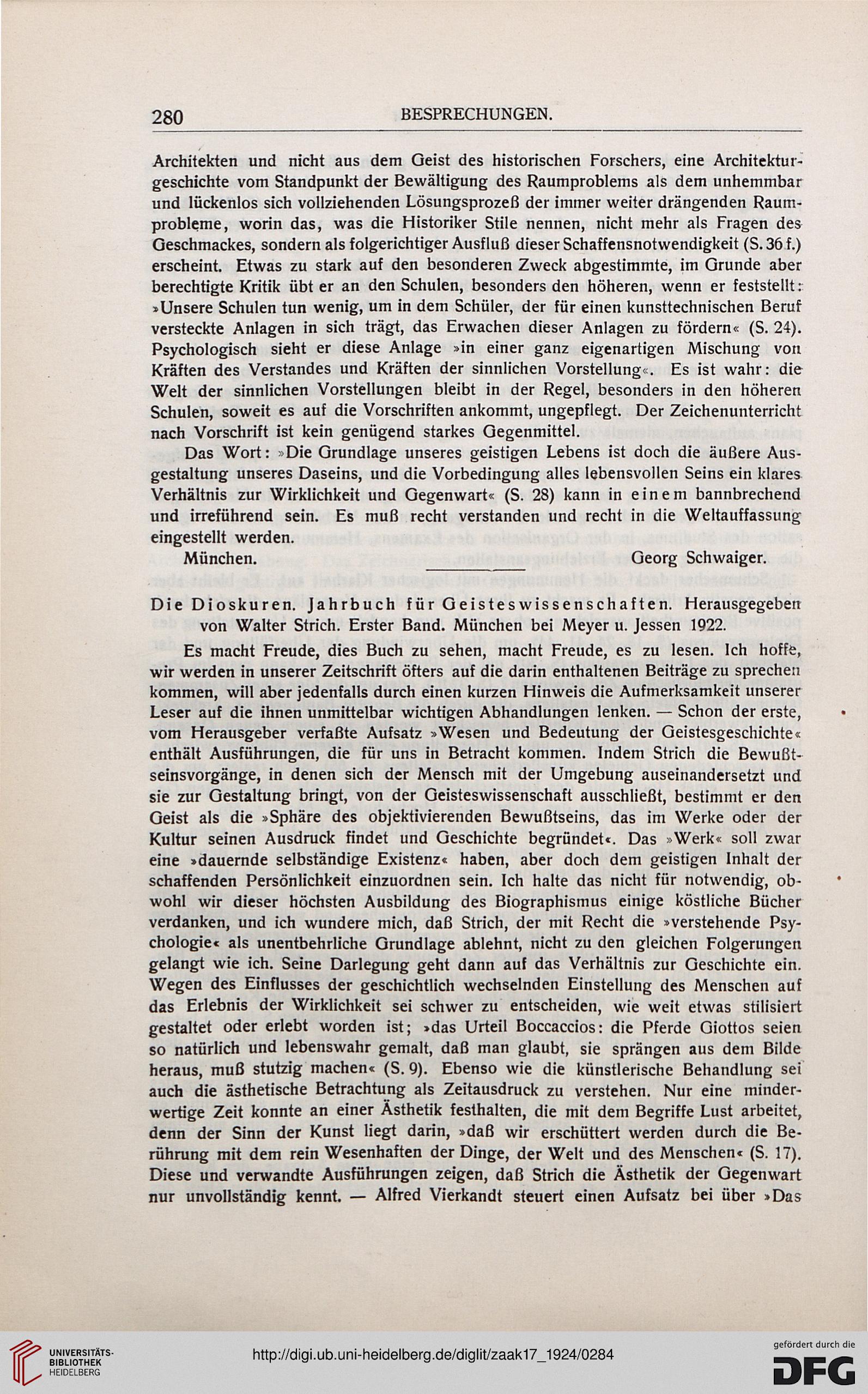280 BESPRECHUNGEN.
Architekten und nicht aus dem Geist des historischen Forschers, eine Architektur-
geschichte vom Standpunkt der Bewältigung des Raumproblems als dem unhemmbar
und lückenlos sich vollziehenden Lösungsprozeß der immer weiter drängenden Raum-
probleme, worin das, was die Historiker Stile nennen, nicht mehr als Fragen des
Geschmackes, sondern als folgerichtiger Ausfluß dieser Schaffensnotwendigkeit (S. 36 f.)
erscheint. Etwas zu stark auf den besonderen Zweck abgestimmte, im Grunde aber
berechtigte Kritik übt er an den Schulen, besonders den höheren, wenn er feststellt:
»Unsere Schulen tun wenig, um in dem Schüler, der für einen kunsttechnischen Beruf
versteckte Anlagen in sich trägt, das Erwachen dieser Anlagen zu fördern« (S. 24).
Psychologisch sieht er diese Anlage »in einer ganz eigenartigen Mischung von
Kräften des Verstandes und Kräften der sinnlichen Vorstellung«. Es ist wahr: die
Welt der sinnlichen Vorstellungen bleibt in der Regel, besonders in den höheren
Schulen, soweit es auf die Vorschriften ankommt, ungepflegt. Der Zeichenunterricht
nach Vorschrift ist kein genügend starkes Gegenmittel.
Das Wort: »Die Grundlage unseres geistigen Lebens ist doch die äußere Aus-
gestaltung unseres Daseins, und die Vorbedingung alles lebensvollen Seins ein klares
Verhältnis zur Wirklichkeit und Gegenwart« (S. 28) kann in einem bannbrechend
und irreführend sein. Es muß recht verstanden und recht in die Weltauffassung
eingestellt werden.
München. Georg Schwaiger.
Die Dioskuren. Jahrbuch für Geisteswissenschaften. Herausgegeben
von Walter Strich. Erster Band. München bei Meyer u. Jessen 1922.
Es macht Freude, dies Buch zu sehen, macht Freude, es zu lesen. Ich hoffe,
wir werden in unserer Zeitschrift öfters auf die darin enthaltenen Beiträge zu sprechen
kommen, will aber jedenfalls durch einen kurzen Hinweis die Aufmerksamkeit unserer
Leser auf die ihnen unmittelbar wichtigen Abhandlungen lenken. — Schon der erste,
vom Herausgeber verfaßte Aufsatz »Wesen und Bedeutung der Geistesgeschichte«
enthält Ausführungen, die für uns in Betracht kommen. Indem Strich die Bewußt-
seinsvorgänge, in denen sich der Mensch mit der Umgebung auseinandersetzt und
sie zur Gestaltung bringt, von der Geisteswissenschaft ausschließt, bestimmt er den
Geist als die »Sphäre des objektivierenden Bewußtseins, das im Werke oder der
Kultur seinen Ausdruck findet und Geschichte begründet«. Das »Werk« soll zwar
eine »dauernde selbständige Existenz« haben, aber doch dem geistigen Inhalt der
schaffenden Persönlichkeit einzuordnen sein. Ich halte das nicht für notwendig, ob-
wohl wir dieser höchsten Ausbildung des Biographismus einige köstliche Bücher
verdanken, und ich wundere mich, daß Strich, der mit Recht die »verstehende Psy-
chologie« als unentbehrliche Grundlage ablehnt, nicht zu den gleichen Folgerungen
gelangt wie ich. Seine Darlegung geht dann auf das Verhältnis zur Geschichte ein.
Wegen des Einflusses der geschichtlich wechselnden Einstellung des Menschen auf
das Erlebnis der Wirklichkeit sei schwer zu entscheiden, wie weit etwas stilisiert
gestaltet oder erlebt worden ist; »das Urteil Boccaccios: die Pferde Giottos seien
so natürlich und lebenswahr gemalt, daß man glaubt, sie sprängen aus dem Bilde
heraus, muß stutzig machen« (S. 9). Ebenso wie die künstlerische Behandlung sei
auch die ästhetische Betrachtung als Zeitausdruck zu verstehen. Nur eine minder-
wertige Zeit konnte an einer Ästhetik festhalten, die mit dem Begriffe Lust arbeitet,
denn der Sinn der Kunst liegt darin, »daß wir erschüttert werden durch die Be-
rührung mit dem rein Wesenhaften der Dinge, der Welt und des Menschen« (S. 17).
Diese und verwandte Ausführungen zeigen, daß Strich die Ästhetik der Gegenwart
nur unvollständig kennt. — Alfred Vierkandt steuert einen Aufsatz bei über »Das
Architekten und nicht aus dem Geist des historischen Forschers, eine Architektur-
geschichte vom Standpunkt der Bewältigung des Raumproblems als dem unhemmbar
und lückenlos sich vollziehenden Lösungsprozeß der immer weiter drängenden Raum-
probleme, worin das, was die Historiker Stile nennen, nicht mehr als Fragen des
Geschmackes, sondern als folgerichtiger Ausfluß dieser Schaffensnotwendigkeit (S. 36 f.)
erscheint. Etwas zu stark auf den besonderen Zweck abgestimmte, im Grunde aber
berechtigte Kritik übt er an den Schulen, besonders den höheren, wenn er feststellt:
»Unsere Schulen tun wenig, um in dem Schüler, der für einen kunsttechnischen Beruf
versteckte Anlagen in sich trägt, das Erwachen dieser Anlagen zu fördern« (S. 24).
Psychologisch sieht er diese Anlage »in einer ganz eigenartigen Mischung von
Kräften des Verstandes und Kräften der sinnlichen Vorstellung«. Es ist wahr: die
Welt der sinnlichen Vorstellungen bleibt in der Regel, besonders in den höheren
Schulen, soweit es auf die Vorschriften ankommt, ungepflegt. Der Zeichenunterricht
nach Vorschrift ist kein genügend starkes Gegenmittel.
Das Wort: »Die Grundlage unseres geistigen Lebens ist doch die äußere Aus-
gestaltung unseres Daseins, und die Vorbedingung alles lebensvollen Seins ein klares
Verhältnis zur Wirklichkeit und Gegenwart« (S. 28) kann in einem bannbrechend
und irreführend sein. Es muß recht verstanden und recht in die Weltauffassung
eingestellt werden.
München. Georg Schwaiger.
Die Dioskuren. Jahrbuch für Geisteswissenschaften. Herausgegeben
von Walter Strich. Erster Band. München bei Meyer u. Jessen 1922.
Es macht Freude, dies Buch zu sehen, macht Freude, es zu lesen. Ich hoffe,
wir werden in unserer Zeitschrift öfters auf die darin enthaltenen Beiträge zu sprechen
kommen, will aber jedenfalls durch einen kurzen Hinweis die Aufmerksamkeit unserer
Leser auf die ihnen unmittelbar wichtigen Abhandlungen lenken. — Schon der erste,
vom Herausgeber verfaßte Aufsatz »Wesen und Bedeutung der Geistesgeschichte«
enthält Ausführungen, die für uns in Betracht kommen. Indem Strich die Bewußt-
seinsvorgänge, in denen sich der Mensch mit der Umgebung auseinandersetzt und
sie zur Gestaltung bringt, von der Geisteswissenschaft ausschließt, bestimmt er den
Geist als die »Sphäre des objektivierenden Bewußtseins, das im Werke oder der
Kultur seinen Ausdruck findet und Geschichte begründet«. Das »Werk« soll zwar
eine »dauernde selbständige Existenz« haben, aber doch dem geistigen Inhalt der
schaffenden Persönlichkeit einzuordnen sein. Ich halte das nicht für notwendig, ob-
wohl wir dieser höchsten Ausbildung des Biographismus einige köstliche Bücher
verdanken, und ich wundere mich, daß Strich, der mit Recht die »verstehende Psy-
chologie« als unentbehrliche Grundlage ablehnt, nicht zu den gleichen Folgerungen
gelangt wie ich. Seine Darlegung geht dann auf das Verhältnis zur Geschichte ein.
Wegen des Einflusses der geschichtlich wechselnden Einstellung des Menschen auf
das Erlebnis der Wirklichkeit sei schwer zu entscheiden, wie weit etwas stilisiert
gestaltet oder erlebt worden ist; »das Urteil Boccaccios: die Pferde Giottos seien
so natürlich und lebenswahr gemalt, daß man glaubt, sie sprängen aus dem Bilde
heraus, muß stutzig machen« (S. 9). Ebenso wie die künstlerische Behandlung sei
auch die ästhetische Betrachtung als Zeitausdruck zu verstehen. Nur eine minder-
wertige Zeit konnte an einer Ästhetik festhalten, die mit dem Begriffe Lust arbeitet,
denn der Sinn der Kunst liegt darin, »daß wir erschüttert werden durch die Be-
rührung mit dem rein Wesenhaften der Dinge, der Welt und des Menschen« (S. 17).
Diese und verwandte Ausführungen zeigen, daß Strich die Ästhetik der Gegenwart
nur unvollständig kennt. — Alfred Vierkandt steuert einen Aufsatz bei über »Das