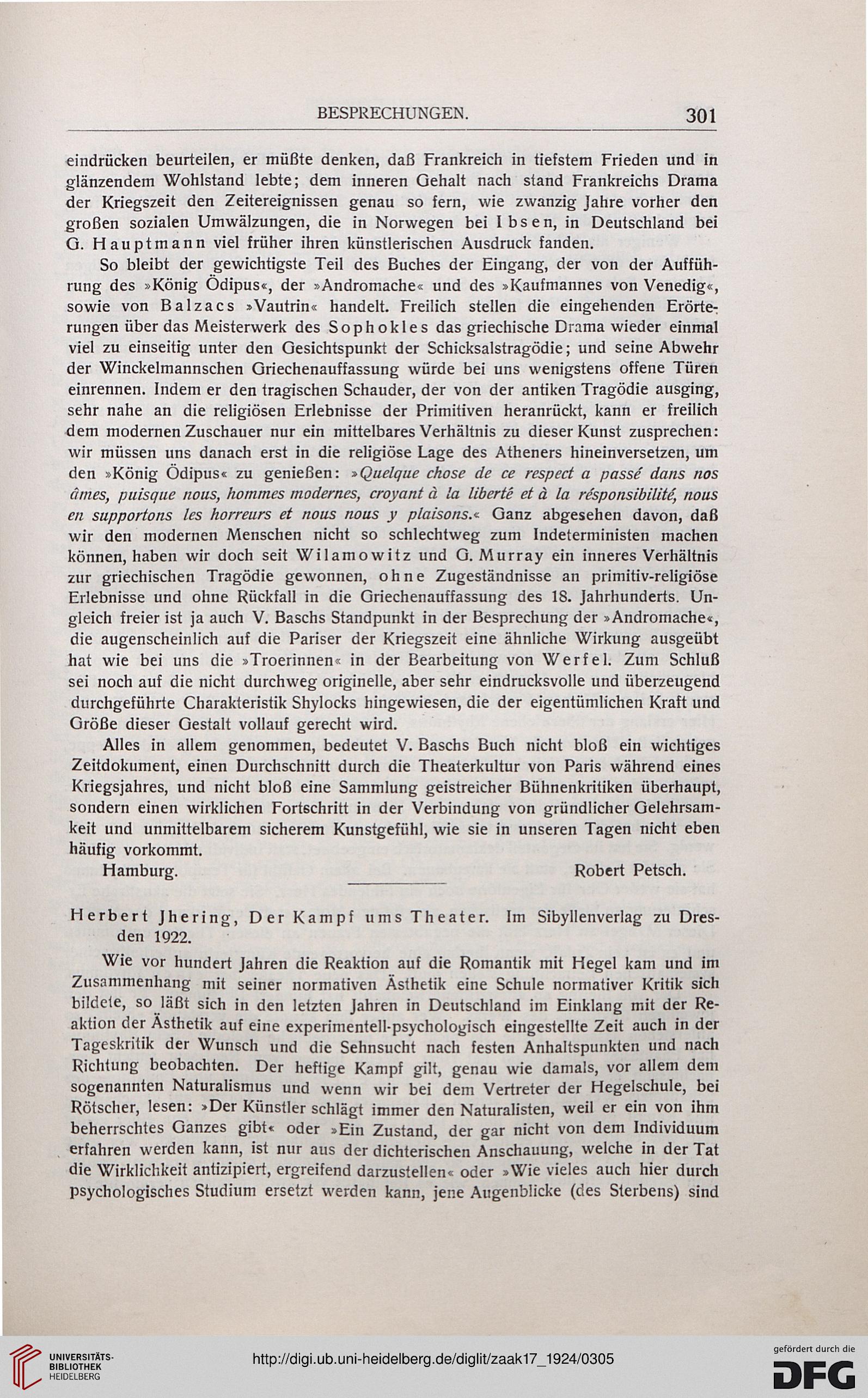BESPRECHUNGEN. 301
eindrücken beurteilen, er müßte denken, daß Frankreich in tiefstem Frieden und in
glänzendem Wohlstand lebte; dem inneren Gehalt nach stand Frankreichs Drama
der Kriegszeit den Zeitereignissen genau so fern, wie zwanzig Jahre vorher den
großen sozialen Umwälzungen, die in Norwegen bei Ibsen, in Deutschland bei
G. Hauptmann viel früher ihren künstlerischen Ausdruck fanden.
So bleibt der gewichtigste Teil des Buches der Eingang, der von der Auffüh-
rung des »König Ödipus«, der »Andromache« und des »Kaufmannes von Venedig«,
sowie von Balzacs »Vautrin« handelt. Freilich stellen die eingehenden Erörte-:
rungen über das Meisterwerk des Sophokles das griechische Drama wieder einmal
viel zu einseitig unter den Gesichtspunkt der Schicksalstragödie; und seine Abwehr
der Winckelmannschen Griechenauffassung würde bei uns wenigstens offene Türen
einrennen. Indem er den tragischen Schauder, der von der antiken Tragödie ausging,
sehr nahe an die religiösen Erlebnisse der Primitiven heranrückt, kann er freilich
dem modernen Zuschauer nur ein mittelbares Verhältnis zu dieser Kunst zusprechen:
wir müssen uns danach erst in die religiöse Lage des Atheners hineinversetzen, um
den »König Ödipus« zu genießen: »Quelque chose de ce respect a passe dans nos
cimes, puisque nous, hommes modernes, croyant ä la liberte et ä la responsibilite, nous
en supportons les horreurs et nous nous y plaisons.^ Ganz abgesehen davon, daß
wir den modernen Menschen nicht so schlechtweg zum Indeterministen machen
können, haben wir doch seit Wilamowitz und G. Murray ein inneres Verhältnis
zur griechischen Tragödie gewonnen, ohne Zugeständnisse an primitiv-religiöse
Erlebnisse und ohne Rückfall in die Griechenauffassung des 18. Jahrhunderts. Un-
gleich freier ist ja auch V. Baschs Standpunkt in der Besprechung der »Andromache«,
die augenscheinlich auf die Pariser der Kriegszeit eine ähnliche Wirkung ausgeübt
hat wie bei uns die »Troerinnen« in der Bearbeitung von Wer fei. Zum Schluß
sei noch auf die nicht durchweg originelle, aber sehr eindrucksvolle und überzeugend
durchgeführte Charakteristik Shylocks hingewiesen, die der eigentümlichen Kraft und
Größe dieser Gestalt vollauf gerecht wird.
Alles in allem genommen, bedeutet V. Baschs Buch nicht bloß ein wichtiges
Zeitdokument, einen Durchschnitt durch die Theaterkultur von Paris während eines
Kriegsjahres, und nicht bloß eine Sammlung geistreicher Bühnenkritiken überhaupt,
sondern einen wirklichen Fortschritt in der Verbindung von gründlicher Gelehrsam-
keit und unmittelbarem sicherem Kunstgefühl, wie sie in unseren Tagen nicht eben
häufig vorkommt.
Hamburg. Robert Petsch.
Herbert Jhering, Der Kampf ums Theater. Im Sibyllenverlag zu Dres-
den 1922.
Wie vor hundert Jahren die Reaktion auf die Romantik mit Hegel kam und im
Zusammenhang mit seiner normativen Ästhetik eine Schule normativer Kritik sich
bildete, so läßt sich in den letzten Jahren in Deutschland im Einklang mit der Re-
aktion der Ästhetik auf eine experimentell-psychologisch eingestellte Zeit auch in der
Tageskritik der Wunsch und die Sehnsucht nach festen Anhaltspunkten und nach
Richtung beobachten. Der heftige Kampf gilt, genau wie damals, vor allem dem
sogenannten Naturalismus und wenn wir bei dem Vertreter der Hegelschule, bei
Rötscher, lesen: >Der Künstler schlägt immer den Naturalisten, weil er ein von ihm
beherrschtes Ganzes gibt« oder »Ein Zustand, der gar nicht von dem Individuum
erfahren werden kann, ist nur aus der dichterischen Anschauung, welche in der Tat
die Wirklichkeit antizipiert, ergreifend darzustellen« oder »Wie vieles auch hier durch
psychologisches Studium ersetzt werden kann, jene Augenblicke (des Sterbens) sind
eindrücken beurteilen, er müßte denken, daß Frankreich in tiefstem Frieden und in
glänzendem Wohlstand lebte; dem inneren Gehalt nach stand Frankreichs Drama
der Kriegszeit den Zeitereignissen genau so fern, wie zwanzig Jahre vorher den
großen sozialen Umwälzungen, die in Norwegen bei Ibsen, in Deutschland bei
G. Hauptmann viel früher ihren künstlerischen Ausdruck fanden.
So bleibt der gewichtigste Teil des Buches der Eingang, der von der Auffüh-
rung des »König Ödipus«, der »Andromache« und des »Kaufmannes von Venedig«,
sowie von Balzacs »Vautrin« handelt. Freilich stellen die eingehenden Erörte-:
rungen über das Meisterwerk des Sophokles das griechische Drama wieder einmal
viel zu einseitig unter den Gesichtspunkt der Schicksalstragödie; und seine Abwehr
der Winckelmannschen Griechenauffassung würde bei uns wenigstens offene Türen
einrennen. Indem er den tragischen Schauder, der von der antiken Tragödie ausging,
sehr nahe an die religiösen Erlebnisse der Primitiven heranrückt, kann er freilich
dem modernen Zuschauer nur ein mittelbares Verhältnis zu dieser Kunst zusprechen:
wir müssen uns danach erst in die religiöse Lage des Atheners hineinversetzen, um
den »König Ödipus« zu genießen: »Quelque chose de ce respect a passe dans nos
cimes, puisque nous, hommes modernes, croyant ä la liberte et ä la responsibilite, nous
en supportons les horreurs et nous nous y plaisons.^ Ganz abgesehen davon, daß
wir den modernen Menschen nicht so schlechtweg zum Indeterministen machen
können, haben wir doch seit Wilamowitz und G. Murray ein inneres Verhältnis
zur griechischen Tragödie gewonnen, ohne Zugeständnisse an primitiv-religiöse
Erlebnisse und ohne Rückfall in die Griechenauffassung des 18. Jahrhunderts. Un-
gleich freier ist ja auch V. Baschs Standpunkt in der Besprechung der »Andromache«,
die augenscheinlich auf die Pariser der Kriegszeit eine ähnliche Wirkung ausgeübt
hat wie bei uns die »Troerinnen« in der Bearbeitung von Wer fei. Zum Schluß
sei noch auf die nicht durchweg originelle, aber sehr eindrucksvolle und überzeugend
durchgeführte Charakteristik Shylocks hingewiesen, die der eigentümlichen Kraft und
Größe dieser Gestalt vollauf gerecht wird.
Alles in allem genommen, bedeutet V. Baschs Buch nicht bloß ein wichtiges
Zeitdokument, einen Durchschnitt durch die Theaterkultur von Paris während eines
Kriegsjahres, und nicht bloß eine Sammlung geistreicher Bühnenkritiken überhaupt,
sondern einen wirklichen Fortschritt in der Verbindung von gründlicher Gelehrsam-
keit und unmittelbarem sicherem Kunstgefühl, wie sie in unseren Tagen nicht eben
häufig vorkommt.
Hamburg. Robert Petsch.
Herbert Jhering, Der Kampf ums Theater. Im Sibyllenverlag zu Dres-
den 1922.
Wie vor hundert Jahren die Reaktion auf die Romantik mit Hegel kam und im
Zusammenhang mit seiner normativen Ästhetik eine Schule normativer Kritik sich
bildete, so läßt sich in den letzten Jahren in Deutschland im Einklang mit der Re-
aktion der Ästhetik auf eine experimentell-psychologisch eingestellte Zeit auch in der
Tageskritik der Wunsch und die Sehnsucht nach festen Anhaltspunkten und nach
Richtung beobachten. Der heftige Kampf gilt, genau wie damals, vor allem dem
sogenannten Naturalismus und wenn wir bei dem Vertreter der Hegelschule, bei
Rötscher, lesen: >Der Künstler schlägt immer den Naturalisten, weil er ein von ihm
beherrschtes Ganzes gibt« oder »Ein Zustand, der gar nicht von dem Individuum
erfahren werden kann, ist nur aus der dichterischen Anschauung, welche in der Tat
die Wirklichkeit antizipiert, ergreifend darzustellen« oder »Wie vieles auch hier durch
psychologisches Studium ersetzt werden kann, jene Augenblicke (des Sterbens) sind