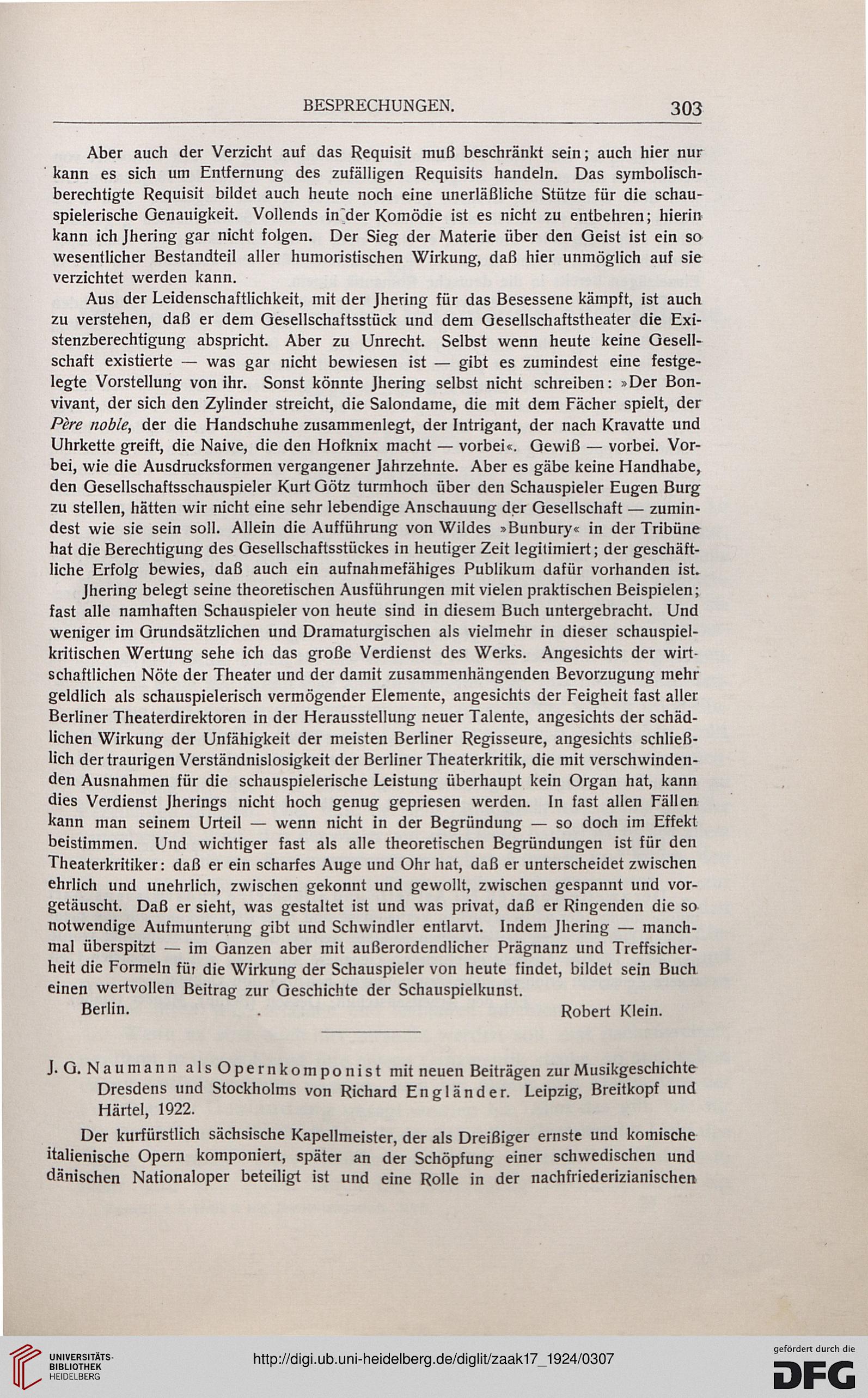BESPRECHUNGEN. 3Q3
Aber auch der Verzicht auf das Requisit muß beschränkt sein; auch hier nur
kann es sich um Entfernung des zufälligen Requisits handeln. Das symbolisch-
berechtigte Requisit bildet auch heute noch eine unerläßliche Stütze für die schau-
spielerische Genauigkeit. Vollends in"der Komödie ist es nicht zu entbehren; hierin
kann ich Jhering gar nicht folgen. Der Sieg der Materie über den Geist ist ein so
wesentlicher Bestandteil aller humoristischen Wirkung, daß hier unmöglich auf sie
verzichtet werden kann.
Aus der Leidenschaftlichkeit, mit der Jhering für das Besessene kämpft, ist auch
zu verstehen, daß er dem Gesellschaftsstück und dem Gesellschaftstheater die Exi-
stenzberechtigung abspricht. Aber zu Unrecht. Selbst wenn heute keine Gesell-
schaft existierte — was gar nicht bewiesen ist — gibt es zumindest eine festge-
legte Vorstellung von ihr. Sonst könnte Jhering selbst nicht schreiben: »Der Bon-
vivant, der sich den Zylinder streicht, die Salondame, die mit dem Fächer spielt, der
Pere noble, der die Handschuhe zusammenlegt, der Intrigant, der nach Kravatte und
Uhrkette greift, die Naive, die den Hofknix macht — vorbei«. Gewiß — vorbei. Vor-
bei, wie die Ausdrucksformen vergangener Jahrzehnte. Aber es gäbe keine Handhabe,
den Gesellschaftsschauspieler Kurt Götz turmhoch über den Schauspieler Eugen Burg
zu stellen, hätten wir nicht eine sehr lebendige Anschauung der Gesellschaft — zumin-
dest wie sie sein soll. Allein die Aufführung von Wildes »Bunbury« in der Tribüne
hat die Berechtigung des Gesellschaftsstückes in heutiger Zeit legitimiert; der geschäft-
liche Erfolg bewies, daß auch ein aufnahmefähiges Publikum dafür vorhanden ist.
Jhering belegt seine theoretischen Ausführungen mit vielen praktischen Beispielen;
fast alle namhaften Schauspieler von heute sind in diesem Buch untergebracht. Und
weniger im Grundsätzlichen und Dramaturgischen als vielmehr in dieser schauspiel-
kritischen Wertung sehe ich das große Verdienst des Werks. Angesichts der wirt-
schaftlichen Nöte der Theater und der damit zusammenhängenden Bevorzugung mehr
geldlich als schauspielerisch vermögender Elemente, angesichts der Feigheit fast aller
Berliner Theaterdirektoren in der Herausstellung neuer Talente, angesichts der schäd-
lichen Wirkung der Unfähigkeit der meisten Berliner Regisseure, angesichts schließ-
lich der traurigen Verständnislosigkeit der Berliner Theaterkritik, die mit verschwinden-
den Ausnahmen für die schauspielerische Leistung überhaupt kein Organ hat, kann
dies Verdienst Jherings nicht hoch genug gepriesen werden. In fast allen Fällen
kann man seinem Urteil — wenn nicht in der Begründung — so doch im Effekt
beistimmen. Und wichtiger fast als alle theoretischen Begründungen ist für den
Theaterkritiker: daß er ein scharfes Auge und Ohr hat, daß er unterscheidet zwischen
ehrlich und unehrlich, zwischen gekonnt und gewollt, zwischen gespannt und vor-
getäuscht. Daß er sieht, was gestaltet ist und was privat, daß er Ringenden die so-
notwendige Aufmunterung gibt und Schwindler entlarvt. Indem Jhering — manch-
mal überspitzt — im Ganzen aber mit außerordendlicher Prägnanz und Treffsicher-
heit die Formeln für die Wirkung der Schauspieler von heute findet, bildet sein Buch
einen wertvollen Beitrag zur Geschichte der Schauspielkunst.
Berlin. . Robert Klein.
J. G. Naumann alsOpernkomponist mit neuen Beiträgen zur Musikgeschichte
Dresdens und Stockholms von Richard Engländer. Leipzig, Breitkopf und
Härtel, 1922.
Der kurfürstlich sächsische Kapellmeister, der als Dreißiger ernste und komische
italienische Opern komponiert, später an der Schöpfung einer schwedischen und
dänischen Nationaloper beteiligt ist und eine Rolle in der nachfriederizianischen
Aber auch der Verzicht auf das Requisit muß beschränkt sein; auch hier nur
kann es sich um Entfernung des zufälligen Requisits handeln. Das symbolisch-
berechtigte Requisit bildet auch heute noch eine unerläßliche Stütze für die schau-
spielerische Genauigkeit. Vollends in"der Komödie ist es nicht zu entbehren; hierin
kann ich Jhering gar nicht folgen. Der Sieg der Materie über den Geist ist ein so
wesentlicher Bestandteil aller humoristischen Wirkung, daß hier unmöglich auf sie
verzichtet werden kann.
Aus der Leidenschaftlichkeit, mit der Jhering für das Besessene kämpft, ist auch
zu verstehen, daß er dem Gesellschaftsstück und dem Gesellschaftstheater die Exi-
stenzberechtigung abspricht. Aber zu Unrecht. Selbst wenn heute keine Gesell-
schaft existierte — was gar nicht bewiesen ist — gibt es zumindest eine festge-
legte Vorstellung von ihr. Sonst könnte Jhering selbst nicht schreiben: »Der Bon-
vivant, der sich den Zylinder streicht, die Salondame, die mit dem Fächer spielt, der
Pere noble, der die Handschuhe zusammenlegt, der Intrigant, der nach Kravatte und
Uhrkette greift, die Naive, die den Hofknix macht — vorbei«. Gewiß — vorbei. Vor-
bei, wie die Ausdrucksformen vergangener Jahrzehnte. Aber es gäbe keine Handhabe,
den Gesellschaftsschauspieler Kurt Götz turmhoch über den Schauspieler Eugen Burg
zu stellen, hätten wir nicht eine sehr lebendige Anschauung der Gesellschaft — zumin-
dest wie sie sein soll. Allein die Aufführung von Wildes »Bunbury« in der Tribüne
hat die Berechtigung des Gesellschaftsstückes in heutiger Zeit legitimiert; der geschäft-
liche Erfolg bewies, daß auch ein aufnahmefähiges Publikum dafür vorhanden ist.
Jhering belegt seine theoretischen Ausführungen mit vielen praktischen Beispielen;
fast alle namhaften Schauspieler von heute sind in diesem Buch untergebracht. Und
weniger im Grundsätzlichen und Dramaturgischen als vielmehr in dieser schauspiel-
kritischen Wertung sehe ich das große Verdienst des Werks. Angesichts der wirt-
schaftlichen Nöte der Theater und der damit zusammenhängenden Bevorzugung mehr
geldlich als schauspielerisch vermögender Elemente, angesichts der Feigheit fast aller
Berliner Theaterdirektoren in der Herausstellung neuer Talente, angesichts der schäd-
lichen Wirkung der Unfähigkeit der meisten Berliner Regisseure, angesichts schließ-
lich der traurigen Verständnislosigkeit der Berliner Theaterkritik, die mit verschwinden-
den Ausnahmen für die schauspielerische Leistung überhaupt kein Organ hat, kann
dies Verdienst Jherings nicht hoch genug gepriesen werden. In fast allen Fällen
kann man seinem Urteil — wenn nicht in der Begründung — so doch im Effekt
beistimmen. Und wichtiger fast als alle theoretischen Begründungen ist für den
Theaterkritiker: daß er ein scharfes Auge und Ohr hat, daß er unterscheidet zwischen
ehrlich und unehrlich, zwischen gekonnt und gewollt, zwischen gespannt und vor-
getäuscht. Daß er sieht, was gestaltet ist und was privat, daß er Ringenden die so-
notwendige Aufmunterung gibt und Schwindler entlarvt. Indem Jhering — manch-
mal überspitzt — im Ganzen aber mit außerordendlicher Prägnanz und Treffsicher-
heit die Formeln für die Wirkung der Schauspieler von heute findet, bildet sein Buch
einen wertvollen Beitrag zur Geschichte der Schauspielkunst.
Berlin. . Robert Klein.
J. G. Naumann alsOpernkomponist mit neuen Beiträgen zur Musikgeschichte
Dresdens und Stockholms von Richard Engländer. Leipzig, Breitkopf und
Härtel, 1922.
Der kurfürstlich sächsische Kapellmeister, der als Dreißiger ernste und komische
italienische Opern komponiert, später an der Schöpfung einer schwedischen und
dänischen Nationaloper beteiligt ist und eine Rolle in der nachfriederizianischen