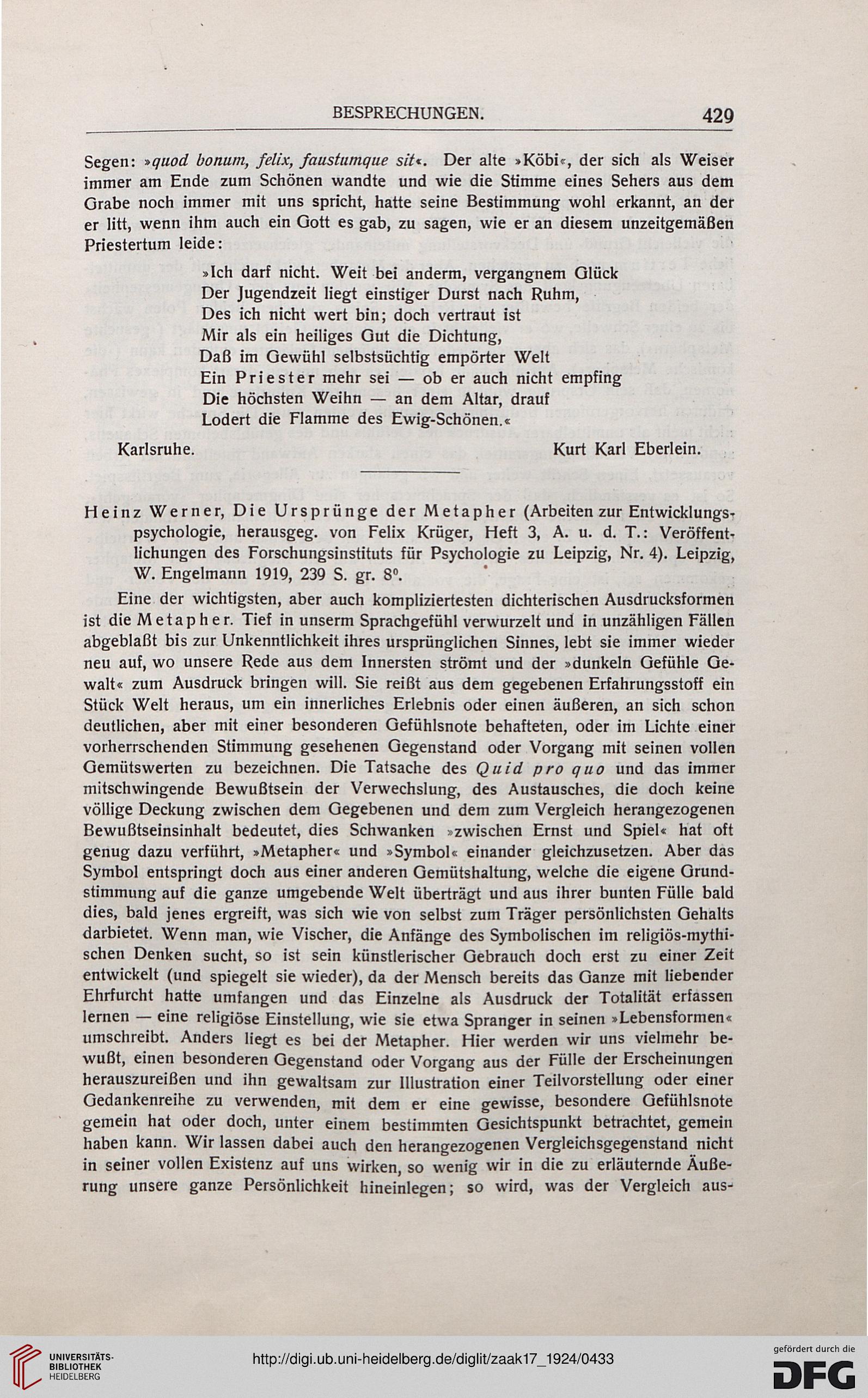BESPRECHUNGEN. 429
Segen: »quod bonum, felix, faustumque sit*. Der alte »Köbi«, der sich als Weiser
immer am Ende zum Schönen wandte und wie die Stimme eines Sehers aus dem
Grabe noch immer mit uns spricht, hatte seine Bestimmung wohl erkannt, an der
er litt, wenn ihm auch ein Gott es gab, zu sagen, wie er an diesem unzeitgemäßen
Priestertum leide:
»Ich darf nicht. Weit bei anderm, vergangnem Glück
Der Jugendzeit liegt einstiger Durst nach Ruhm,
Des ich nicht wert bin; doch vertraut ist
Mir als ein heiliges Gut die Dichtung,
Daß im Gewühl selbstsüchtig empörter Welt
Ein Priester mehr sei — ob er auch nicht empfing
Die höchsten Weihn — an dem Altar, drauf
Lodert die Flamme des Ewig-Schönen.«
Karlsruhe. Kurt Karl Eberlein.
Heinz Werner, Die Ursprünge der Metapher (Arbeiten zur Entwicklungs-
psychologie, herausgeg. von Felix Krüger, Heft 3, A. u. d. T.: Veröffent-
lichungen des Forschungsinstituts für Psychologie zu Leipzig, Nr. 4). Leipzig,
W. Engelmann 1919, 239 S. gr. 8°.
Eine der wichtigsten, aber auch kompliziertesten dichterischen Ausdrucksformen
ist die Metapher. Tief in unserm Sprachgefühl verwurzelt und in unzähligen Fällen
abgeblaßt bis zur Unkenntlichkeit ihres ursprünglichen Sinnes, lebt sie immer wieder
neu auf, wo unsere Rede aus dem Innersten strömt und der »dunkeln Gefühle Ge-
walt« zum Ausdruck bringen will. Sie reißt aus dem gegebenen Erfahrungsstoff ein
Stück Welt heraus, um ein innerliches Erlebnis oder einen äußeren, an sich schon
deutlichen, aber mit einer besonderen Gefühlsnote behafteten, oder im Lichte einer
vorherrschenden Stimmung gesehenen Gegenstand oder Vorgang mit seinen vollen
Gemütswerten zu bezeichnen. Die Tatsache des Quid pro quo und das immer
mitschwingende Bewußtsein der Verwechslung, des Austausches, die doch keine
völlige Deckung zwischen dem Gegebenen und dem zum Vergleich herangezogenen
Bewußtseinsinhalt bedeutet, dies Schwanken »zwischen Ernst und Spiel« hat oft
genug dazu verführt, »Metapher« und »Symbol« einander gleichzusetzen. Aber das
Symbol entspringt doch aus einer anderen Gemütshaltung, welche die eigene Grund-
stimmung auf die ganze umgebende Welt überträgt und aus ihrer bunten Fülle bald
dies, bald jenes ergreift, was sich wie von selbst zum Träger persönlichsten Gehalts
darbietet. Wenn man, wie Vischer, die Anfänge des Symbolischen im religiös-mythi-
schen Denken sucht, so ist sein künstlerischer Gebrauch doch erst zu einer Zeit
entwickelt (und spiegelt sie wieder), da der Mensch bereits das Ganze mit liebender
Ehrfurcht hatte umfangen und das Einzelne als Ausdruck der Totalität erfassen
lernen — eine religiöse Einstellung, wie sie etwa Spranger in seinen »Lebensformen«
umschreibt. Anders liegt es bei der Metapher. Hier werden wir uns vielmehr be-
wußt, einen besonderen Gegenstand oder Vorgang aus der Fülle der Erscheinungen
herauszureißen und ihn gewaltsam zur Illustration einer Teilvorstellung oder einer
Gedankenreihe zu verwenden, mit dem er eine gewisse, besondere Gefühlsnote
gemein hat oder doch, unter einem bestimmten Gesichtspunkt betrachtet, gemein
haben kann. Wir lassen dabei auch den herangezogenen Vergleichsgegenstand nicht
in seiner vollen Existenz auf uns wirken, so wenig wir in die zu erläuternde Äuße-
rung unsere ganze Persönlichkeit hineinlegen; so wird, was der Vergleich aus-
Segen: »quod bonum, felix, faustumque sit*. Der alte »Köbi«, der sich als Weiser
immer am Ende zum Schönen wandte und wie die Stimme eines Sehers aus dem
Grabe noch immer mit uns spricht, hatte seine Bestimmung wohl erkannt, an der
er litt, wenn ihm auch ein Gott es gab, zu sagen, wie er an diesem unzeitgemäßen
Priestertum leide:
»Ich darf nicht. Weit bei anderm, vergangnem Glück
Der Jugendzeit liegt einstiger Durst nach Ruhm,
Des ich nicht wert bin; doch vertraut ist
Mir als ein heiliges Gut die Dichtung,
Daß im Gewühl selbstsüchtig empörter Welt
Ein Priester mehr sei — ob er auch nicht empfing
Die höchsten Weihn — an dem Altar, drauf
Lodert die Flamme des Ewig-Schönen.«
Karlsruhe. Kurt Karl Eberlein.
Heinz Werner, Die Ursprünge der Metapher (Arbeiten zur Entwicklungs-
psychologie, herausgeg. von Felix Krüger, Heft 3, A. u. d. T.: Veröffent-
lichungen des Forschungsinstituts für Psychologie zu Leipzig, Nr. 4). Leipzig,
W. Engelmann 1919, 239 S. gr. 8°.
Eine der wichtigsten, aber auch kompliziertesten dichterischen Ausdrucksformen
ist die Metapher. Tief in unserm Sprachgefühl verwurzelt und in unzähligen Fällen
abgeblaßt bis zur Unkenntlichkeit ihres ursprünglichen Sinnes, lebt sie immer wieder
neu auf, wo unsere Rede aus dem Innersten strömt und der »dunkeln Gefühle Ge-
walt« zum Ausdruck bringen will. Sie reißt aus dem gegebenen Erfahrungsstoff ein
Stück Welt heraus, um ein innerliches Erlebnis oder einen äußeren, an sich schon
deutlichen, aber mit einer besonderen Gefühlsnote behafteten, oder im Lichte einer
vorherrschenden Stimmung gesehenen Gegenstand oder Vorgang mit seinen vollen
Gemütswerten zu bezeichnen. Die Tatsache des Quid pro quo und das immer
mitschwingende Bewußtsein der Verwechslung, des Austausches, die doch keine
völlige Deckung zwischen dem Gegebenen und dem zum Vergleich herangezogenen
Bewußtseinsinhalt bedeutet, dies Schwanken »zwischen Ernst und Spiel« hat oft
genug dazu verführt, »Metapher« und »Symbol« einander gleichzusetzen. Aber das
Symbol entspringt doch aus einer anderen Gemütshaltung, welche die eigene Grund-
stimmung auf die ganze umgebende Welt überträgt und aus ihrer bunten Fülle bald
dies, bald jenes ergreift, was sich wie von selbst zum Träger persönlichsten Gehalts
darbietet. Wenn man, wie Vischer, die Anfänge des Symbolischen im religiös-mythi-
schen Denken sucht, so ist sein künstlerischer Gebrauch doch erst zu einer Zeit
entwickelt (und spiegelt sie wieder), da der Mensch bereits das Ganze mit liebender
Ehrfurcht hatte umfangen und das Einzelne als Ausdruck der Totalität erfassen
lernen — eine religiöse Einstellung, wie sie etwa Spranger in seinen »Lebensformen«
umschreibt. Anders liegt es bei der Metapher. Hier werden wir uns vielmehr be-
wußt, einen besonderen Gegenstand oder Vorgang aus der Fülle der Erscheinungen
herauszureißen und ihn gewaltsam zur Illustration einer Teilvorstellung oder einer
Gedankenreihe zu verwenden, mit dem er eine gewisse, besondere Gefühlsnote
gemein hat oder doch, unter einem bestimmten Gesichtspunkt betrachtet, gemein
haben kann. Wir lassen dabei auch den herangezogenen Vergleichsgegenstand nicht
in seiner vollen Existenz auf uns wirken, so wenig wir in die zu erläuternde Äuße-
rung unsere ganze Persönlichkeit hineinlegen; so wird, was der Vergleich aus-