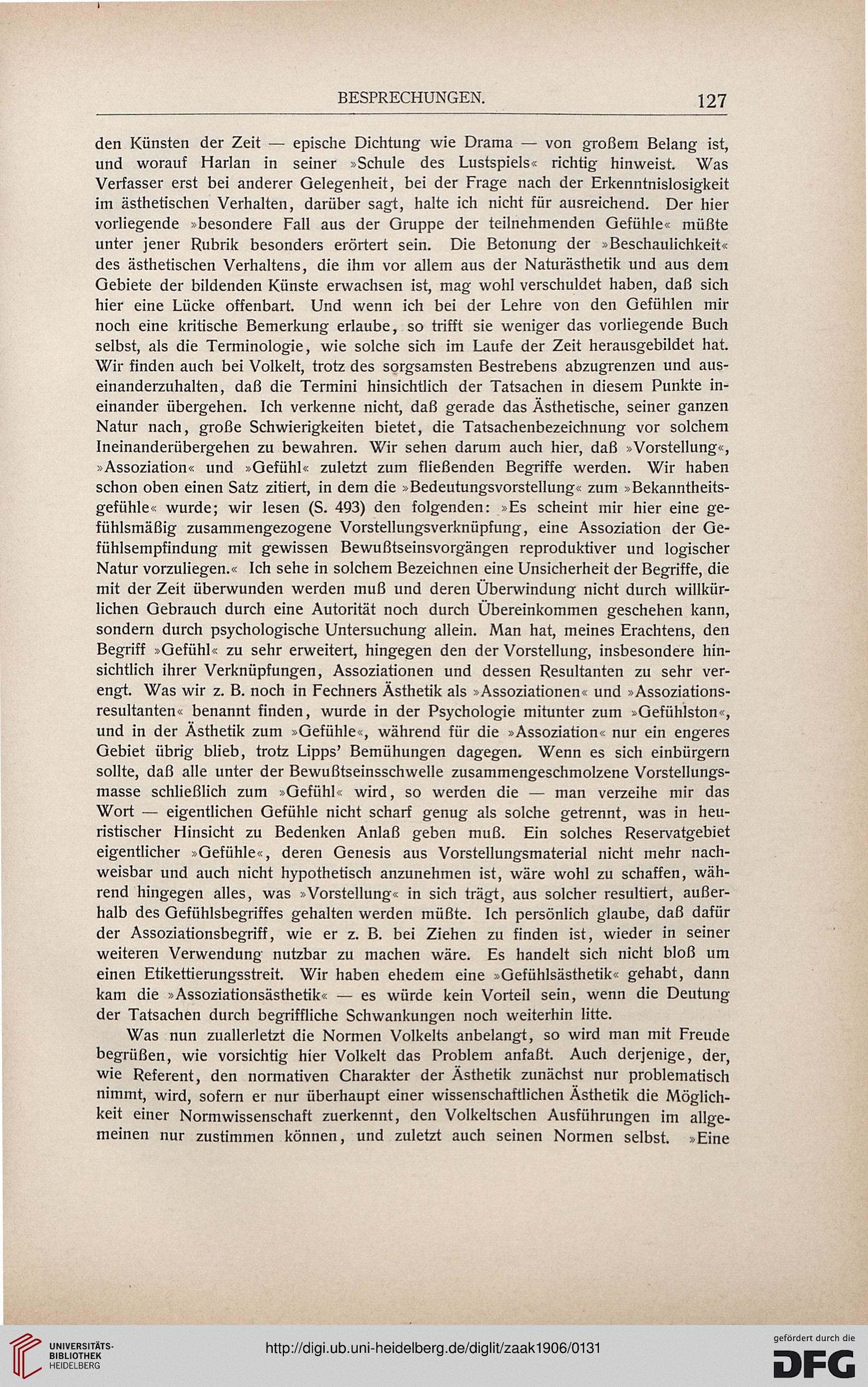BESPRECHUNGEN. 127
den Künsten der Zeit — epische Dichtung wie Drama — von großem Belang ist,
und worauf Harlan in seiner »Schule des Lustspiels« richtig hinweist. Was
Verfasser erst bei anderer Gelegenheit, bei der Frage nach der Erkenntnislosigkeit
im ästhetischen Verhalten, darüber sagt, halte ich nicht für ausreichend. Der hier
vorliegende »besondere Fall aus der Qruppe der teilnehmenden Gefühle« müßte
unter jener Rubrik besonders erörtert sein. Die Betonung der »Beschaulichkeit«
des ästhetischen Verhaltens, die ihm vor allem aus der Naturästhetik und aus dem
Gebiete der bildenden Künste erwachsen ist, mag wohl verschuldet haben, daß sich
hier eine Lücke offenbart. Und wenn ich bei der Lehre von den Gefühlen mir
noch eine kritische Bemerkung erlaube, so trifft sie weniger das vorliegende Buch
selbst, als die Terminologie, wie solche sich im Laufe der Zeit herausgebildet hat.
Wir finden auch bei Volkelt, trotz des sorgsamsten Bestrebens abzugrenzen und aus-
einanderzuhalten, daß die Termini hinsichtlich der Tatsachen in diesem Punkte in-
einander übergehen. Ich verkenne nicht, daß gerade das Ästhetische, seiner ganzen
Natur nach, große Schwierigkeiten bietet, die Tatsachenbezeichnung vor solchem
Ineinanderübergehen zu bewahren. Wir sehen darum auch hier, daß »Vorstellung«,
»Assoziation« und »Gefühl« zuletzt zum fließenden Begriffe werden. Wir haben
schon oben einen Satz zitiert, in dem die »Bedeutungsvorstellung« zum »Bekanntheits-
gefühle« wurde; wir lesen (S. 493) den folgenden: »Es scheint mir hier eine ge-
fühlsmäßig zusammengezogene Vorstellungsverknüpfung, eine Assoziation der Ge-
fühlsempfindung mit gewissen Bewußtseinsvorgängen reproduktiver und logischer
Natur vorzuliegen.« Ich sehe in solchem Bezeichnen eine Unsicherheit der Begriffe, die
mit der Zeit überwunden werden muß und deren Überwindung nicht durch willkür-
lichen Gebrauch durch eine Autorität noch durch Übereinkommen geschehen kann,
sondern durch psychologische Untersuchung allein. Man hat, meines Erachtens, den
Begriff »Gefühl« zu sehr erweitert, hingegen den der Vorstellung, insbesondere hin-
sichtlich ihrer Verknüpfungen, Assoziationen und dessen Resultanten zu sehr ver-
engt. Was wir z. B. noch in Fechners Ästhetik als »Assoziationen« und »Assoziations-
resultanten« benannt finden, wurde in der Psychologie mitunter zum »Gefühlston«,
und in der Ästhetik zum »Gefühle«, während für die »Assoziation« nur ein engeres
Gebiet übrig blieb, trotz Lipps' Bemühungen dagegen. Wenn es sich einbürgern
sollte, daß alle unter der Bewußtseinsschwelle zusammengeschmolzene Vorstellungs-
masse schließlich zum »Gefühl« wird, so werden die — man verzeihe mir das
Wort — eigentlichen Gefühle nicht scharf genug als solche getrennt, was in heu-
ristischer Hinsicht zu Bedenken Anlaß geben muß. Ein solches Reservatgebiet
eigentlicher »Gefühle«, deren Genesis aus Vorstellungsmaterial nicht mehr nach-
weisbar und auch nicht hypothetisch anzunehmen ist, wäre wohl zu schaffen, wäh-
rend hingegen alles, was »Vorstellung« in sich trägt, aus solcher resultiert, außer-
halb des Gefühlsbegriffes gehalten werden müßte. Ich persönlich glaube, daß dafür
der Assoziationsbegriff, wie er z. B. bei Ziehen zu finden ist, wieder in seiner
weiteren Verwendung nutzbar zu machen wäre. Es handelt sich nicht bloß um
einen Etikettierungsstreit. Wir haben ehedem eine »Gefühlsästhetik« gehabt, dann
kam die »Assoziationsästhetik« — es würde kein Vorteil sein, wenn die Deutung
der Tatsachen durch begriffliche Schwankungen noch weiterhin litte.
Was nun zuallerletzt die Normen Volkelts anbelangt, so wird man mit Freude
begrüßen, wie vorsichtig hier Volkelt das Problem anfaßt. Auch derjenige, der,
wie Referent, den normativen Charakter der Ästhetik zunächst nur problematisch
nimmt, wird, sofern er nur überhaupt einer wissenschaftlichen Ästhetik die Möglich-
keit einer Normwissenschaft zuerkennt, den Volkeltschen Ausführungen im allge-
meinen nur zustimmen können, und zuletzt auch seinen Normen selbst. »Eine
den Künsten der Zeit — epische Dichtung wie Drama — von großem Belang ist,
und worauf Harlan in seiner »Schule des Lustspiels« richtig hinweist. Was
Verfasser erst bei anderer Gelegenheit, bei der Frage nach der Erkenntnislosigkeit
im ästhetischen Verhalten, darüber sagt, halte ich nicht für ausreichend. Der hier
vorliegende »besondere Fall aus der Qruppe der teilnehmenden Gefühle« müßte
unter jener Rubrik besonders erörtert sein. Die Betonung der »Beschaulichkeit«
des ästhetischen Verhaltens, die ihm vor allem aus der Naturästhetik und aus dem
Gebiete der bildenden Künste erwachsen ist, mag wohl verschuldet haben, daß sich
hier eine Lücke offenbart. Und wenn ich bei der Lehre von den Gefühlen mir
noch eine kritische Bemerkung erlaube, so trifft sie weniger das vorliegende Buch
selbst, als die Terminologie, wie solche sich im Laufe der Zeit herausgebildet hat.
Wir finden auch bei Volkelt, trotz des sorgsamsten Bestrebens abzugrenzen und aus-
einanderzuhalten, daß die Termini hinsichtlich der Tatsachen in diesem Punkte in-
einander übergehen. Ich verkenne nicht, daß gerade das Ästhetische, seiner ganzen
Natur nach, große Schwierigkeiten bietet, die Tatsachenbezeichnung vor solchem
Ineinanderübergehen zu bewahren. Wir sehen darum auch hier, daß »Vorstellung«,
»Assoziation« und »Gefühl« zuletzt zum fließenden Begriffe werden. Wir haben
schon oben einen Satz zitiert, in dem die »Bedeutungsvorstellung« zum »Bekanntheits-
gefühle« wurde; wir lesen (S. 493) den folgenden: »Es scheint mir hier eine ge-
fühlsmäßig zusammengezogene Vorstellungsverknüpfung, eine Assoziation der Ge-
fühlsempfindung mit gewissen Bewußtseinsvorgängen reproduktiver und logischer
Natur vorzuliegen.« Ich sehe in solchem Bezeichnen eine Unsicherheit der Begriffe, die
mit der Zeit überwunden werden muß und deren Überwindung nicht durch willkür-
lichen Gebrauch durch eine Autorität noch durch Übereinkommen geschehen kann,
sondern durch psychologische Untersuchung allein. Man hat, meines Erachtens, den
Begriff »Gefühl« zu sehr erweitert, hingegen den der Vorstellung, insbesondere hin-
sichtlich ihrer Verknüpfungen, Assoziationen und dessen Resultanten zu sehr ver-
engt. Was wir z. B. noch in Fechners Ästhetik als »Assoziationen« und »Assoziations-
resultanten« benannt finden, wurde in der Psychologie mitunter zum »Gefühlston«,
und in der Ästhetik zum »Gefühle«, während für die »Assoziation« nur ein engeres
Gebiet übrig blieb, trotz Lipps' Bemühungen dagegen. Wenn es sich einbürgern
sollte, daß alle unter der Bewußtseinsschwelle zusammengeschmolzene Vorstellungs-
masse schließlich zum »Gefühl« wird, so werden die — man verzeihe mir das
Wort — eigentlichen Gefühle nicht scharf genug als solche getrennt, was in heu-
ristischer Hinsicht zu Bedenken Anlaß geben muß. Ein solches Reservatgebiet
eigentlicher »Gefühle«, deren Genesis aus Vorstellungsmaterial nicht mehr nach-
weisbar und auch nicht hypothetisch anzunehmen ist, wäre wohl zu schaffen, wäh-
rend hingegen alles, was »Vorstellung« in sich trägt, aus solcher resultiert, außer-
halb des Gefühlsbegriffes gehalten werden müßte. Ich persönlich glaube, daß dafür
der Assoziationsbegriff, wie er z. B. bei Ziehen zu finden ist, wieder in seiner
weiteren Verwendung nutzbar zu machen wäre. Es handelt sich nicht bloß um
einen Etikettierungsstreit. Wir haben ehedem eine »Gefühlsästhetik« gehabt, dann
kam die »Assoziationsästhetik« — es würde kein Vorteil sein, wenn die Deutung
der Tatsachen durch begriffliche Schwankungen noch weiterhin litte.
Was nun zuallerletzt die Normen Volkelts anbelangt, so wird man mit Freude
begrüßen, wie vorsichtig hier Volkelt das Problem anfaßt. Auch derjenige, der,
wie Referent, den normativen Charakter der Ästhetik zunächst nur problematisch
nimmt, wird, sofern er nur überhaupt einer wissenschaftlichen Ästhetik die Möglich-
keit einer Normwissenschaft zuerkennt, den Volkeltschen Ausführungen im allge-
meinen nur zustimmen können, und zuletzt auch seinen Normen selbst. »Eine