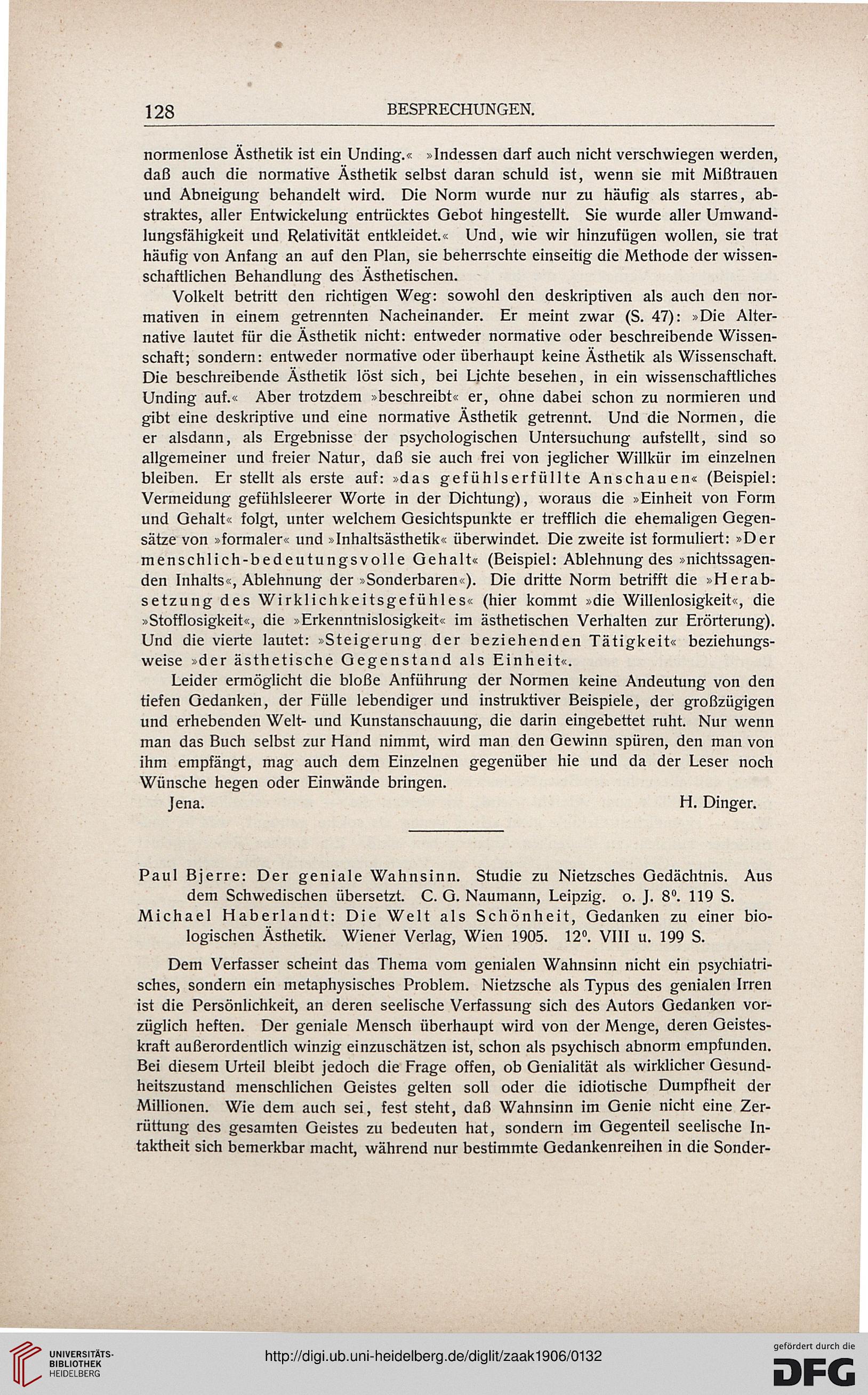128 BESPRECHUNGEN.
normenlose Ästhetik ist ein Unding.« »Indessen darf auch nicht verschwiegen werden,
daß auch die normative Ästhetik selbst daran schuld ist, wenn sie mit Mißtrauen
und Abneigung behandelt wird. Die Norm wurde nur zu häufig als starres, ab-
straktes, aller Entwickelung entrücktes Gebot hingestellt. Sie wurde aller Umwand-
lungsfähigkeit und Relativität entkleidet.« Und, wie wir hinzufügen wollen, sie trat
häufig von Anfang an auf den Plan, sie beherrschte einseitig die Methode der wissen-
schaftlichen Behandlung des Ästhetischen.
Volkelt betritt den richtigen Weg: sowohl den deskriptiven als auch den nor-
mativen in einem getrennten Nacheinander. Er meint zwar (S. 47): »Die Alter-
native lautet für die Ästhetik nicht: entweder normative oder beschreibende Wissen-
schaft; sondern: entweder normative oder überhaupt keine Ästhetik als Wissenschaft.
Die beschreibende Ästhetik löst sich, bei Lichte besehen, in ein wissenschaftliches
Unding auf.« Aber trotzdem »beschreibt« er, ohne dabei schon zu normieren und
gibt eine deskriptive und eine normative Ästhetik getrennt. Und die Normen, die
er alsdann, als Ergebnisse der psychologischen Untersuchung aufstellt, sind so
allgemeiner und freier Natur, daß sie auch frei von jeglicher Willkür im einzelnen
bleiben. Er stellt als erste auf: »das gefühlserfüllte Anschauen« (Beispiel:
Vermeidung gefühlsleerer Worte in der Dichtung), woraus die »Einheit von Form
und Qehalt« folgt, unter welchem Gesichtspunkte er trefflich die ehemaligen Gegen-
sätze von »formaler« und »Inhaltsästhetik« überwindet. Die zweite ist formuliert: »Der
menschlich-bedeutungsvolle Gehalt« (Beispiel: Ablehnung des »nichtssagen-
den Inhalts«, Ablehnung der »Sonderbaren«). Die dritte Norm betrifft die »Herab-
setzung des Wirklichkeitsgefühles« (hier kommt »die Willenlosigkeit«, die
»Stofflosigkeit«, die »Erkenntnislosigkeit« im ästhetischen Verhalten zur Erörterung).
Und die vierte lautet: »Steigerung der beziehenden Tätigkeit« beziehungs-
weise »der ästhetische Gegenstand als Einheit«.
Leider ermöglicht die bloße Anführung der Normen keine Andeutung von den
tiefen Gedanken, der Fülle lebendiger und instruktiver Beispiele, der großzügigen
und erhebenden Welt- und Kunstanschauung, die darin eingebettet ruht. Nur wenn
man das Buch selbst zur Hand nimmt, wird man den Gewinn spüren, den man von
ihm empfängt, mag auch dem Einzelnen gegenüber hie und da der Leser noch
Wünsche hegen oder Einwände bringen.
Jena. H. Dinger.
Paul Bjerre: Der geniale Wahnsinn. Studie zu Nietzsches Gedächtnis. Aus
dem Schwedischen übersetzt. C. G. Naumann, Leipzig, o. J. 8°. 119 S.
Michael Haberlandt: Die Welt als Schönheit, Gedanken zu einer bio-
logischen Ästhetik. Wiener Verlag, Wien 1905. 12°. VIII u. 199 S.
Dem Verfasser scheint das Thema vom genialen Wahnsinn nicht ein psychiatri-
sches, sondern ein metaphysisches Problem. Nietzsche als Typus des genialen Irren
ist die Persönlichkeit, an deren seelische Verfassung sich des Autors Gedanken vor-
züglich heften. Der geniale Mensch überhaupt wird von der Menge, deren Geistes-
kraft außerordentlich winzig einzuschätzen ist, schon als psychisch abnorm empfunden.
Bei diesem Urteil bleibt jedoch die Frage offen, ob Genialität als wirklicher Gesund-
heitszustand menschlichen Geistes gelten soll oder die idiotische Dumpfheit der
Millionen. Wie dem auch sei, fest steht, daß Wahnsinn im Genie nicht eine Zer-
rüttung des gesamten Geistes zu bedeuten hat, sondern im Gegenteil seelische In-
taktheit sich bemerkbar macht, während nur bestimmte Gedankenreihen in die Sonder-
normenlose Ästhetik ist ein Unding.« »Indessen darf auch nicht verschwiegen werden,
daß auch die normative Ästhetik selbst daran schuld ist, wenn sie mit Mißtrauen
und Abneigung behandelt wird. Die Norm wurde nur zu häufig als starres, ab-
straktes, aller Entwickelung entrücktes Gebot hingestellt. Sie wurde aller Umwand-
lungsfähigkeit und Relativität entkleidet.« Und, wie wir hinzufügen wollen, sie trat
häufig von Anfang an auf den Plan, sie beherrschte einseitig die Methode der wissen-
schaftlichen Behandlung des Ästhetischen.
Volkelt betritt den richtigen Weg: sowohl den deskriptiven als auch den nor-
mativen in einem getrennten Nacheinander. Er meint zwar (S. 47): »Die Alter-
native lautet für die Ästhetik nicht: entweder normative oder beschreibende Wissen-
schaft; sondern: entweder normative oder überhaupt keine Ästhetik als Wissenschaft.
Die beschreibende Ästhetik löst sich, bei Lichte besehen, in ein wissenschaftliches
Unding auf.« Aber trotzdem »beschreibt« er, ohne dabei schon zu normieren und
gibt eine deskriptive und eine normative Ästhetik getrennt. Und die Normen, die
er alsdann, als Ergebnisse der psychologischen Untersuchung aufstellt, sind so
allgemeiner und freier Natur, daß sie auch frei von jeglicher Willkür im einzelnen
bleiben. Er stellt als erste auf: »das gefühlserfüllte Anschauen« (Beispiel:
Vermeidung gefühlsleerer Worte in der Dichtung), woraus die »Einheit von Form
und Qehalt« folgt, unter welchem Gesichtspunkte er trefflich die ehemaligen Gegen-
sätze von »formaler« und »Inhaltsästhetik« überwindet. Die zweite ist formuliert: »Der
menschlich-bedeutungsvolle Gehalt« (Beispiel: Ablehnung des »nichtssagen-
den Inhalts«, Ablehnung der »Sonderbaren«). Die dritte Norm betrifft die »Herab-
setzung des Wirklichkeitsgefühles« (hier kommt »die Willenlosigkeit«, die
»Stofflosigkeit«, die »Erkenntnislosigkeit« im ästhetischen Verhalten zur Erörterung).
Und die vierte lautet: »Steigerung der beziehenden Tätigkeit« beziehungs-
weise »der ästhetische Gegenstand als Einheit«.
Leider ermöglicht die bloße Anführung der Normen keine Andeutung von den
tiefen Gedanken, der Fülle lebendiger und instruktiver Beispiele, der großzügigen
und erhebenden Welt- und Kunstanschauung, die darin eingebettet ruht. Nur wenn
man das Buch selbst zur Hand nimmt, wird man den Gewinn spüren, den man von
ihm empfängt, mag auch dem Einzelnen gegenüber hie und da der Leser noch
Wünsche hegen oder Einwände bringen.
Jena. H. Dinger.
Paul Bjerre: Der geniale Wahnsinn. Studie zu Nietzsches Gedächtnis. Aus
dem Schwedischen übersetzt. C. G. Naumann, Leipzig, o. J. 8°. 119 S.
Michael Haberlandt: Die Welt als Schönheit, Gedanken zu einer bio-
logischen Ästhetik. Wiener Verlag, Wien 1905. 12°. VIII u. 199 S.
Dem Verfasser scheint das Thema vom genialen Wahnsinn nicht ein psychiatri-
sches, sondern ein metaphysisches Problem. Nietzsche als Typus des genialen Irren
ist die Persönlichkeit, an deren seelische Verfassung sich des Autors Gedanken vor-
züglich heften. Der geniale Mensch überhaupt wird von der Menge, deren Geistes-
kraft außerordentlich winzig einzuschätzen ist, schon als psychisch abnorm empfunden.
Bei diesem Urteil bleibt jedoch die Frage offen, ob Genialität als wirklicher Gesund-
heitszustand menschlichen Geistes gelten soll oder die idiotische Dumpfheit der
Millionen. Wie dem auch sei, fest steht, daß Wahnsinn im Genie nicht eine Zer-
rüttung des gesamten Geistes zu bedeuten hat, sondern im Gegenteil seelische In-
taktheit sich bemerkbar macht, während nur bestimmte Gedankenreihen in die Sonder-