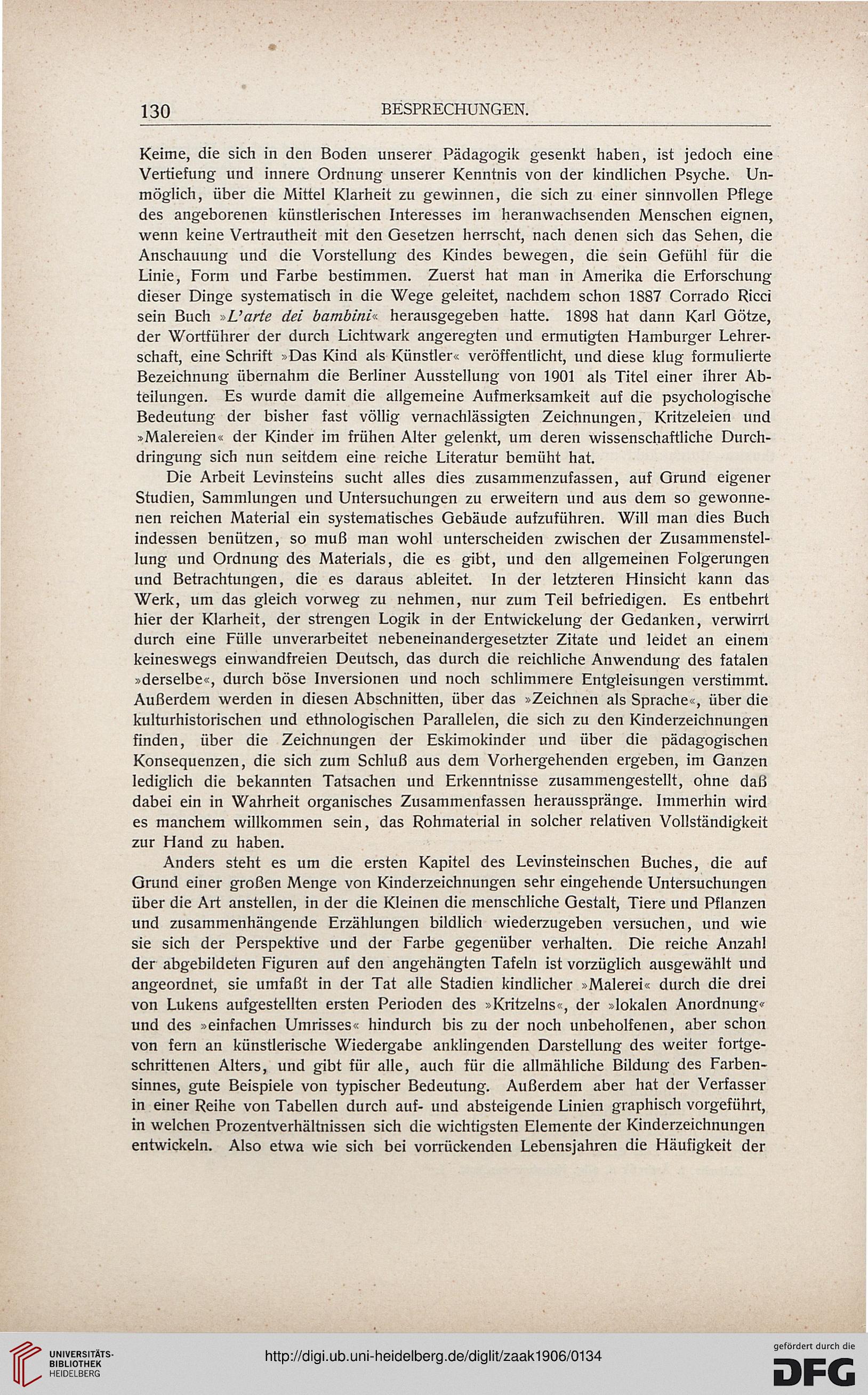130 BESPRECHUNGEN.
Keime, die sich in den Boden unserer Pädagogik gesenkt haben, ist jedoch eine
Vertiefung und innere Ordnung unserer Kenntnis von der kindlichen Psyche. Un-
möglich, über die Mittel Klarheit zu gewinnen, die sich zu einer sinnvollen Pflege
des angeborenen künstlerischen Interesses im heranwachsenden Menschen eignen,
wenn keine Vertrautheit mit den Gesetzen herrscht, nach denen sich das Sehen, die
Anschauung und die Vorstellung des Kindes bewegen, die sein Gefühl für die
Linie, Form und Farbe bestimmen. Zuerst hat man in Amerika die Erforschung
dieser Dinge systematisch in die Wege geleitet, nachdem schon 1887 Corrado Ricci
sein Buch »L'arte dei bambinU herausgegeben hatte. 1898 hat dann Karl Götze,
der Wortführer der durch Lichtwark angeregten und ermutigten Hamburger Lehrer-
schaft, eine Schrift »Das Kind als Künstler« veröffentlicht, und diese klug formulierte
Bezeichnung übernahm die Berliner Ausstellung von 1901 als Titel einer ihrer Ab-
teilungen. Es wurde damit die allgemeine Aufmerksamkeit auf die psychologische
Bedeutung der bisher fast völlig vernachlässigten Zeichnungen, Kritzeleien und
»Malereien« der Kinder im frühen Alter gelenkt, um deren wissenschaftliche Durch-
dringung sich nun seitdem eine reiche Literatur bemüht hat.
Die Arbeit Levinsteins sucht alles dies zusammenzufassen, auf Grund eigener
Studien, Sammlungen und Untersuchungen zu erweitern und aus dem so gewonne-
nen reichen Material ein systematisches Gebäude aufzuführen. Will man dies Buch
indessen benützen, so muß man wohl unterscheiden zwischen der Zusammenstel-
lung und Ordnung des Materials, die es gibt, und den allgemeinen Folgerungen
und Betrachtungen, die es daraus ableitet. In der letzteren Hinsicht kann das
Werk, um das gleich vorweg zu nehmen, nur zum Teil befriedigen. Es entbehrt
hier der Klarheit, der strengen Logik in der Entwickelung der Gedanken, verwirrt
durch eine Fülle unverarbeitet nebeneinandergesetzter Zitate und leidet an einem
keineswegs einwandfreien Deutsch, das durch die reichliche Anwendung des fatalen
»derselbe«, durch böse Inversionen und noch schlimmere Entgleisungen verstimmt.
Außerdem werden in diesen Abschnitten, über das »Zeichnen als Sprache«, über die
kulturhistorischen und ethnologischen Parallelen, die sich zu den Kinderzeichnungen
finden, über die Zeichnungen der Eskimokinder und über die pädagogischen
Konsequenzen, die sich zum Schluß aus dem Vorhergehenden ergeben, im Ganzen
lediglich die bekannten Tatsachen und Erkenntnisse zusammengestellt, ohne daß
dabei ein in Wahrheit organisches Zusammenfassen herausspränge. Immerhin wird
es manchem willkommen sein, das Rohmaterial in solcher relativen Vollständigkeit
zur Hand zu haben.
Anders steht es um die ersten Kapitel des Levinsteinschen Buches, die auf
Grund einer großen Menge von Kinderzeichnungen sehr eingehende Untersuchungen
über die Art anstellen, in der die Kleinen die menschliche Gestalt, Tiere und Pflanzen
und zusammenhängende Erzählungen bildlich wiederzugeben versuchen, und wie
sie sich der Perspektive und der Farbe gegenüber verhalten. Die reiche Anzahl
der abgebildeten Figuren auf den angehängten Tafeln ist vorzüglich ausgewählt und
angeordnet, sie umfaßt in der Tat alle Stadien kindlicher »Malerei« durch die drei
von Lukens aufgestellten ersten Perioden des »Kritzeins«, der »lokalen Anordnung«
und des »einfachen Umrisses« hindurch bis zu der noch unbeholfenen, aber schon
von fern an künstlerische Wiedergabe anklingenden Darstellung des weiter fortge-
schrittenen Alters, und gibt für alle, auch für die allmähliche Bildung des Farben-
sinnes, gute Beispiele von typischer Bedeutung. Außerdem aber hat der Verfasser
in einer Reihe von Tabellen durch auf- und absteigende Linien graphisch vorgeführt,
in welchen Prozentverhältnissen sich die wichtigsten Elemente der Kinderzeichnungen
entwickeln. Also etwa wie sich bei vorrückenden Lebensjahren die Häufigkeit der
Keime, die sich in den Boden unserer Pädagogik gesenkt haben, ist jedoch eine
Vertiefung und innere Ordnung unserer Kenntnis von der kindlichen Psyche. Un-
möglich, über die Mittel Klarheit zu gewinnen, die sich zu einer sinnvollen Pflege
des angeborenen künstlerischen Interesses im heranwachsenden Menschen eignen,
wenn keine Vertrautheit mit den Gesetzen herrscht, nach denen sich das Sehen, die
Anschauung und die Vorstellung des Kindes bewegen, die sein Gefühl für die
Linie, Form und Farbe bestimmen. Zuerst hat man in Amerika die Erforschung
dieser Dinge systematisch in die Wege geleitet, nachdem schon 1887 Corrado Ricci
sein Buch »L'arte dei bambinU herausgegeben hatte. 1898 hat dann Karl Götze,
der Wortführer der durch Lichtwark angeregten und ermutigten Hamburger Lehrer-
schaft, eine Schrift »Das Kind als Künstler« veröffentlicht, und diese klug formulierte
Bezeichnung übernahm die Berliner Ausstellung von 1901 als Titel einer ihrer Ab-
teilungen. Es wurde damit die allgemeine Aufmerksamkeit auf die psychologische
Bedeutung der bisher fast völlig vernachlässigten Zeichnungen, Kritzeleien und
»Malereien« der Kinder im frühen Alter gelenkt, um deren wissenschaftliche Durch-
dringung sich nun seitdem eine reiche Literatur bemüht hat.
Die Arbeit Levinsteins sucht alles dies zusammenzufassen, auf Grund eigener
Studien, Sammlungen und Untersuchungen zu erweitern und aus dem so gewonne-
nen reichen Material ein systematisches Gebäude aufzuführen. Will man dies Buch
indessen benützen, so muß man wohl unterscheiden zwischen der Zusammenstel-
lung und Ordnung des Materials, die es gibt, und den allgemeinen Folgerungen
und Betrachtungen, die es daraus ableitet. In der letzteren Hinsicht kann das
Werk, um das gleich vorweg zu nehmen, nur zum Teil befriedigen. Es entbehrt
hier der Klarheit, der strengen Logik in der Entwickelung der Gedanken, verwirrt
durch eine Fülle unverarbeitet nebeneinandergesetzter Zitate und leidet an einem
keineswegs einwandfreien Deutsch, das durch die reichliche Anwendung des fatalen
»derselbe«, durch böse Inversionen und noch schlimmere Entgleisungen verstimmt.
Außerdem werden in diesen Abschnitten, über das »Zeichnen als Sprache«, über die
kulturhistorischen und ethnologischen Parallelen, die sich zu den Kinderzeichnungen
finden, über die Zeichnungen der Eskimokinder und über die pädagogischen
Konsequenzen, die sich zum Schluß aus dem Vorhergehenden ergeben, im Ganzen
lediglich die bekannten Tatsachen und Erkenntnisse zusammengestellt, ohne daß
dabei ein in Wahrheit organisches Zusammenfassen herausspränge. Immerhin wird
es manchem willkommen sein, das Rohmaterial in solcher relativen Vollständigkeit
zur Hand zu haben.
Anders steht es um die ersten Kapitel des Levinsteinschen Buches, die auf
Grund einer großen Menge von Kinderzeichnungen sehr eingehende Untersuchungen
über die Art anstellen, in der die Kleinen die menschliche Gestalt, Tiere und Pflanzen
und zusammenhängende Erzählungen bildlich wiederzugeben versuchen, und wie
sie sich der Perspektive und der Farbe gegenüber verhalten. Die reiche Anzahl
der abgebildeten Figuren auf den angehängten Tafeln ist vorzüglich ausgewählt und
angeordnet, sie umfaßt in der Tat alle Stadien kindlicher »Malerei« durch die drei
von Lukens aufgestellten ersten Perioden des »Kritzeins«, der »lokalen Anordnung«
und des »einfachen Umrisses« hindurch bis zu der noch unbeholfenen, aber schon
von fern an künstlerische Wiedergabe anklingenden Darstellung des weiter fortge-
schrittenen Alters, und gibt für alle, auch für die allmähliche Bildung des Farben-
sinnes, gute Beispiele von typischer Bedeutung. Außerdem aber hat der Verfasser
in einer Reihe von Tabellen durch auf- und absteigende Linien graphisch vorgeführt,
in welchen Prozentverhältnissen sich die wichtigsten Elemente der Kinderzeichnungen
entwickeln. Also etwa wie sich bei vorrückenden Lebensjahren die Häufigkeit der